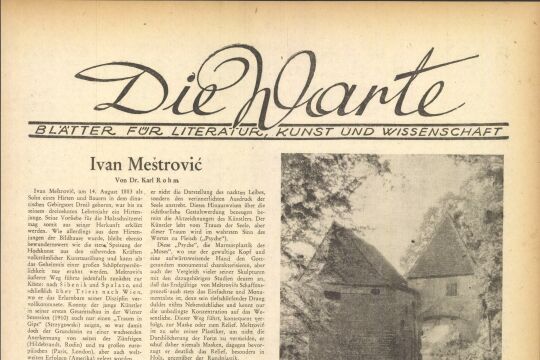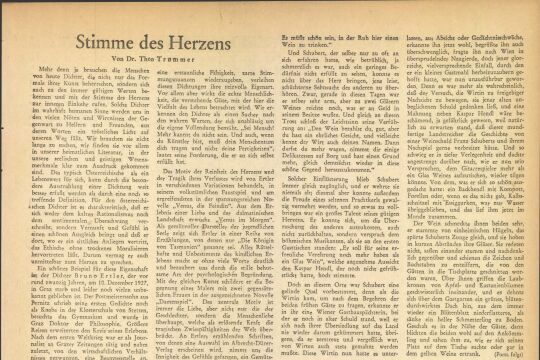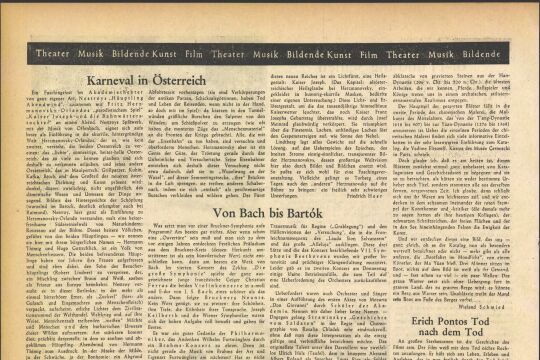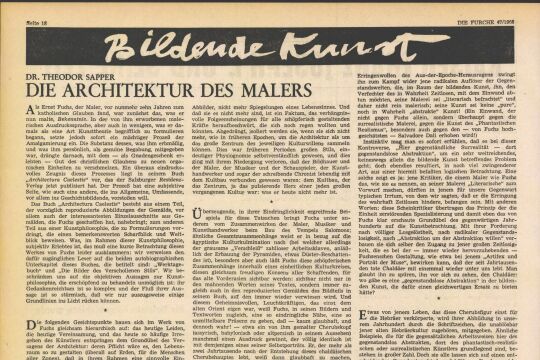Ein gotischer Sdlberbecher und ein Name werden zu Brücken aus der Vergangenheit in die Gegenwart, geleiten uns in eine der schönsten Ausstellungen, die in Wien je zu sehen war, bilden die Verbindung zwischen europäischer und ostasiatischer Kultur.
Der Silberbecher steht in der Ausstellung „Europäische Kunst um 1400“. Sorgfältig umschließt seine elegante Fassung eine Schale mit grüngrauer Glasur. Sie stammt aus Ostasien—aus China oder Korea? — und berichtet von langen Karawanenzügen, mühsamen und gefährlichen Seefahrten und von der ehrfürchtigen Verehrung, die diese sublime Töpferkunst bereits früh in Europa genoß. Die allgemeine Bewunderung galt nicht nur ihrer hervorragenden Schönheit oder der unter hohen Temperaturen erzielten glasartigen Festigkeit und opaken Durchsichtigkeit, sondern auch der magischen Gabe, die man jenen Gefäßen mit grüngrauer Glasur zuschrieb, die Farbe vergifteter Speisen zu verändern.
Bei den Mächtigen dieser Welt muß ein lebhaftes Verlangen nach ihnen bestanden haben.
Der Name dieser Glasur, ihrer geheimnisvollen Farbe, zwischen Grau und Grün schwebend, oft mit einem Hauch von Blau durchzogen, ist „Seladon“. Er bedeutet „Seegrün“, ist „Celadon“, der Schäfer eines französischen Romans des 18. Jahrhunderts. Zu dieser Zeit trugen die Schäfer auf der Bühne grüne Gewänder, der Name heftete sich an die Farbe und dann an die ostasiatischen Keramiken, die damals wieder das ästhetische Empfinden Europas erregten.
Woher kommt es, daß man zutiefst erregt, ja bewegt, vor den Meisterwerken koreanischer Töpferkunst, ihren subtilen Formen, dem wolkigen Glanz ihrer Seladon-Glasuren, dem unbeschreiblich Weiß ihrer späten Keramik steht? Was ist es, das uns immer wieder zurückführt zu ihrer Harmonie, das uns fesselt und nicht losläßt, wie eine geheimnisvolle Aufforderung? Ist es ihre Schönheit — welche Art von Schönheit? Ihre Vollkommenheit — welche Art von Vollkommenheit? Was ist der Grund ihrer Magie, ihres Zaubers, den sie so spät noch nach Jahrhunderten auf uns, die Besucher der Auststellung „Meisterwerke der koreanischen Kunst“ im Wiener Museum für Völkerkunde, ausüben.
Ia seinem „Staat“ fragt Plato, ob nicht das „Hervorragende, die Schönheit und das Zweckmäßige jedes geschaffenen Objektes nur in Beziehung zu der Aufgabe gemessen werden kann, die seine Herstellung leitete“, und Soetsu Yanagi stellt fest, daß „Nutzbarkeit das erste Prinzip der Schönheit ist“ und darum „den Gegenständen des täglichen Lebens so große Bedeutung gegeben wurde“. Darnach ergibt die Erfüllung einer Funktion, die wir in einem Gefäß spüren, die Reinheit seiner Zweckgerichtetheit, das erste Fundament unserer ästhetischen Befriedigung. Wir erkennen, daß es so sein muß wie es ist, sein Sein findet Rechtfertigung und wird Ganzheit. Die Form wird zur Erfüllung eines Inhaltes — die Gleichung geht auf. Es ist natürlich Unsinn, zu erklären — wie es die Funktionalisten tun —, daß bloße Nutzbarkeit synonym mit Schönheit wäre. Ein einfaches Gefäß, das zweckmäßig entworfen wurde, ist deshalb noch kein Kunstwerk. Ein Abgrund trennt die Objekte, die so billig und einfach als möglich hergestellt werden, um praktischen Ansprüchen zu genügen, von jenen, in denen ein Künstler ästhetische Ziele bewußt verfolgt, versucht, höheren Ansprüchen zu genügen, die ihm seine Sensibilität diktiert, dem Zweckmäßigen neue Varianten abzugewinnen, die aus seinem Empfinden, seiner Erkenntnis der Welt wachsen. Solche Kunstwerke finden wir in der koreanischen Töpferkunst.
Was diese Ausstellung zeigt, sind vor allem Arbeiten aus dem 11. und 12. Jahrhundert, der Koryo-Zeit, die der späten Sung-Periode chinesischer Keramik entspricht. Natürlich stehen sie unter dem Einfluß der erlauchten Leistungen dieser Kunst, haben aber Eigenes zur Vollendung ausgebildet. Sie besitzen die die Form einende Eleganz der Sung-Keramik, die nicht mehr die Gefäßabschnitte wie in der Tang-Periode akzentuiert, haben aber anderseits einiges von deren lebendigen Ursprünglichkeit beibehalten. Ihre leichte, manchmal betonte Assymetrie, die die formenden Hände des Töpfers, seinen plastischen Zugriff lebendig erhält, weist auf den grundlegenden Unterschied hin, der die ostasiatische Keramik etwa von der Griechenlands trennt.
Die viel frühere griechische Töpferkunst folgt einem rationalen Ideal, ihre Proportionen sind regelmäßig und folgen exakten Maßen. Ihre Schönheit, wenn man bei ihr von einer solchen sprechen kann, was von manchen Kennern oft mit Recht bestritten wird, da die Dekoration die Form durch erzählende Darstellungen zu überwuchern droht, liegt in einem abstrakten, geistigen Anspruch, der sich an den Verstand richtet. Die ostasiatische Keramik — und hier im besonderen die koreanische — wendet sich an die Empfindung, an eine höchst gespannte Sensibilität, die einer Welterfahrung der universellen Einheit entspricht. Es ist der Taoismus, der Glaube an eine allumfassende
Harmonie, der ihre Formen prägt, eine Harmonie die weniger rationaler, als empfundener, empirischer Natur ist, und das Geringste mit dem Höchsten in Verbindung bringt. Daraus vielleicht, aus dem Bestreben, den Menschen in Einklang mit den höchsten Prinzipien zu bringen, entsteht der spirituelle Aufschwung, die Aufforderung, den diese Gefäße und Objekte in sich tragen, die sie gleichzeitig in Form und Dekoration mit der Natur in Verbindung setzt. Denn in geheimnisvoller und oft offensichtlicher Weise stehen sie mit Naturformen in Korrespondenz, die in ihnen sublim verwandelt wieder auftauchen. Blüten, Knospen, Fruchtstempel, Kürbisformen und -ranken leben in ihnen, symbolische, glückbringende Darstellungen ritzen und gliedern ihre Form. Und wie alle Natur auf eine höhere Harmonie hinzuweisen scheint, die vielleicht in der rationalen sphärischen Geometrie und Ideal wiederfindet, geben sie in der Andeutung dieser Geometrie unserem Geist die Bewegung, die herausgefordert, nach Erfüllung strebt und jene Erschütterung mitteilt, die uns vor ihnen ergreift. Kann mehr von ihnen gesagt werden, als daß sie uns zu hohen Gedanken anregen?
Über ihnen sitzt, lächelnd, vergoldet, der Maitreya-Buddha, ein Meisterwerk ostasiatischer Kunst, einen Fuß bereits auf die Erde gesenkt, seiner Stunde wartend, in der er zum Erleuchter des künftigen Weltzeitalters werden soll. Denn Taoismus, Kon-fuzianismus und Buddhismus sind es, die die geistige Landschaft Koreas prägten.
“T\en Zen-Buddhismus finden wir in der Darstellung des U „Dharma“ wieder, der im fünften Jahrhundert in Japan die Zen-Sekte zur absichtslosen Bewältigung des Lebens gründete. Es ist ein Bild auf Papier, eine Tuschzeichnung, die in wenigen prägnanten Zügen das Antlitz eines von der Aufgabe Ergriffenen zeichnet. Früher entstand das Seidenrollenbild der „Hündin mit Jungen“, das sich schon in seiner Expressivität und soliden Eleganz von chinesischer Harmonie abhebt und fast an Pisanello erinnert. Bemerkenswert ist auch das Bambusbild von Yi Chong aus dem 16. Jahrhundert, vor allem dadurch, daß sein Maler Mitglied der königlichen Farnilie war, ein Hinwies darauf, daß die Künstler Ostasiens damals und auch später den höchsten Klassen angehörten und — anders als in Europa — zumeist Kraft ihrer Begabung in sie aufgenommen wurden. Bezeichnend für die koreanische Malerei sind auch die beiden Bilder von Chong Son (1676—1759) die die „Diamantberge“ und den „Ingwanberg“ darstellen. Findet man bei vielen seiner Zeitgenossen die Imitation chinesischer Malerei, so zeichnet sich bei Chong Son besonders das Bild des Ingwanberges durch eine Abweichung von dieser Stereotypisierung aus. da hier unmittelbare Inspiritation durch die koreanisch Landschaft spürbar wird, ein spritueller Realismus, der an die Gebirge Breughels erinnert.
Wie alle ostasiatische Malerei gehorcht auch die koreanische dem Gesetz, das in den Worten „i tsai pi hsien“ — „die Idee entsteht, bevor der Pinsel gebraucht wird“ — enthalten ist, und worüber der Sung-Maler Su Shi sagt: „Um den Bambus zu malen, muß man ihn vollkommen in sich haben. Nimm den Pinsel, blicke gespannt auf das Papier, stelle dir vor was du malen willst. Folge schnell deiner Vorstellung und verfolge direkt das, was du siehst, wie ein Falke auf den hüpfenden Hasen stößt — das geringste Nachlassen läßt es dir entschlüpfen.“
So ist wie die Keramik die ostasiatische Malerei Essenz, entstanden aus der unaufhörlichen Beobachtung der Natur, ja, aus der Identifikation des Künstlers mit ihren Gesetzen. Dies ist das Wesentliche — um den Bambus zu malen, muß man das Wachsen des Bambus gespürt haben, um den Karpfen darzustellen muß man den Karpfen gefühlt haben, in der Harmonie der Dinge aufgegangen sein. Daher auch die Künstlerlegende vom Maler, der in sein Bild tritt, das eine Landschaft darstellt, und darin verschwindet, wie durch eine Tür zur höheren Wirklichkeit. Liebe und Demut, als sanfte Gewalten, unterworfen der Bescheidung im Orakelspiel des I Ging, das sich auf die vereinten Gegensätze des Yang und Yin, des Männlichen und Weiblichen gründet, seiner Übergänge und Wandlungen, sind Schlüssel dieser Geistigkeit, die uns gar nicht so fremd ist, wie es scheinen mag, können wir doch selbst im Kin Ping Meh, dieser amoralischen, moralisierenden, Rabelais'schen Buleske, ewig Menschliches, Allzumenschliches feststellen. Gold und grüne Jade, wie unser Titel lautet, sie finden sich wieder in den frühesten Zeugnissen koreanischer Kultur. Im Kronenschmuck, der Gürtelschnalle und dem Gürtel mit siebzehn Anhängern, die aus der Zeit zwischen dem ersten und sechsten Jahrhundert nach Christus stammen. Deshalb, weil die Seladon-GIasur auf das Bestreben zurückzuführen ist, Jade zu imitieren, ihr geheimnisvolles Leben, ihre magischen Eigenschaften. An der Krone hängen die magatamas, hornartige Objekte magischer Herkunft, am Gürtel ebenso. Die Krone ist baumartig, flügelbewehrt, ein Drachenschmuck — anders als in Europa —, den Drachen als Abzeichen kaiserlicher Würde, begreifend, regenspendend, belebend, gutmütig, als Vereinigung des Himmels mit der Erde. Jeder Anhänger des Gürtels ist Beweis von Liebe und Freundschaft. „Wer gibt mir eine Quitte, ich gebe ihm ein wichtiges Seitenornament als Gürtelanhänger. Es soll nicht ein Dankgeschenk sein, aber ich möchte unsere Freundschaft immerwährend machen. Wer gibt mir einen Pfirsich, ich werde ihm ein rotes Jade yao geben . . . Wer gibt mir eine Pflaume, ich geben ihm das schwarze Jadeornament Kiu ...“ Diese Ornamente wurden manchmal mit den Toten begraben, als Sinnbilder des Scheidens — aber ebenso einer ewigen Liebe.
Jade ist ein altes, geheimnisvolles Material ostasiatischer Kunst. Die Bearbeitung dieses Specksteins geht auf legendäre Zeiten zurück, kann bis in das alte Babylonien hin verfolgt werden. Die Werkzeuge, es zu bearbeiten, waren einfach und primitiv, eiserne Bohrer und Scheiben, Schleifmittel wie Quarz, Karborundum und Rubinstaub, die mit Holz, Leder und Tierhäuten verwendet wurden, um eine vollkommene, glatte Oberfläche zu erzielen. In seiner Vermählung mit zu Blättern gehämmertem Gold, mit Türkisen als Inkrustation, spricht es zu uns von dem Ehrfurcht erheischenden Leben, das die Kultur Koreas erfüllte.
T~\ iese einzigartige Ausstellung ist dem Bundesministerium für Unterricht und vor allem der Initiative von Frau Dr. Kaindl zu verdanken, ebenso wie den koreanischen Emissären, unter ihnen dem Professor Hisoon Choi, dem ausgezeichneten Kurator der Abteilung der schönen Künste des Nationalmuseums von Korea in Seoul, die die Entscheidung trafen,, diese einmalige Sammlung, die nur in wenigen Städten Europas gezeigt wurde, auch Wien zugänglich zu machen. Die ingeniöse, wie in der ägyptischen Ausstellung, aus einfachen Elementen zusammensetzbare Anordnung durch den Architekten Ottokar Uhl, wirkt durch zweckmäßige und sachliche Schönheit.