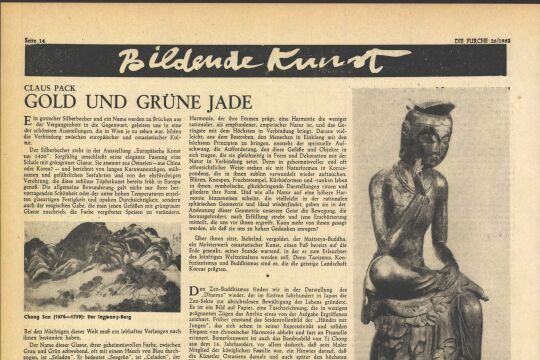Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
BEGEGNUNG MIT DEM OSTEN
Berlins „Festwochen 1965“ sind vorüber. Das „National-Theater“ mit Laurence Olivier (Othello) ist abgereist. Der „Coro dell'Accademia Filarmondca Romana“ hat Berlin verlassen. Die Belgrader Philharmonie, das Ensemble „Pro musioa New York, die Quartette Drolc und Perenndn und der „Kulturtroß“ aus dem fernöstlichsten Inselreich haben ihre Heimreise hinter sich. Berlin kehrte in den Rhythmus seines landeseigenen Kunstbetriebes zurück, woraus es knappe drei Wochen entschlüpft senden. Der arrivierte Laufband-Besucherstrom drehte seine Optik von heute auf morgen auf andere Dinge als Kunst zurück. Von den Kieferwäldern strömt herbstliche Harzluft. Was aber bleibt von der Unrast des September-Oktober-Trubels? Hatten die Kunstexperten aus aller Welt umsonst ihre Kugelschreiber mit dem Elfenbeingriffel vertauscht? Die Frage scheint deshalb am Platz, weil das Management der Sommerfestivals Millionenstädte, aufgeputzte Residenzen und idyllische Kurorte wie ein reziproker Tourismus gleichermaßen überschwemmt.
Als Berlin mit seinen „Festwochen“ vor vielen Jahren begann, hatte man in Deutschland in der Tat einiges nachzuholen. Mit Recht schäumten die Sturzwellen des Avantgardismus über Stein und Stock der Ruinenfelder; befruchtend oder entnervend, — gleichviel, stets anregend. Inzwischen verlief sich die Flut, nicht nur in Berlin. Das Nachzuholende holte sich sich selbst ein, und Nikoias Nabokoff, der jetzige anglo-russische Leiter der Festwochen, versucht, neue Schwerpunkte zu schaffen und den Radius der Begriffe Berlin und Kunst global zu erweitern. Was die Technik längst zuwege brachte soll von der Kunst integriert werden. In diesem Zusammenhang machen Amerika, Afrika oder — wie heuer — der Ferne Osten keinen Unterschied.
Nabokoff hatte die großartig-kostspielige Idee, Japans originales Kyogen- und Kabukd-Theater mit seinem riesigen Apparat von staatlich akkreditierten Schauspielern und Musikern, mit kostbaren Kostümen, Requisiten und (weniger kostbaren) Dekorationen, obendrein begleitet von einer Elite aus Professoren, Dozenten und Kunstexperten, auf die Reise nach Berlin zu schicken. Denn — so folgerte man auf beiden Seiten messerscharf — wo das Fernste und Fremdeste sich fruchtbar begegnen solle, müsse gründliche Arbeit, Vorbereitung und Aufklärung geleistet werden. „Fern“ und „Fremd“ soll hier wortwörtlich für zwei Kunstsprachen gelten, die außer ihrem ehrwürdigen Alter und ihrer menschliahen Ursubstanz wohl kaum etwas besitzen, was sie aus sich selbst verbindet. Das Primitive (primitiver Kulturen) können wir wie alles Naive unmittelbar erfassen. Das jahrhundertelang Verfeinerte und Kanonisierte dagegen läßt sich nur über den Weg des Verstandes und der Erfahrung schauend genießen. Als Nabokoff vor der internationalen Presse, in Gegenwart des japanischen Botschafters und der Kabuki-Truppe dazu aufforderte, „lieber mit Dankbarkeit zu empfangen, als zu verstehen, setzte er genau auf die falsche Karte; denn die allgemeine wie besondere Resonanz der japanischen Theaterabende bewies, daß das eine vom andern nicht zu trennen war und tatsächlich auch nicht getrennt wurde. Das Publikum „verstand dank reichlicher Orientierung durch Presse, Rundfunk, Vorträge und Programmhefte, ohne das Geflecht von Gesten und Figuren und ohne die flexiblen Gefühlswerte der japanischen Musik-und Theatersprache real entziffern zu können. Es war dankbar für soviel ästhetische Vollkommenheit, Klarheit und Sauberkeit.
Ein paar Daten zur Geschichte: Das ältere Kyogen-Theater ■ blühte zwischen 1185 und 1615, das jüngere Kabuki-Theater, ein Kind des Puppenspiels Jörurd, bunter und volkstümlicher zwischen 1615 und 1867. Beide Gattungen sind Spiegelbilder verschiedenartiger gesellschaftlicher Epochen. Einzigartig am klassischen japanischen Theater ist die Tatsache, daß sich seine Schätze an schauspielerischer Kunst, seine Rezitationsweise, seine Pantomimik, Kostüme, Requisiten und musikalische Untermalung durch die Jahrhunderte im wesentlichen unverändert erhalten haben. Ein japanischer Professor sagte uns, daß sich die Bühnenkunst des Inselreiches jahrhundertelang nicht nach außen entwickelt habe (wie in Europa), sondern nach innen; d. h. in die permanente Verfeinerung, Präzision und Stilisierung der Mittel; in die knappste, dabei aber breiteste Genauigket der Details. Vollständige Kabuki-Spiele dauern stundenlang, ja ganze Abende und Wochen hindurch. Natürlich lassen sich auf allerhöchster Ebene gewisse Parallelen etwa zur attischen Tragödie, zu den Lazzi der Commedia delParte oder zu den von Knaben gespielten Frauenrollen des elisabethanischen Theaters ziehen. Allein, sie bleiben im Äußeren stecken und nützen wenig. Wir kommen einfach ohne Kenntnisse über den Buddhismus und Zen-Kult und ohne Orientierung im höfisch-ritterlichen Zeremoniell nicht recht weiter.
Was spielt man? Die Frage ist relativ einfach zu beantworten: Szenen, Situationen mythologischen oder historischen Inhalts. Um nur einige Titel zu nennen: „Zwei Fürsten“, „Der Melonendieb“, „Das Zauberwort“, „Blutrache“ oder Tanzszenen von berückender Grazie (in der Darstellung von Frauenrollen) und mimischer Kraft — Die Kyogen-Truppe spielte im Theater der Akademie der Künste am Tiergarten; in einem Raum aus Naturziegel, Beton und Glas. Hier fügt sich das klassische, quadratische Tempel-Modell aus hellem Naturholz mit der seitlichen Auftritts-Pergola im Hintergrund überraschend gut ein. Das Kabuki-Theater gastierte im Haus der Freien Volksbühne. Wiederum zu Recht. Denn man spielte dort mit eigenen Dekorationen; vor bemalten Versatzstücken und Prospekten, die (nach unseren Maßstäben) eher einer „Butterfly zu Gesicht gestanden hätten. Sei dem, wie ihm wolle. Man vergaß den Flitter angesichts der märchenhaft schönen, kostbaren Kostüme, Requisiten und Masken. Man starrte gebannt auf jede Einzelheit einer ausgespielten Harakiri-Zeremonie, auf einen beleidigten Edelmann, dessen ganzer Körper zu zittern begann, weil nur diese Äußerung des Zornes ihm gestattet war; auf einen alten Mönch, der die Angst und Verlorenheit des Verbannten mit winzigen, katzenähnlichen Klageworten in unser Herz schnitt und — quasi stumm — den ewigen Jammer der Kreatur verkörperte. Eine rätselhaft-fremde, uralte Kultur öffnete hier ihren Shinto-Sohrein.
Allein: der Komplex „Japan“ gab uns noch in anderer Hinsicht zu denken. Wir wissen, daß dieses Land heute Künstler hervorbringt, die in der Lage sind, etwa ein Schubertlied mit jener Schwermut zu singen, vor deren dunklen Wassern wir selbst zögern und zurückschaudern. Wir wissen, daß dieses gleiche Volk sich in den modernsten, abstraktesten Techniken der europäischen Kunst auskennt und dennoch seine Theaterkunst von mehr als sieben Jahrhunderten haargenau beherrscht Jener oben zitierte Professor sagte uns: Europas Moderne bedeute für Japan historisch und psychologisch die Entdeckung des Individuellen. Zwangsläufig stellt sich die Gegenfrage: Was sollen wir dem Gastspiel der Japaner schöpferisch entnehmen? An vieles könnte man denken. Aber wenn irgend möglich sollte es doch eine neue Idee von der Gegenwärtigkeit unserer eigenen Geschichte und ein tieferes Bemühen um die exakte Wahrung ihrer höchsten Maßstäbe in der Kunst wecken. Wenn wir Europäer Japan den Weg zur Entfesselung des Individuums zeigen, sollte dann nicht Japan uns lehren, das „Sein in der Zeit und die Würde des Gültigen in der Kunst (wieder) zu finden?
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!