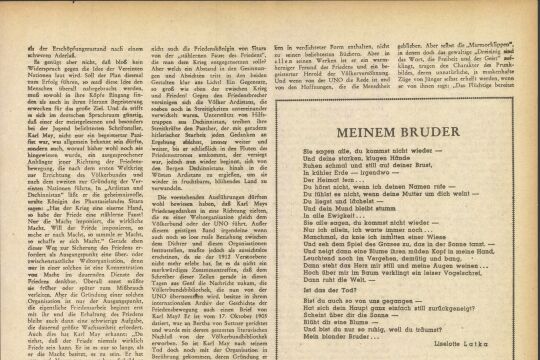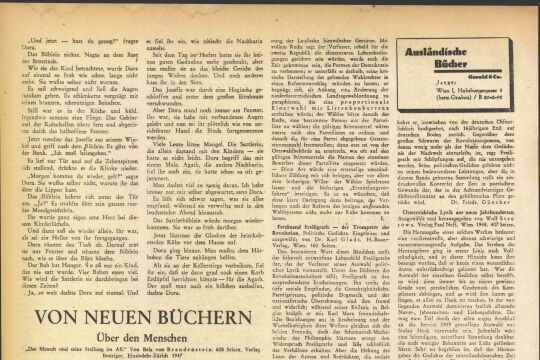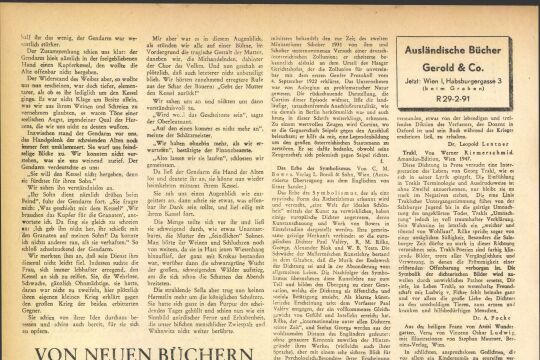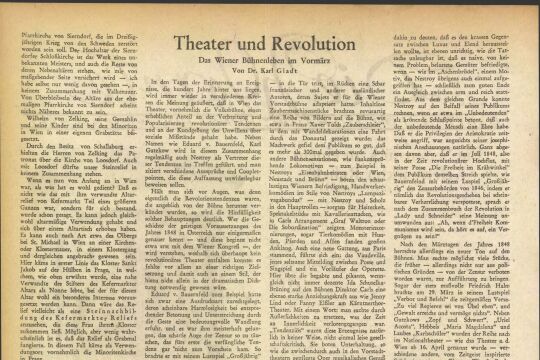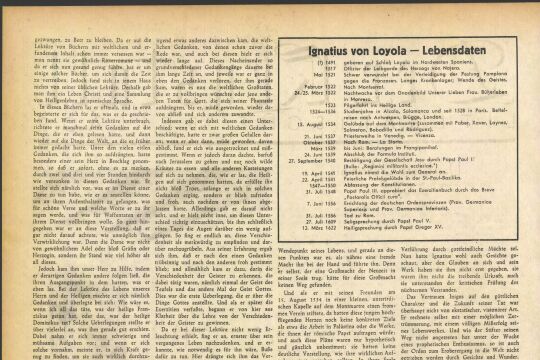Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die „heilige Kunst“
Alchimie — Hagia Techne! Wie geringschätzig beurteilt doch die landläufige Meinung diese „heilige Kunst“ der 'Alten!
Noch immer mit dem ganzen wissenschaftlichen Hochmut des verflossenen Jahrhunderts behaftet, pflegen wir über die angebliche Beschränktheit ihrer Adepten zu lächeln und vermeinen die Naturanschauung von Männern, wie Raimundus Lullus, Villanova, Albertus Magnus, Thomas von Aquin und anderer, mit einer lässigen Handbewegung als unreif und kindisch abtun zu können. Aber vielleicht ist der Tag nicht mehr ferne, wo das, was heute vielen als wissenschaftliche Weltanschauung gilt, unter dem empörten Lachen einer kommenden Generation zu Grabe getragen wird? Zu sehr ist die Unzulänglichkeit unserer eigenen mechanistischen Weltanschauung fühlbar geworden, zu sehr die Grundlosigkeit überheblichen Stolzes.
Nach einer Orgie des Zerlegens und Zerteilens stehen wir ernüchtert vor einem Haufen empirischer Tatsachen. Wir hatten vermeint, eine Maschine zu zerlegen, deren Räder, Kolben und Gestänge wieder zusammenzufügen uns ein leichtes zu sein schien, und nun müssen wir erkennen, daß wir einen Organismus zerstückelt haben, dem neues Leben einzuhauchen wir außerstande sind.
So stehen wir denn ratlos vor den Teilen, die wir fein säuberlich rubriziert und katalogisiert haben, und halten Ausschau nach dem großen Magier, der sie wieder zu einem lebendigen Ganzen zusammenzusetzen vermag.
Ist für diese Sehnsucht nach dem Irrationalen nicht bezeichnend, daß gerade die rationalste aller Disziplinen, die theoretische Physik es ist, welche der transzendentalen Freiheit des Willens, auf dem Umweg über das atomare Geschehen, ein Schlupfloch in diese Welt der mechanistischen Determiniertheit öffnen möchte?
Wenn auch der Weg, auf dem die® geschieht, ein verfehlter sein mag — der Materialismus läßt sich nicht aus mechanistischer Geisteshaltung heraus widerlegen—, so ist doch die Tendenz symptomatisch und sie läßt erkennen, daß die Wissenschaft, unbefriedigt vom Bilde der großen Weltmaschine, sich einem neuen Symbol zuwenden möchte.
Diese neue Geisteshaltung macht uns heute geneigter, die universalistischen Theoreme der Alchimie als eine der polaren Lösungen zu würdigen, zwischen welchendie Zwiespältigkeit des menschlichen Intellekts seit jeher hin und her pendelt.
Die Alchimie war eine Philosophie des Stoffes. Sie hatte alles an sich gezogen, was das klassische Altertum und die hellenistl- che Zeit, die Herrn es-Trimegistos-Mystik und die Gnosis, an Erkenntniswerten hervorgebracht hatten. „Das Universum ein geordnetes Ganzes, ein Organismus, zusammengehalten von einer Kraft, aus der alle anderen Kräfte strömen und die über allem als leuchtende Wolke Gottes schwebt“, das ist ihre letzte und höchste Erkenntnis.
Es ist verständlich, daß diese Lehre von der Alleinheit des Naturganzen mit ihrer unleugbaren grandiosen Symbolik auf einen so architektonischen Geist, wie den eines Goethe, einen nachhaltigen Eindruck machen mußte. „Das einzelne verwirrt“, schreibt dieser einmal; „desto angenehmer ist’s, wenn unser Bestreben, die Gegenstände in einem gewissen Zusammenhang zu sehen, einigermaßen gefördert wird", und: „Mir graut vor der empirischen Weltbreite. Die Wissenschaft geht darauf aus, sich an die Stelle der Natur zu setzen und wird nach und nach so unbegreiflich als diese selbst“.
Die Einstellung seines Wesens, die aus diesen Worten hervorleuchtet, hatte ihn dazu geführt, Alchimie zu betreiben und die mittelalterliche Mystik, die Spekulationen Brunos und Spinozas zu studieren. Die andere Richtung seines Wesens aber zog ihn immer wieder zur Betrachtung der gegenständlichen Natur, zum naiven Anschauen, zurück. Daher war Goethe niemals dogmatischer Monist, weder spiritualistischer noch materialistischer Prägung. Als den seiner Auffassung von der Natur angemessensten Standpunkt wählte er denjenigen genau in der Mitte zwischen Objekt und Subjekt. So wie er warnt, auf der Hut zu sein vor dem Wahne des objektiven Wissens, des Wissens um Millionen von Tatsachen, das schließlich auch für den Eingeweihten immer fragmentarischer und inhaltsleerer wird, ebenso warnt er vor dem „bequemen Mystizismus, der seine Armut gern hinter einer respektablen Dunkelheit verbirgt“. Vielleicht wird diese Goethesche Art, die Natur zr betrachten, die sich der urangeborener Dualität des Menschengemütes bewußt ist, eine spätere Epoche zu dem Blickpunkt führen, von dem aus ihr die Zusammenschau des bis dahin angehäuften Tatsachenmaterials und dessen Synthese gelingen wird.
Goethes alchimistische Studien fanden — schon durch die Wahl des Stoffes bedingt — ihren vornehmlichsten Niederschlag in seiner Faust-Dichtung. Mit der ihm eigenen Meisterschaft, nur das Wesentlichste auszudrücken, legte er in dieser Dichtung in wenigen gedrängten Verszeilen das ganze System der alchimistischen Lehrmeinung dar, wie im folgenden aufgezeigt werden soll.
Wenn Faust, in der Betrachtung des Naturganzen versunken, emphatisch ausruft:
„Wie alles sich zum Ganzen webt, Eins in den andern wirkt und lebt! Wie Himmelskräfte auf- und niedersteigen Und sich die goldnen Eimer reichen! Mit segenduftenden Schwingen Vom Himmel durch die Erde dringen, Harmonisch all das All durchkingen …“
dann spricht er nur in dithyrambischen Worten die platonische Ansicht von der Verwandtschaft des Ähnlichen aus. Diese gipfelte in der Vorstellung vom ewigen Kreislauf der Elemente, welche nach Platon nichts anderes als geometrisch geformte Urmaterie sind und daher durch bloßen Konfigurationswechsel ineinander überzugehen vermögen. Eine Anschauung, die mutatis mutandis eine erstaunliche Parallelität zu den heutigen Ansichten der Physik über den atomaren Aufbau der Materie aufweist. Dieser endlose Zusammenhang des kosmischen Geschehens fand im alchimistischen Symbol des „Annulus Platonis" (Ring des Platon), beziehungsweise im „Superius et inferius Hermetis" (im hermetischen Oben und Unten) seinen bildlichen Ausdruck.
Den gleichen Gedanken einer durchgängigen, wechselseitigen Bezogenheit aller Dinge, erweitert durch den Gedanken, daß die an sich zeit- und gestaltlose Urmaterie, die materia prima, sich in ewigem Flusse nach den Bildern der platonischen Ideen formt und umformt, behandelt die Szene im zweiten Teil der Tragödie, in der Faust seinen Höllengefährten bestürmt, Helena und Pari aus dem Reich der Schatten auf die Oberwelt zu zitieren. Mephisto zeigt Faust den Weg, auf dem dieses Unterfangen auszuführen ist, und spricht:
„Ungern entdeck ich höheres Geheimnis.—- Göttinnen thronen hehr in Einsamkeit, Um sie kein Ort, noch weniger eine Zeit; Von ihnen sprechen ist Verlegenheit: Die Mütter sind es!“
Die „Mütter“, „Mutter Erde“ oder „Samen“, so wurde die materia prima von den Adepten genannt.
Dann heißt es weiter:
„Bei seinem Schein wirst du die Mütter sehn. Die einen sitzen, andre stehn und gehn, Wie ’s eben kommt. Gestaltung, Umgestaltung, Des ewigen Sinnes ewige Unterhaltung, Umschwebt von Bildern aller Kreatur.“
Diese Anschauung, in der sich die gegensätzlichen Erkenntnisses eines Heraklit (alles ist in ständigem Flusse begriffen) und eines Parmenides (es gibt nur ein ewig sich gleichbleibendes Sein) auf der höheren Ebene der platonischen Ideenlehre zu einer Einheit vereinigen, modifiziert durch gnostisches Gedankengut, war zum Glaubensbekenntnis der Alchimie geworden.
Die eigentliche alchimistische Lehre von der Möglichkeit einer künstlichen Darstellung der Edelmetalle, stammte aus dem Alexandria der hellenistischen Ära. Es entwickelte sich die Anschauung, daß die Verwandtschaft das Gleiche zum Gleichen ziehe, wobei ein Stoff immer in den nächstverwandten übergehe und als Endprodukt das Gold, als das edelste der Metalle,, entstehe. Diese potentielle Möglichkeit, so glaubte man, könne durch Zuschlag einer färbenden Qualität zu irgendeinem weiblichen Prinzip, zum Beispiel Quecksilber, zur Aktualität aktiviert werden. Das golderzeugende Präparat nannte man den „Stein der Weisen“, auch „rote Tinktur" oder „roten Leu“.
Eine solche Golddarstellung schildern uns die folgenden Verse:
„Da ward ein roter Leu, ein kühner Freier,
Im lauen Bad der Lilie vermählt,
Lind beide dann mit offnem Flammenfeuer Von einem Brautgemach ins andere gequält. Erschien darauf in bunten Farben
Die junge Königin im Glas, Hier war die Arzenei..
Das Quecksilber, in der Kunstsprache der Alchimie „weiße Lilie“ genannt, wird also mit dem golderzeugenden Präparat (roter Leu) vermengt und abdestilliert. Das bedeutet die Wendung: „von einem Brautgemach ins andere gequält". Die junge Königin ist das daraus entstandene Gold, dem die Adepten in statu nascendi eine Universalheilkraft zuschrieben.
In diesen knapp 24 Verszeilen hat Goethe die Grundvorstellungen und das praktische Ziel der Alchimie umrissen und mit sparsamsten Mitteln geradezu bildhafte Anschaulichkeit erzielt.
Es ist vielleicht nicht uninteressant, zum Schlüsse noch darauf hinzuweisen, daß auch der Name „Mephistopheles“ alchimistischen Ursprungs ist. Er läßt sich auf Hermes Tri- megistos oder Megistos Hermes, wie diese Personifikation altägyptischer Weisheit auch genannt wurde, zurückführen. Diese mythische Persönlichkeit genoß im Mittelalter hohes Ansehen. Eine spätere Zeit verbal- hornte den Namen Megistos Hermes in Mephistopheles und deutete die Gestalt in einen Erzschelm und Zauberer um. Schließlich wurde Mephistopheles gar für einen höllischen Dämon gehalten, und als solcher fand er Eingang in das Volksbuch, welches auch Goethe als Quelle zu seinem Faust gedient hatte.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!