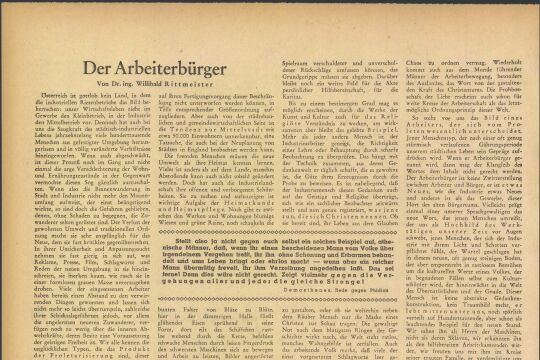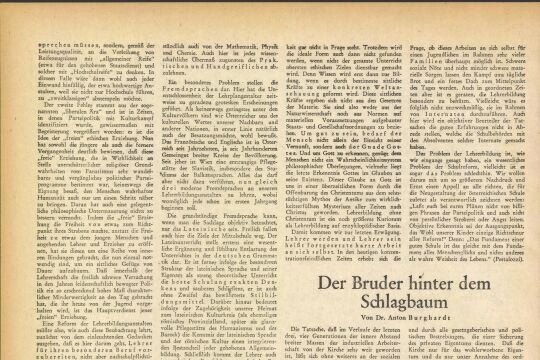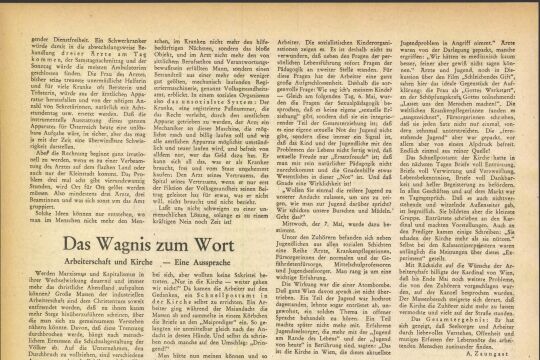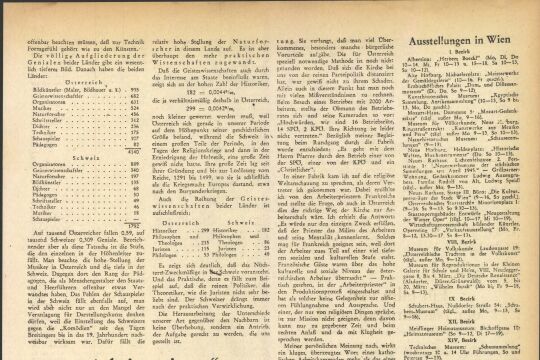Eine gewisse Kluft* zwischen Kirche und Arbeiterschaft besteht noch immer. Darüber gibt es keinen Zweifel. Geist und Aufruf des Konzils aber lassen es nicht zu, daß die Priester dieser Kluft ratlos und resignierend gegenüberstehen. Es gilt, eine Brücke zu schlagen. TJnd wer denn, wenn nicht junge Menschen, die von den Schatten der österreichischen Vergangenheit nicht persönlich belastet sind, sollen daran gehen, diese Brücke zu schlagen? So waren es auch junge Priester und Theologen, die 1966 in Österreich erstmals auf breiterer Basis einen „Betriebseinsatz“ absolvierten, der In der Publizistik des In- und Auslandes stärkste Beachtung fand.
Was bewog nun gerade diese jungen Menschen zu dem Einsatz? Wenngleich uns zur Erstellung einer Antwort nur der Bericht der „Ein-satz“-Priester und -Theologen aus der Erzdiözese Wien vorliegt, mag dieser symptomatisch sein. Sie waren zur Erkenntnis gekommen, daß es der Kirche allzu oft an der seelsorglichen Mentalität fehlt. Viele, so meinten sie, hätten sich von der Kiirche wegen deren religiöser Angst- und Gebotsverkündigung abgewandt. Aber sie wußten auch, daß die Kirche zuerst eine Aufgabe zur Erlösunigsverkündigung — und zwar vor allem auch für die Industrie-larbeiterschaft — hat. Es war und ist ihnen ferner bewußt, daß der arbeitende Mensch mit Recht in der Kirche Christi den Geist des Evangeliums und nicht Klerikalismus und Bürokratismus sucht. Christus würde sich am Telefon gewiß nie als „Pfarramt“ vorgestellt haben.
Im blauen Anzug
Diesen skeptischen Erkenntnissien standen auch positive gegenüber. Etwa jene, wonach der moderne Mensch heute auf ein Zeichen der Kirche Christi wartet. Erhält es der Arbeiter aber auch, erfaßt er dieses Zeichen so, daß er echtes Vertrauen gewinnen kann? Nun, es gab und gibt unzählige katholische Tagungen über Sozialfragen, Soziologiediskussionen und Sozialkurse — eine unentbehrliche Grundlage für katholische Aktivisten. Aber einmal abgesehen von der unleugbaren Tatsache, daß in solchen Veranstaltungen alles andere als die breite Arbeitermasse erfaßt werden konnte, sei hier dem Einwand eines der Einsatzpriester Raum gegeben: „Ich glaube nicht an die Wirksamkeit von Diskussionen, da die Vorurteile jenseits der bewußten, diskutablen Sphäre liegen“. Vertrauen muß anders gewonnen werden. Einer der Theologen faßt es so zusammen: „Die Kirche der Industriegesellschaft muß einmal die schwarze Kleidung daheim lassen, einen blauen Anzug anziehen und dann in den Großbetrieben neun Stunden arbeiten. Die Masse Wird sie eher am Arbeitsplatz als Kirche Christi erkennen als in einer Kanzlei.“
Und so gingen sie also auf einen Monat als Arbeiter in die Betriebe. Ihre seelsorglichen Ziele sind — stark vereinfacht — rasch umrissen: Sie wollten dazu beitragen, die gegenseitigen Vorurteile, die Abkapselung, die Entfremdung und das Mißtrauen zwischen Kirche und Arbeiterschaft abzubauen; sie wollten durch brüderliche Arbeit zum Bruder werden; sie wollten auf praktische Weise Einsicht in Leben und Mentalität des Arbeiters, ins Fabriksgeschehen und dessen Härten gewinnen. Sie sagten sich also: Nicht warten, bis er zu mir kommt, sondern ich gehe zuerst zu ihm — hatte doch auch Christus die Apostolats-methode gewählt.
So standen sie am ersten Einsatz-taig am Arbeitsplatz. Es war ihnen alles neu, vieles — wie sie heute freimütig gestehen — auch unbehaglich. Es kam ihnen zu Bewußtsein, wie fremd die Kirche oft der Praxis der Industriewelt gegenübersteht. Da kam dann der umgekehrte Gedanke: „Ich glaube, daß die Kirche als Gotteshaus eine für den Arbeiter fremde und unwirkliche Atmosphäre ausstrahlt, und daß die Liturgie den Arbeiter von heute nicht mehr anspricht.“
Kameradschaft der Arbeiter
Aber nach Uberwindung der ersten Befremdung kamen auch schon die ersten positiven Eindrücke: Von praktisch allen wird dabei die Kameradschaft unter den Arbeitern hervorgehoben — eine Kameradschaft, wie sie nach ihren Erfahrungen in anderen Schichten nicht in diesem Maße vorhanden ist. In diese Kameradschaft wurden in der Mehrzahl der Fälle auch die Priester und Theologen einbezogen. Nicht als „Spione“ der Kirche, vielleicht nicht einmal als Priester, sondern einfach als Arbeitskollegen. Manche Arbeiter waren aber auch erstaunt, mitunter sogar erfreut, einen Priesterstudenten neben Sich auf der Drehbank zu sehen. Im allerschlimmsten Fall machten die Arbeiter einen Bogen um die Theologen. Es war also erkennbar, daß eine ausgesprochene Kirchenferindhchkeit im großen und ganzen als abgebaut angesehen werden kann, ja mancher der „Einsatztheologen“ hatte den Eindruck, daß Vorurteile mitunter sogar eher auf Seiten des Klerus denn auf Seiten der Arbeiterschaft zu finden sind.
Am Weg über die Kameradschaft gelang es den Priesterin und Theologen recht bald, in die religiöse Situation der Arbeiterschaft Einblick zu gewinnen. Sie entdeckten dabei in weiten Kreisen eine gewisse moralische Grundhaltung (der auch die Kameradschaft zugeschrieben werden kann), sie entdeckten eine Art „anonymes Christentum“, aber sie entdeckten auch eine oft totale Entfremdung gegenüber der Kirche als der sichtbaren Gestalt dieses Christentums. Es liegt, so erkannten sie, keine Antireligiosität, sondern eine religiöse Gleichgültigkeit vor.' Für manche ist Religion eine Angelegenheit, die in die Kindheit gehört und unter Erwachsenen eigentlich wenig verloren hat. Bei ihnen, aber auch bei positiver eingestellten Arbeitern ist jedenfalls eine nahezu unfaßbare Unkenntnis in religiösen Fragen festzustellen, von den wenig ermutigenden Statistiken über die religiöse Praxis erst gar nicht zu reden.
Am eigenen Leib
Aber die Priester und Theologen hatten auch die ungemein wertvole Gelegenheit, am eigenen Leib die unmittelbar mit der Berufsausübung zusammenhängenden Nöte der Arbeiter kennenzulernen. Sie sahen, daß die wirtschaftlichen und maschinellen Vorgänge der Industrie den Menschen allzusehr vergessen haben. Sie sahen, daß der Arbeiter im Großbetrieb oft nicht Mensch sein darf, sondern nur eine Ziffer oder eine Maschine. Und sie sahen, daß der Mann am Arbeitsplatz — von der oft zitierten Mitverantwortung und Mitbestiimmung meist gänzlich ausgeschlossen — für die Betriebsleitung oft nur ein anonymes Rädchen im Getriebe ist. Sie sahen weiter, daß fast kein Kontakt zwischen den nebeneinander tätigen Menschen vorhanden ist, von denen die einen den Anzug des Angestellten, die anderen die Montur des Arbeiters anhaben. Am eigenen Beispiel begriffen sie auf einmal, warum der Arbeiter weg von der Arbeit und hin zur Freizeit drängt, in der er sein „Mensch-Sein“ auszuleben versucht. Ein paar Aussprüche von Klerikern seien hier als Beispiel genannt: „Dieses stereotype Staccato zerhämmert jeden Gedanken“, „Hatte den Eindruck, daß die Arbeit in keiner Weise den Menschen erfüllt“, „Erst in der Freizeit kann sich der Arbeiter entfalten“, „Mich durchströmte ein Glücksgefühl, wenn zur Mittagspause die Maschinen schlagartig verstummten“, „Nach dem langen Arbeitstag verlangt der Arbeiter nach einem oft übermäßigen Vergnügen“, „Man lebt sehr auf das Wochenende hin“ oder „Der Betriebsleiter geht oft durch, aber er spricht mit niemandem, außer mit dem Meister. Den Generaldirektor hat noch niemand von uns je gesehen.“ Selbst die langen Pausen ermüden die Arbeiter ebenso wie Leerläufe in der Arbeit. Mit einem Wort: Den Priestern und Theologen ging hier die Härte des Arbeiterberufes auf.
Sie haben auch schon bestimmte Vorstellungen von einer konkreten Durchführung. Zunächst meinen sie, daß es ratsam wäre, wenn jeder Priesterkandadat — eventuell im „Pastoraljahr“ — wenigstens einmal einen solchen Betriebseinsatz mitmacht. Noch wichtiger aber wäre der Einsatz für „fertige“ jüngere Priester, die in Industriegebieten wirken. Sie sollten, nach der Ansicht ihrer „betriebserfahrenen“ Vorgänger, auf einen, höchstens zwei Monate in einen Betrieb gehen — zum Unterschied von den französischen „Arbeiterpriestern“, die dies auf Dauer taten. Statt einer größeren Dauer eines Betriebseinsatzes sei es anzustreben, daß die Pfarrseelsorger öfter eine einmonatige Arbeit in verschiedenen größeren Betrieben ihres Pfarrgebietes absolvieren. Wichtig sei es dabei, daß die „Einsatzpriester“ gleichzeitig die örtlich zuständigen Pfarrseelsorger und nicht „hauptberufliche“ Betriebsseelsorger sind. Denn die Pfarre selbst sollte in ihrer Seelsorge „industriefähig“ werden, außerdem wäre dadurch der Anschein einer Doppelgängerkirche vermieden, wofür etwa bei den Arbeiterkommuni-täten in Frankreich oder in den Be-triebsseelsorgehäusem in Holland eine gewisse Gefahr besteht. Während des Einsatzes, so meinen die „Erfahrenen“ weiter, müßten die Seelsorger auch für die Arbeitskollegen Priester bleiben und nicht den Anschein erwecken, eine Berufung als Arbeiter angenommen zu haben. Auch hier ein Unterschied zu den Arbeiterpriestern in Frankreich, die — wie man heute weiß i— nicht selten die Arbeiterschaft nicht für die Kirche gewinnen konnten, sondern durch die Arbeiter der Kirche entfremdet wurden. Wichtig erscheint es den jungen Männern, die heuer auf Betriebseinsatz waren, ferner, daß der „Einsatzpriester“ eine Arbeit als Hilfsarbeiter und nicht als Angestellter annimmt. Denn er, dem es nicht um einen höheren Lohn geht, will! ja die am meisten der Kirche Entfremdeten kollegial erreichen. Der Kontakt zwischen Arbeitern und Anigestelliten aber ist — wie oben angeführt — kaum vorbanden. Dazu kommt, daß die Arbeiterschaft wenig Verständnis für eine Kirche aufbringen wird, die sich ein bürokratisches Kleid anlegt, wie es nun einmal zwangsläufig im Angestelltenmilieu vorhanden ist. Eindringlich warnen die „Erfahrenen“ davor, notwendige Arbeitseinsätze durch bloße Betriebsbesuche ersetzen zu wollen. Denn bei Betriebsbesuchen bleibe immer eine gewisse Entfremdung zwischen Priester und Arbeiter, der Einsatzpriester aber wird bald als Kollege aufgenommen. Diese konkreten Folgerungen und Vorschläge lassen sich in einem Satz zusammenfassen: „Ein (höchstens zwei) Monat sollte ein Pfarrseelsorger als Hilfsarbeiter im Großbetrieb tätig sein.“
Als Sauerteig...
Auf dieser Basis haben die Einsatzpriester aus der Erzdiözese Wien schließlich noch einige konkrete Vorschläge für ihre Diözese parat: Bei der Durchführung dieser Maßnahmen, sollte mehr überpfarrlich, nach Gebieten oder nach Dekanaten gedacht werden. Ihrer Ansicht nach braucht man in jedem Industriegebiet eine volksnahe Pfarrseelsorge und gleichzeitig — und nicht, wie bereits erwähnt, daneben — eine spezialisierte Industrieseelsorge. Jeder Theologe und jeder Priester, der einen solchen Einsatz schon mitgemacht hat, sollte ihrer Meinung nach im Dekanat zum Betriebsseelsorger ernannt werden. „Statt Schulstunden könnte er mehr Zeit finden, sich den Betrieben in diesem Dekanat zu widmen.“ Der Dekanatsbetriebsseelsorger könnte dann möglicherweise Laiengruppen der verschiedenen Betriebe im Dekanat errichten. Sie glauben: „Nach unserer Meinung beruht eine solche Betriebsgruppe auf einer mehr natürlichen Basis — mit äußerst konkreten Aufgaben! — als dies oft bei Gruppen der Katholischen Aktion der Fall sein kann. Der Einzelgänger würde im Großbetrieb kaum etwas erreichen können. Nur ein Team von christlichen Arbeitern hat noch die Chance, als Sauerteig auf den Betrieb einzuwirken.“