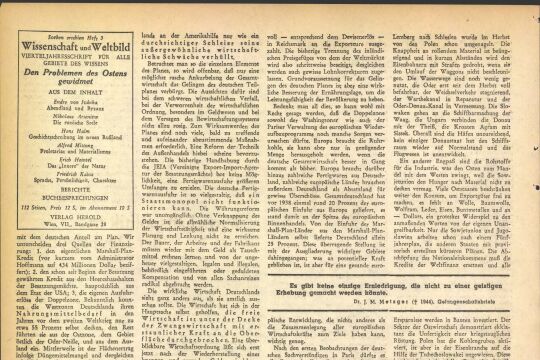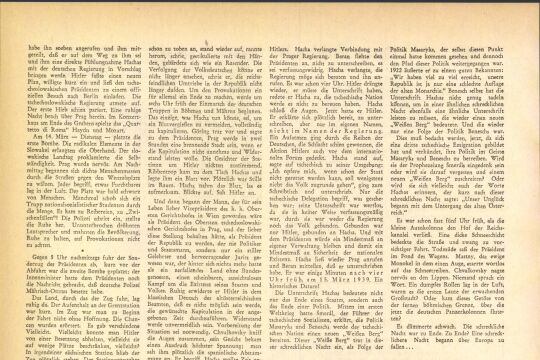EINEM BELGRADER PARTEIFUNKTIONÄR erzählte ich einmal, daß ein irgendwo im deutschen Sprachgebiet erschienenes Buch überall erhältlich sei, also etwa das Schweizer Buch auch in Österreich und in der Bundesrepublik und umgekehrt, da meinte er: „Das ist ja besser als zwischen Belgrad und Zagreb.“ Diese Antwort war gewiß überpointiert, kennzeichnet aber sehr typisch das Verhältnis der Serben und Kroaten und ihrer beiden Hauptstädte zueinander. Man kann bei jeder Gelegenheit versteckte Anspielungen zu diesem Thema hören, und bei näherem Eingehen auf die Grundsituation ist diese Einstellung leicht erklärlich. Seit nämlich die Einflußgrenze zwischen Byzanz und Rom, zwischen Ost und West quer durch das Land ging, war es noch keiner Regierung gelungen, aus dem von den heutigen Grenzen umschriebenen Gebiet eine organische Einheit entstehen zu lassen. Bis zur Gegenwart schreiben die Serben in cyrillischem Alphabet, die Kroaten und Slowenen in lateinischer Schrift. Und bis zum heutigen Tag fühlen sich die Kroaten einer alten kulturellen Tradition zugehörig, währen in ihren Augen die Serben als barbarisches Bergvolk gelten, das mit der Zivilisation eben erst Bekanntschaft macht.
So sind die beiden Städte Zagreb und Belgrad fast nur als Gegensätze zu schildern. Zagreb, mit seinem alten barocken Stadtteil, der Oberstadt, wirkt heute noch auf eine verblüffende Weise wie eine Schwesterstadt von Graz, Wien und Prag. Nicht nur im historischen Winkelwerk, sondern auch in den Bauten der Jahrhundertwende, sogar bis in die Errungenschaften der Zwanziger-und Dreißigerjahre. Man findet den Wiener Ringstraßenstil, die gußeisernen Häubchen auf den Litfaßsäulen und dieselben Straßenuhren wie in Wien. Manches, wie etwa die Gestalt der Plakatsäulen oder das gußeiserne Barock der WC-Häuschen in den Gärten, ist musealer Relikt der Donaumonarchie, in Österreich längst ersetzt, hier aber, in der schlechten Wirtschaftslage des kommunistischen Systems, geradezu liebevoll erhalten geblieben.
BELGRAD WIRKT IM ZENTRUM MODERNER, und wenn man einen Einfluß in der Architektur bemerkt, dann aus Paris und nicht aus Wien. Zwar sieht der Bahnhof aus, als wäre man in Bad Ischl, aber man kommt rasch in eine indifferent neu erbaute Stadt, zum Teil mit klotzigen Hochhäusern, denen man den eiligen Entwurf anmerkt. Noch 1916 hatte Belgrad 48.000 Einwohner — heute mehr als 700.000. Dieses dynamische Wachstum gibt der Atmosphäre der Stadt etwas von einer Goldgräberkonjunktur ohne Gold. Man findet bäuerisches Kolorit in Kleidung und Benehmen überall auf den Straßen, was verständlich ist, wenn man erfährt, daß bis vor kurzem monatlich 5000 Personen von den Bergen nach Belgrad zuzogen. Blickt man vom Kalemegdan, der „Feste Belgrad“, aufs andere Ufer der Savc und zur Donau, dann sieht man dort die Hochhäuser des neuen Belgrad, einer zweiten Stadt im Werden. Sie liegt dort merkwürdig synthetisch, unfreundlich und befremdend, eine Satellitenstadt, die später das politische und kulturelle Zentrum bilden soll — Kirche ist freilich keine eingeplant. Und vorläufig stockt es auch mit der Finanzierung. Ein alter Herr stand neben mir, als ich dort binüberblickte, und sagte plötzlich: „Ich kann mich noch erinnern, als dieses Ufer drüben die Grenze der Donaumonarchie war.“
ZAGREB, HEUTE EINE STADT mit 500.000 Einwohnern, besitzt das ichönere und größere Theater (erbaut Von den Wiener Architekten Hellmer und Fellner) als Belgra'd. Diese Stadt gehört dem Bild nach deutlich zu Mitteleuropa, mutet aber ein wenig verschlafen, ein wenig in Vergessenheit geraten, und im Vergleich zu Belgrad wie ein Stiefkind an, das dem Besucher aus Österreich freilich nähersteht. Obwohl auch ein neues Zagreb als Satellitenstadt im Entstehen ist, hat man den Eindruck, daß die Gelder viel spärlicher nach Zagreb als nach Belgrad fließen, das als Sitz der zentralen Regierung den Wert des Aushängeschilds besitzt. Auch in den Schaufenstern der Geschäfte und Kaufhäuser fällt ein Unterschied zu Belgrad auf: Man findet in Belgrad die reichere Auswahl, die besseren, mon-däneren Stücke, es gibt dort mehr oder weniger alles, was auch im Westen zu erhalten ist, allerdings zu horrenden Preisen. In Zagreb kann man offenbar mit solch zahlungsfähiger Kundschaft wie in der Nähe der Zentralregierung nicht rechnen.
In beiden Städten sieht man in den Auslagen vom eleganten Damenpelz bis zum Tonbandgerät alle vom Westen her gewohnten Produkte, und zum guten Teil auch (etwa Schreibmaschinen und andere technische Erzeugnisse) in westlichen Marken. Das Straßenbild ist nahezu ausschließlich von westlichen Autotypen bestimmt. Der Fiat 600 wird sogar in jugoslawischer Lizenz hergestellt. Man sieht überhaupt mehr Autos als anderswo jenseits der demokratischen Welt. In den großen Zeitungsständen kann man regelmäßig westliche Zeitungen kaufen, die „Times“ ebenso wie die „Neue Zürcher Zeitung“ und die „Frankfurter Allgemeine“. Jedem Jugoslawen steht es frei, sich über das Weltgeschehen aus westlichen Quellen zu orientieren. Die Belgrader Zeitungen zitieren westliche Agenturen wie eigene und die russischen. In den Buchläden findet man Übersetzungen aus westlichen Sprachen. Und erkundigt man sich nach dem Reiseverkehr, so erfährt man, daß praktisch jeder Jugoslawe auf Wunsch einen Paß fürs Ausland erhält, wenn er für Devisen selbst sorgt, und daß umgekehrt der Dinar nur auf Dollarbasis verrechnet wird: Polen, Tschechen oder Rumänen, auch Russen, können für ihre eigene Ostwährung keine Leistungen in Jugoslawien erwarten, sie müssen in Westgeld bezahlen, genauso als führen sie nach Italien oder USA.
IM ERSTEN UND AUCH IM ZWEITEN AUGENBLICK erscheint all das sehr westlich oder doch zumindest als neutral in echtem Sinn. Gräbt man aber ein bißchen unter die Oberfläche, so ergeben sich andere Realitätsbestände.
Gewisse liberale Tatsachen wie der freiere Blick nach Westen und die humanere Grundhaltung als in den unmittelbaren östlichen Satellitenstaaten sind unzweifelhaft existent und fallen positiv ins Gewicht. Einen Schritt dem Hintergrund zu findet man jedoch jene Urelemente, die dem Kommunismus genuin innewohnen. So etwa landen trotz der ausgeklügelten Auflockerung der Wirtschaft sämtliche Entscheidungen auf den Schreibtischen der zentral gesteuerten Parteiorgane. Die Gewinnbeteiligung der Arbeiter ist vollkommen dem Ermessen der Partei exponen-ten überlassen, weil der übrigbleibende Reingewinn von der jeweilig festgesetzten Steuer abhängt. Mit viel intellektuellem Scharfsinn wurde ein theoretisches System erdacht, das sich in Lehrbüchern und auch in Statistiken zu präsentieren versteht, das aber von der Wirklichkeit sehr weit abweicht. Denn die jugoslawische Wirtschaft und Politik funktionieren in der Praxis anders, als die Theorie aufweist. Nämlich als reine Parteiwirtschaft, deren eigentliche Schaltung vom Telephon def einen Funktionärs zum andern läuft. Die geradezu artifizielle Verklausulierung dieses Zustands, die kunstvolle diktatische Planung, die diesen Sachverhalt umhüllen, haben sich auf eine historisch einzigartige Weise bezahlt gemacht und tun es noch weiter. Die Geschicklichkeit am Balkan hat bei der Formulierung des wirtschaftlichen und politischen Modells, dem die Realität nicht entspricht und entsprechen kann, ein Meisterstück optischen Effekts für inklinierende und eilige westliche Besucher zustandegebracht.
AUS DER FERNE mag man Ähnlichkeit zwischen Jugoslawien und Polen vermuten — doch sie sind .eine Täuschung. Der Fels der polnischen Liberalität ist die katholische Kirche. In Jugoslawien jedoch war die Kirche während der nationalsozialistischen Ära weniger klar, sie paktierte auch mit Rom, als Grenzstreitigkeiten gegenüber Italien bestanden, es fehlt ihr also die starke, integere Position, die sie in Polen hat. Außerdem ist der Osten des Landes orthodox.
So fiel es Tito leicht, einen scharfen antiklerikalen Kurs einzuschlagen. Zwar fahren die Bischöfe ins Ausland, und dem Buchstaben nach gibt es Religionsfreiheit. In der Praxis aber arbeitet man gegen die Kirche, wo immer es möglich ist. Natürlich wurden sämtliche (!) kirchlichen Feiertage abgeschafft, sogar Weihnachten und Ostern.
Als ich in Belgrad war, gab es plötzlich kein Weißbrot. Die Bäcker und Zuckerbäcker hatten sich tags vorher „freiwillig“ vergenossenschaftlicht. Auf diese stets „freiwillige Weise“ schreitet die „Nationalisierung“ der bisher noch freien Berufe immer weiter. Das Ergebnis, das auch aus offiziellen Reden und Selbstkritiken deutlich hörbar ist, ist der augenblickliche Stand knapp vor einer wirtschaftlichen Katastrophe. Wenn die USA sich nicht doch noch entschließen, die verkündete Einstellung der Gelder an Jugoslawien wieder aufzuheben, werden unabsehbare Folgen eintreten. Einfache Arbeiter verdienen in Jugoslawien monatlich rund 600 Schilling, Ärzte 1300 Schilling, ein Universitätsprofessor 1950 Schilling. Die Relation stimmt für uns, wenn wir einen uns wenigstens angenäherten Lebensstandard annehmen. Manches, etwa einige Lebensmittel, sind vergleichsweise billiger, anderes, etwa technische Geräte, dafür oft viel teurer. Die meisten üben noch einen Nebenberuf aus, um durchzukommen, und natürlich arbeiten so gut wie alle Ehefrauen.
Außerdem: Man darf sich nicht verleiten lassen, die soziale Lage nach den Intellektuellen oder gar nach kulturellen Persönlichkeiten zu messen. Denn sie sind, genau, wie in allen kommunistischen Staaten, die bevorzugte Klasse. Von ihnen ist Unruhe zu befürchten, darum stehen sie mit oder nach dem unmittelbaren Parteikader an erster Stelle. Ein prominenter Schriftsteller holte mich vom Hotel sonntags mit seinem Chevrolet neuester Type ab, gesteuert vom ständigen Chauffeur — während ein guter Teil der Bauernbevölkerung zusammen mit dem Vieh im einzigen Raum schläft.
AUF DEM BELGRADER BAHNHOF lagern die Bauernfamilien, gekleidet in ihren Trachten. Burschen, Mädchen und alte Leute mit verschnürten Bündeln, zerrissenen Kartonschachteln entsteigen den Zügen aus der Provinz. Als ich mein Zugsabteil betrat, saß dort ein einfacher Mann. Bald erhob er sich, staubte mit einem Tuch den Plüsch des Sitzes ab, den er eingenommen hatte, und verneigte sich vor einem gedrungenen Herrn in gutem Anzug. Er war vorausgeschickt worden, einen Fensterplatz zu reservieren. Der Herr aus Belgrad entließ ihn mit einer Handbewegung und entfaltete das Abendblatt.
Die Bevölkerung, so erfuhr ich immer wieder, wurde von den herrschenden Schichten nicht gewonnen. Man setzt sich auf balkanische Art zur Wehr: Es wird so wenig wie möglich gearbeitet, man „tachiniert“. um die Kraft für den Nebenberuf zu sparen, auf den Bauplätzen und in den Büros „largiert man herum“, wie in Zagreb so elegant gesagt wird. Man riskiert nichts, will sich die Zunge nicht verbrennen, versucht so angenehm wie möglich durchzulavieren und erfindet unzählige politische Witze.
STEHT MAN AUF DER TERAZIJE, dem von lebhaftem Verkehr durchpulsten Zentrum Belgrads, so wird man leicht dazu neigen, die komplizierte Situation hinter dieser freundlichen Schauseite vergessen zu wollen.
Und auch in Zagreb, wenn man im honiggelb beleuchteten großen Kuppelsaal des Hotels „Esplanade“ zu Abend speist, wenn der Marmor und StueV der Jahrhundertwende uns nach Bad Gastein versetzt, der Pianist dazu stimmungsvoll gedämpft Wiener Walzer spielt, dann meint man für Augenblicke, es sei doch alles eigentlich so sympathisch altösterreichisch. Es gehört aber gerade zu Titos nicht überschätzbarem Raffinement, daß er die alten Kulissen mitverwendet und neue westliche Versatzstücke dazu, um mit und zwischen ihnen den Kommunismus zu verwirklichen.