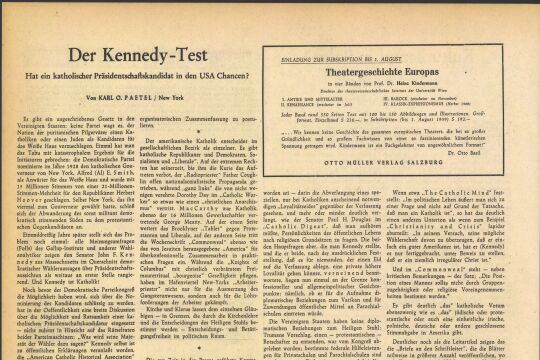Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Vom Elend der US-Demokraten
Innerhalb der Demokratischen Partei der USA steht er am linksliberalen Flügel: George McGovern, erfolgloser Gegenkandidat von Richard Nixon bei den Präsidentenwahlen 1972,18 Jahre hindurch Senator für South Dakota, ehe ihn der Rechtsruck von 1980 ebenfalls wegschwemmte. Anläßlich seines Aufenthaltes in Innsbruck sprach mit ihm Redaktionsmitglied Burkhard Bischof.
Innerhalb der Demokratischen Partei der USA steht er am linksliberalen Flügel: George McGovern, erfolgloser Gegenkandidat von Richard Nixon bei den Präsidentenwahlen 1972,18 Jahre hindurch Senator für South Dakota, ehe ihn der Rechtsruck von 1980 ebenfalls wegschwemmte. Anläßlich seines Aufenthaltes in Innsbruck sprach mit ihm Redaktionsmitglied Burkhard Bischof.
L4URCHE: Der Schock der Nie-JL derlage bei den Präsidentschaftswahlen 1980 hängt den amerikanischen Demokraten immer noch nach. Manche Kritiker sprachen gar von einer sterbenden Partei. Jedenfalls aber bietet sie — amerikaweit gesehen — ein Bild der Uneinigkeit. In welchem Zustand sehen Sie die Demokratische Partei?
GEORGE MCGOVERN: Ich glaube, daß sie in ernsthaften Schwierigkeiten steckt Teilweise darum, weil sie die letzten 35 bis 40 Jahre so sehr von Krieg und Kriegsvorbereitungen in Anspruch genommen wurde, daß sie allmählich ihr Engagement für wirtschaftliche und soziale Gerechtigkeit verloren hat. Die Demokratische Partei stand immer dann am besten da, wenn sie die Schlachten um wirtschaftliche und soziale Fragen im Land führte. Aber in den letzten Jahrzehnten standen militärische Fragen im Vordergrund, das hat den moralischen und politischen Muskel der Partei geschwächt.
Verschlimmert wurde dies* Situation durch den Krieg in Vietnam, der die Demokratische Partei beinahe umgebracht hat. Dieser Krieg hat die Partei gespalten wie keine andere Frage seit dem amerikanischen Bürgerkrieg. Und ich glaube, die Demokraten haben sich davon noch immer nicht erholt.
FURCHE: Was glauben Sie: Wie könnten die Demokraten Vorteile aus den Schwierigkeiten der derzeit regierenden Republikaner ziehen. Was müßten sie ihrer Meinung nach tun, um die Initiative wieder an sich zu reißen?
MCGOVERN: Zuerst einmal: ,Sie müßten damit aufhören, Präsident Reagans Politik und die Prioritäten, die er setzt, gutzuheißen. 1981 gaben die Demokraten Reagan alles, wofür er sie bat: sein Verteidigungs-Budget, seine Steuer-Kürzungen und seine Einschränkungen im Sozialbereich. Das war falsch! Die Demokraten können nicht dadurch gewinnen, daß sie die Strategie Reagans stützen: Sie müssen sich seiner Wirtschafts,- Steuer,- Sicher-heits- und Außenpolitik widersetzen. Reagan befindet sich in allen diesen Bereichen auf dem Holzweg
Wenn die Demokraten jedwede Begeisterung in der Öffentlichkeit für ihre Politik wecken wollen, müssen sie Alternativen zu Reagans Politik in diesen Fragen aufzeigen. Das haben sie bis jetzt nicht getan. Zu schnell geben sie sich mit kurzfristigen, opportunistischen Rezepten ab.
FURCHE: Welche Alternativen sollten die Demokraten in der Wirtschaftspolitik zu Reagans Programm aufzeigen?
MCGOVERN: Es gibt verschiedene Schritte, die gemacht werden müßten. Der erste: Die Demokraten müßten wahrnehmen, daß das ernsthafteste Problem in unserem Land derzeit die Arbeitslosigkeit ist. Es gibt zehn Millionen arbeitslose Amerikaner, eine schwere Belastung für unsere Regierung und für unsere Gesellschaft. Die dringendste Aufgabe ist es deshalb, Wege zu finden, um diese Leute wieder zu beschäftigen. Und anstatt im Energie-Bereich, im öffentlichen Verkehrsund Wohnbauwesen, im Schul-und Berufsausbildungsbereich die Mittel zu kürzen, sollten wir mehr Gelder in diese Dinge investieren.
Zum zweiten sollten Demokraten die Hochzins-Politik bekämpfen, wie sie Reagan derzeit verfolgt. Denn diese Politik fördert die Rezession.
Und drittens sollten sich die Demokraten scharf jener Politik Reagans widersetzen, mit der er versucht, die Sowjetunion wirtschaftlich in die Knie zu zwingen. Diese Politik der Sanktionen und des Pipeline-Boykotts schadet dem Westen vielmehr als den Sowjets, die ja eigentlich getroffen werden sollten.
Die Demokraten sollten Reagan in der Pipeline-Frage frontal angehen, auf denselben Kurs einschwenken wie die europäischen Staaten und versuchen, mit dem Osten engere Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zu erreichen.
FURCHE: Sie können also dem Argument nichts abgewinnen, daß ein verschärfter Kurs gegenüber Moskau in Wirtschaftsfragen die Sowjets zu Wohlverhalten in der Weltpolitik zwingt?
MCGOVERN: Ich habe die Logik nie verstanden, daß ein hungriger Sowjetbürger harmloser sein soll als ein gut ernährter. Wenn die Sowjets ihren Lebensstandard heben können, werden sie wahrscheinlich eher gemäßigter als gefährlicher. Wenn sie mehr und mehr durch Handel, durch Investitionen und durch eine Verbesserung der Beziehungen an den Westen gebunden werden, werden sie vielleicht verantwortlicher und üben Zurückhaltung in ihrem außenpolitischen Handeln.
FURCHE: Bleiben wir bei der US-Außenpolitik: Wo sollten die Demokraten ihrer Meinung nach die außenpolitischen Prioritäten anders setzen?
MCGOVERN: Ich würde gerne sehen, daß sich die Demokraten in der Antiatomkriegs-Graswurzel-Bewegung engagieren. Es gibt Millionen von Menschen in den Vereinigten Staaten, ebenso in Europa und in Japan, die glauben, daß die größte Herausforderung, der wir heute gegenüberstehen, die Rettung vor einem nuklearen Holocaust ist. Die Demokraten sollten diese Bewegung anführen, und versuchen, den Rüstungswettlauf unter Kontrolle zu bringen.
Zum zweiten wünsche ich mir, daß wir gegenüber einigen der Dritten-Welt-Länder und ihrer Probleme eine einfallsreichere Politik betreiben. Wir haben in den USA dazu tendiert, die kleinen kommunistischen Staaten zu boykottieren. Wir kommen ganz gut mit den Chinesen aus, betreiben bis zu einem gewissen Ausmaß auch mit den Sowjets Handel. Aber wir benehmen uns geradezu furchtsam gegenüber Ländern wie Angola, Kuba, Vietnam, Nordkorea, Mocambique. Da benehmen wir uns einfach kindisch und unreif.
Im Nahen Osten, der gegenwärtig das gefährlichste Feld für die Weltpolitik darstellt, brauchen wir einen unparteiischen politischen Ansatz. Wir sollten darauf bestehen — soweit wir das können —, daß die Palästinenser das Existenzrecht Israels anerkennen. Und wir sollten darauf bestehen, daß Israel das Recht der Palästinenser auf eine unabhängige Heimat anerkennt.
FURCHE: Wie sehen Sie die Krise innerhol b der atlantischen Allianz. Glauben Sie, daß die USA gegenüber ihren europäischen Verbündeten und Freunden auch alternative Positionen einnehmen sollten?
MCGOVERN: Ich glaube diese Krise innerhalb der Allianz ist völlig unnötig. Sie wurde ausgelöst durch Reagans irrationale Position in der Pipeline-Frage. Nicht nur Kanzler Helmut Schmidt und Präsident Francois Mitterrand widersetzen sich ihm in dieser Angelegenheit, auch die konservative Margaret Thatcher. Und sie sollen sich ihm auch widersetzen.
Es ist beinahe so, ob Präsident Reagan den Sowjets erlaubt hat ein Rezept zu schreiben, wie sie die atlantische Allianz zerstören können. Weil er tut unabsichtlich das, wozu die Sowjets bislang nicht imstande waren: nämlich die Allianz zu spalten!
Ich glaube auch, daß die amerikanische Regierung in der Nachrüstungsfrage zuviel Druck ausübt, auch das erzeugt Spannungen. Und dann gab es natürlich dieses leichtsinnige Gerede über atomare Warnschüsse und über einen auf Europa begrenzten Atomkrieg, was natürlich den Unmut der Europäer ausgelöst hat.
FURCHE: In der jüngsten Zeit glaubten wir Europäer erkennen zu können, daß der Isolationismus in den USA wieder im Wachsen begriffen ist___
MCGOVERN: Dem kann ich nicht zustimmen. Was stärker wurde, ist die Abneigung in immer breiteren Kreisen der amerikanischen Bevölkerung, in die internen Angelegenheiten anderer Länder zu intervenieren. Und ich begrüße diese Entwicklung. Das ist nicht Isolationismus, das ist Respekt für die Unabhängigkeit anderer Staaten.
FURCHE: Wenn wir nun auf die Präsidentenwahlen 1984 sehen: Scheint es nicht so, daß Personalitäten anstatt Sachfragen die Wahl beherrschen werden?
MCGOVERN: Was meiner Meinung nach 1984 geschehen wird, ist eine Wiederholung dessen, was 1972 passierte: daß wir möglicherweise 12 bis 15 Präsidentschaftskandidaten haben werden. Als ich 1972 kandidierte, hatte ich 15 andere demokratische Mitbewerber zu schlagen, ehe ich die Nominierung erhielt.
Demokraten kandidieren nicht gerne gegen einen sich wiederbewerbenden demokratischen Präsidenten. Erinnern Sie sich nur, daß ein einziger Carter in den Vorwahlkämpfen wirklich herausforderte, obwohl Carter in den Meinungsumfragen schon damals äußerst schlecht ausstieg. Sehr wohl aber sehen sie es als eine Herausforderung an, gegen einen rechtsgerichteten Republikaner zu kandidieren.
Es ist schwer zu sagen, wer von den 12 oder 15 Kandidaten, die sich wahrscheinlich bewerben werden, als bester aussteigen wird. Jetzt sieht es so aus, ob Edward Kennedy und Walter Mondale die besten Chancen hätten.
FURCHE: Und wie sieht es mit Ihnen selbst aus ? Werden auch sie abermals kandidieren?
MCGOVERN: Das ist nicht ausgeschlossen. Bis jetzt habe ich noch keine Entscheidung getroffen, aber ich halte mir die Möglichkeit offen. Denn es gibt eine Menge von Dingen, die ich sagen will und der amerikanische Präsidentschaftswahlkampf ist das beste Forum der Welt, auf dem man diese Dinge sagen kann.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!