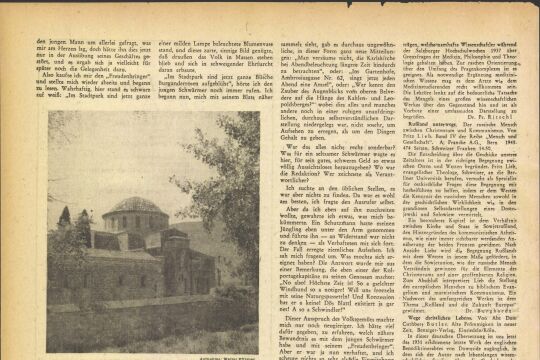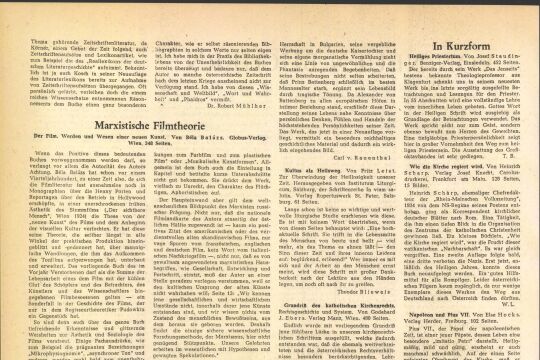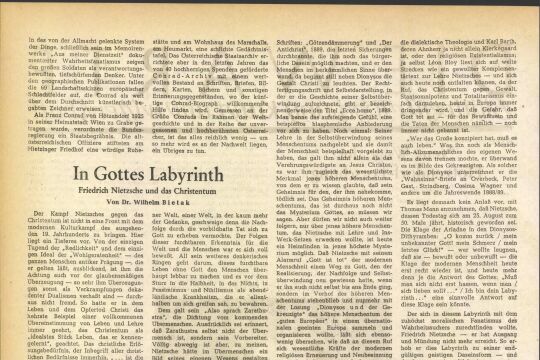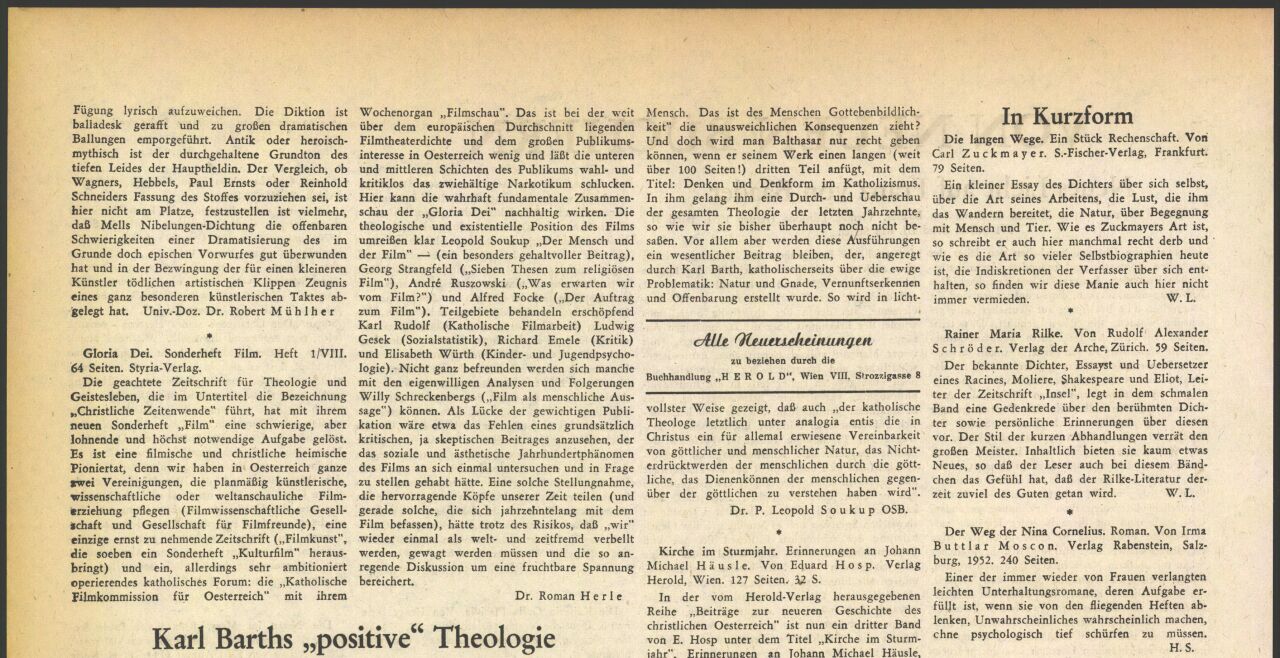
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Karl Barths „positive“ Theologie
Was einen Systematiker diskreditieren würde, daß er nämlich in der Entwicklung seiner Gedanken zu einer Position kommt, die seinem Ausgangspunkt — wenigstens sachlich — entgegensteht, braucht einen Forscher keineswegs beirren. Die unbekannte Wirklichkeit, zu deren Erforschung er ausging, hat ihm Ergebnisse gebracht, die er anfangs nicht erwartet hat. Karl Barth ist kein Systematiker im Bereich der Theologie, sondern ein Forscher. Was ihm freilich als protestantischen Theologen viel leichter gemacht ist als einem katholischen, dessen Gebundenheit an das traditionsbestimmte Denken der Kirche weniger Freiheit, wohl aber mehr Verantwortung vor den Gläubigen im theologischen Forschen bedeutet.
Im ersten Band seiner Dogmatik (1932), dem inzwischen bis 1950 sechs weitere, äußerst umfangreiche folgten, stand das Wort, die analogia entis sei „die Erfindung des Antichrist“ und wenn man von ihr absähe, finde man keinen Grund, katholisch zu werden. Inzwischen ist Barth, der gemäß seinem Wollen nichts anderes als eine „Theologie des Wortes“ (Gottes) beabsichtigte, von dieser negativen Position der Ablehnung der analogia entis (sie führe, wie der Katholizismus beweise, zu einer Hegemonie der Philosophie und der ratio vor der Offenbarung und dem „Wort Gottes“) zu der positiven Position der analogia fidei (Jesus Christus, „Gott und Mensch“, ist der „primäre Text“, von dem aus auf das Wesen aller anderen Menschen, ja mehr, der ganzen übrigen Welt geblickt werden kann. Das ist eine absolute Hegemonie des geoffenbarten Gotteswortes vor jeglichem, natürlichem, bloß philosophischem Denken). Diese „christologische Konzentration“ .— „der Mensch Jesus Christus“ — ist für Barth der Punkt geworden, um den alle seine theologischen Bemühungen kreisen.
Ueber den wesentlichen Inhalt der sieben Bände „Kirchliche Dogmatik“ gibt Balthasar eine umfangreiche Darstellung. Vor einigen Monaten äußerte sich Barth selbst in einer öffentlichen Diskussion an der Basler Universität, das Werk Balthasars sei das beste Buch über ihn, in ihm wäre er besser verstanden worden als von seinen protestantischen Kollegen. Dieses Wort ist insofern wichtig, weil diese großartige — großartig vor allem in ihrer Klarheit, Dichte und Knappheit [(gelang es doch Balthasar, viele tausend Seiten des breitausladenden Werkes auf bloß 114 Seiten zu bringen!) — Zusammenfassung einen gerade für den katholischen Theologen so anregenden, ja fruchtbaren Einblick in die oft durch ihre neuartige und keineswegs a limine abzulehnende Kon-struktivität so überraschenden Gedankengänge Karl Barths gewährt. Es kann daher nicht verwundern, wenn selbst Ebneter, der (der Züricher „Orientierung“ sicherlich sehr nahe stehend) in seiner eher strengen Kritik, in der u. a. Barth einen „nicht immer gehorsamen Hörer des Wortes“ nennt, doch zu dem Ergebnis kommt, daß Barth in seiner Anthropologie berechtigte Anliegen eines offenbarungsgemäßen Menschenbildes anmeldet. Die Grundintention (die Christozentrik des Menschenbildes) möchten wir unter der Einschränkung, die Gefahr einer Verflüchtigung der Natur in Gnade nie aus dem Auge zu verlieren, voll unterstützen. Ebenso dürfte die Wesensd :finition menschlichen Seins als „Sein in der Begegnung mit Gott und mit den Mitmenschen“ außer Diskussion stehen. Dem katholischen Theologen wird sie die ungeheure Existentialität des christlichen Menschenbildes aufzeigen können. Sie wird ihm mit einer Deutlichkeit ohnegleichen die in der Patristik selbstverständliche, aber seit dem ausgehenden Mittelalter etwas vergessene Grundwahrheit in Erinnerung rufen, daß „der Mensch nur von der Menschwerdung Gottes aus begreifbar ist“ (Ebneter). Die uralte und oft zitierte Definition „animal rationale“ wird damit aufgegeben und Barth recht gegeben, daß er dieses animal rationale, als eine der dem Mensch so wesentlichen, geschichtlichen Existenz entzogene Abstraktion, „ein Gespenst“ genannt hat. Vielleicht ließe sich zusammenfassend so formulieren: die Wende von der Ablehnung der analogia entis zu der Bejahung der analogia fidei hat die Barthsche Theologie aus einer „negativen“ zu einer „positiven“ gemacht. Freilich ist seine Denkweise noch lang nicht die der traditionell katholischen Theologie. In dieser ist die analogia entis die Voraussetzung der analogia fidei. Der Begriff der analogia entis dagegen, wie ihn Barth im Sinne seiner „Christo-logischen ' Konzentration“ meint, ist „eine Funktion dessen, was er als analogia fidei bezeichnet. Fides ist der von Gott her geschenkte, aber die ganze Geschöpflichkeit zusammenraffende Akt, in welchem die Kreatur, im Gehorsam das tuend, was sie aus sich selbst nicht tun könnte, was aber Gott zu tun ihr schenkt, sich selbst übersteigt und dabei zu ihrem wahren, in der Schöpfung selbst intendierten Sinn kommt“ (Balthasar). So konnte Barth im dritten Band der Kirchlichen Dogmatik schreiben: „Insofern ist dem so oft gefährlich gebrauchten ... Wort des Thomas von Aquino recht zu geben: gratia non tollit (non destruit) sed (praesuponit et) perficit naturam.“
Balthasar spart in seinem Werk keineswegs mit der Darlegung von Schwierigkeiten, Bedenklichkeiten und auch Unrichtigkeiten, die er in Barths Theologie festzustellen hatte. Barths Abhängigkeit von Schleiermacher wird klar herausgestellt. Vielleicht wäre noch deutlicher zu zeigen gewesen, wie sehr er auch unter dem Eindruck des heutigen Existentialismus steht. Wie wird man einem aktualistischen Personalismus entgehen, wenn man aus dem Satz Barths: „Gott ist in Beziehung; in Beziehung ist auch der von ihm geschaffene
Mensch. Das ist des Menschen Gottebenbildlichkeit“ die unausweichlichen Konsequenzen zieht? Und doch wird man Balthasar nur recht geben können, wenn er seinem Werk einen langen (weit über 100 Seiten!) dritten Teil anfügt, mit dem Titel: Denken und Denkform im Katholizismus. In ihm gelang ihm eine Durch- und Ueberschau der gesamten Theologie der letzten Jahrzehnte, so wie wir sie bisher überhaupt noch nicht besaßen. Vor allem aber werden diese Ausführungen ein wesentlicher Beitrag bleiben, der, angeregt durch Karl Barth, katholischerseits über die ewige Problematik: Natur und Gnade, Vernunftserkenrien und Offenbarung erstellt wurde. So wird in lichtvollster Weise gezeigt, daß auch „der katholische Theologe letztlich unter analogia entis die in Christus ein für allemal erwiesene Vereinbarkeit von göttlicher und menschlicher Natur, das Nicht-erdrücktwerden der menschlichen durch die göttliche, das Dienenkönnen der menschlichen gegenüber der göttlichen zu verstehen haben wird“.
Kirche im Sturmjahr. Erinnerungen an Johann Michael H ä u s 1 e. Von Eduard H o s p. Verlag Herold, Wien. 127 Seiten. 32 S.
In der vom Herold-Verlag herausgegebenen Reihe „Beiträge zur neueren Geschichte des christlichen Oesterreich“ ist nun ein dritter Band von E. Hosp unter dem Titel „Kirche im Sturmjahr“, Erinnerungen an Johann Michael Häusle, erschienen. Ein Buch, nach dem alle an der Geschichte der österreichischen Heimat Interessierten mit großem Interesse greifen werden. Der Verfasser will darin die Stellung des Theologen und Journalisten Dr. Häusle zu den Geschehnissen seiner Zeit und darüber hinaus den Anteil des kämpferischen Katholizismus an der Revolution von 1848 zeigen. Dr. Häusle, 1809 in Vorarlberg geboren, seit 1838 Hofkaplan und zweiter Studiendirektor am Frintaneum in Wien, gehörte dem Kreise um Günther-Veith-Brunner an. Wie diese Männer aus dem Hofbauer-Kreise trat auch er als mutiger Kämpfer für die Rechte und Freiheiten der Kirche ein und war bestrebt, die Errungenschaften der Revoultion, Pressefreiheit und Assoziationsrecht, für die Kirche auszunützen. Er wurde bald einer der eifrigsten Mitarbeiter und Mitkämpfer Brunners in der Wiener Kirchenzeitung. Er gehörte zu den Gründern und Mitarbeitern des am 15. Mai 1848 gegründeten Wiener Katholikenvereines, der Keimzelle einer jungkatholischen Bewegung. Dr. Häusle war auch einer der sechs katholischen Geistlichen, die am 5. Oktober 1848 in den ersten Wiener Gemeinderat gewählt wurden. Er gehörte zu jenen Gemeinderäten, die im Oktober 1848 vor der Revolution nicht davonliefen, sondern in Wien blieben und in schwerer Pflichterfüllung, wie die Permanenzprotokolle des Gemeinderates zeigen, täglich auf ihrem Posten standen und sich bemühten, einen ins Verderben führenden Radikalismus von Wien abzuhalten. Leider ist diese Seite seines öffentlichen Wirkens nur mit wenigen, den Dingen nicht immer entsprechenden und gerecht werdenden Sätzen abgetan. Gerade hier hätte es sich an dem Beispiel Häusle zeigen und quellenmäßig belegen lassen können, daß die katholischen Priester und Vertreter im Gemeinderat nicht einfach als Reaktionäre, als Feinde fortschrittlicher und demokratischer Ideen abzutun sind, wie es in den Darstellungen über die Revolution vielfach bis heute geschieht, sondern daß ein Studium der Quellen das Gegenteil der vom politischen Haß diktierten und immer wieder abgeschriebenen Meinung beweist Univ.-Doz. Dr. Rudolf Till
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!