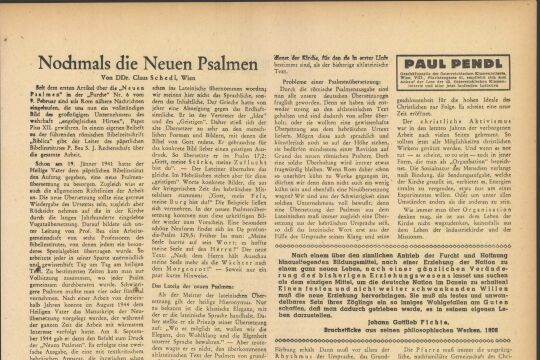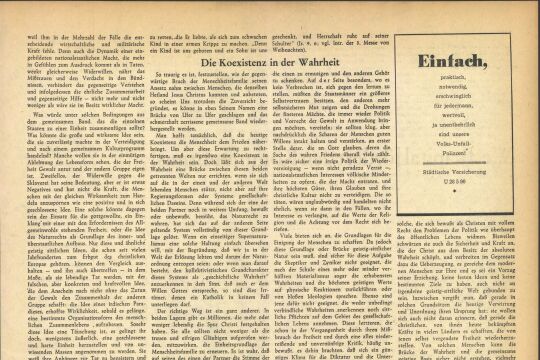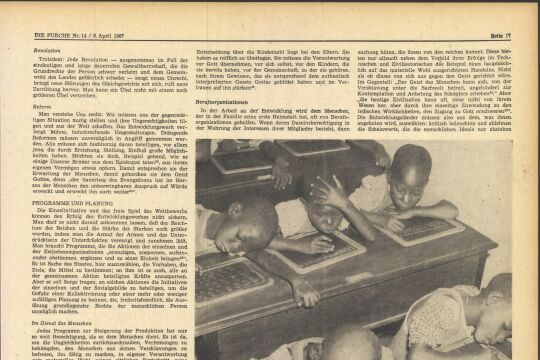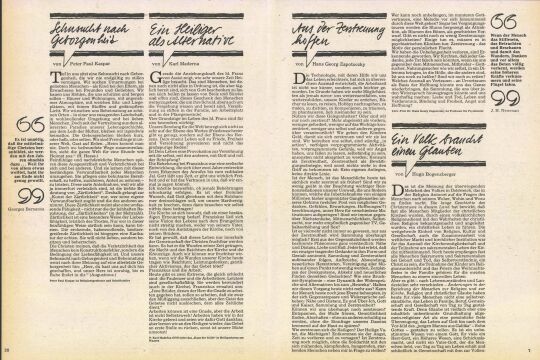Es genügt nicht, an "Europa" zu appellieren
Nächstenliebe auch zu den Fernsten gehört zum Wesen des christlichen Glaubens und ist daher ein Grundauftrag der Kirchen. Sie ist aber nicht allmächtig und kann daher nicht alle Not in der Welt beheben. Ein Beitrag zur Diskussion um die Willkommenskultur.
Nächstenliebe auch zu den Fernsten gehört zum Wesen des christlichen Glaubens und ist daher ein Grundauftrag der Kirchen. Sie ist aber nicht allmächtig und kann daher nicht alle Not in der Welt beheben. Ein Beitrag zur Diskussion um die Willkommenskultur.
Am 14. April 1992 sagte der damalige EU-Kommissionspräsident Jacques Delors in einer Rede zu den Kirchen in Brüssel folgenden Satz: "Gelingt es uns in den vor uns liegenden zehn Jahren nicht, Europa eine Seele zu geben und ihm Spiritualität und Sinn zu verleihen, gibt es für die europäische Einigung keine Chance mehr."
Die Aktualität dieser prophetischen Worte zeigt sich heute in erschreckender Weise: nicht nur am Beschluss Großbritanniens, aus der EU auszutreten, weil die Kosten-Nutzen-Rechnung nicht mehr stimmt, sondern vor allem an der unbewältigten Frage, wie mit dem Ansturm der Flüchtlinge aus den von Kriegen beinahe zerstörten Ländern des Nahen Ostens - wohin auch EU-Länder Waffen geliefert und daran verdient haben - und aus den an Hunger, Misswirtschaft und Gewalt leidenden Regionen Afrikas umzugehen sei. Sicher ist in den islamischen Ländern der "Konfessionskrieg" zwischen Sunniten und Schiiten daran maßgeblich mitschuldig, wie in Afrika die Korruptheit und Herrschsucht mancher Machthaber, mit denen aber auch europäische Mächte und Firmen gerne kooperieren, wenn es Gewinn bringt. Doch es geht hier um das Schicksal von vielen einzelnen Menschen, die in diese Zustände hineingeboren wurden und unter ihnen leiden.
Kann ein Kontinent umdenken?
In dieser Situation genügt es nicht, an "Europa" zu appellieren, dass es sich auf seine - inzwischen weitgehend vergessenen - christlichen Grundwerte besinnen möge. Denn "Europa" ist keine Person, die umdenken könnte. Es besteht vielmehr aus vielen Millionen einzelner Menschen, die sich sicher nicht alle gleichzeitig aufgrund eines solchen Aufrufs für eine gemeinsame Flüchtlingspolitik entscheiden werden. Auch die verschiedenen Nationen der - vorwiegend aus Eigeninteressen - entstandenen Europäischen Union werden von vielen Menschen mit sehr unterschiedlichen Wertvorstellungen gebildet, und ihre Regierungen haben geringe Möglichkeiten, diese zu ändern, weil sie bei mehr Engagement in diesem Bereich damit rechnen müssen, abgewählt zu werden.
Worum es hier letztlich geht, hat Ernst-Wolfgang Böckenförde in einmaliger Weise formuliert. Er sagt es zwar nur vom einzelnen säkularen, also nicht mehr auf einer Religion fundierten Staat, aber übertragen auf die EU als eine Union säkularer Staaten würde sein Axiom lauten: "Die freiheitliche, säkularisierte Europäische Union lebt von Voraussetzungen, die sie selbst nicht garantieren kann. Das ist das große Wagnis, das sie, um der Freiheit willen, eingeht."
Es ist ein mühsames Unterfangen, eine Mehrheit von Menschen in Freiheit von sozialer Moral zu überzeugen, die sich nicht bloß auf den gegenseitigen Vorteil von Personen oder Interessengruppen beschränkt, sondern sich ohne bestimmte Erwartungen von Gegenleistungen den Fremden öffnet und mit ihnen zu teilen bereit ist. Einzelne können dafür einen Anstoß geben, gelingen kann es nur durch das Wirken von Gruppen und Gemeinschaften in der Zivilgesellschaft und in den Kirchen, die ein überzeugendes Beispiel geben und anderen Mut machen, wie es etwa durch die Gemeinschaft Sant'Egidio in Rom und an vielen Orten der Welt geschieht.
Eine soziale Moral kann nicht von oben verordnet werden, sondern nur in persönlichen Beziehungen entstehen. Das beginnt mit der Beziehung des Kindes zu Mutter und Vater, mit jener zu Geschwistern, Freunden, Kameraden in der Schule, zu Nachbarn und in der Umgebung. Je nachdem, welche Erfahrungen Menschen in diesen näheren Bereichen gemacht haben, werden sie die unvermeidbar vorhandene Angst um das eigene Dasein aushalten lernen und anderen Menschen zunächst einen Vorschuss an Vertrauen geben und dann Vertrauen schenken können. Wo diese primäre Vertrauensbildung nicht gelungen ist, braucht es eine mühsame Heilung dieser Mängel durch eine menschlichere Umgebung, die nicht immer gelingt.
Positive Erfahrungen im engeren Kreis ermöglichen eine Erweiterung dieses Vertrauens auf das größere soziale Umfeld in den Gemeinden, im eigenen Land und darüber hinaus, also auch zu den Fremden. Gerade hier braucht es einen Vorschuss an Vertrauen, das wegen vieler Risiken durch Ängste bedroht ist: vor anderen Wertvorstellungen von Angehörigen fremder Kulturen, vor nicht zu bewältigenden Problemen im Zusammenleben und damit vor Überforderung. Diese Ängste lassen sich nicht aufheben, sondern nur aufwiegen und übertreffen durch einen größeren Mut, zu dem Einzelne zwar einen Anstoß geben können, der aber nur in entsprechenden Gruppen und Gemeinschaften entstehen und wirksam werden kann.
Daher lässt sich eine Offenheit gegenüber Fremden und Flüchtlingen nicht von oben verordnen, auch nicht durch Appelle von Politikern oder kirchlichen Amtsträgern erreichen, sondern sie kann nur an der Basis der Gesellschaft, in den einzelnen Gemeinden und sonstigen Gruppierungen wachsen, die dann durch ihr Beispiel überzeugen können. Auch eine Willkommenskultur gegenüber Flüchtlingen kann deshalb nicht vorgeschrieben werden, sondern erfordert eine entsprechende Gesinnung vieler und muss daher von unten aufgebaut werden.
Vertrauen und Grundvertrauen
Vertrauen zwischen Einzelnen auf gleicher Ebene setzt - bewusst oder unbewusst, anerkannt oder nicht - zumindest einen Vorschuss an Vertrauen auf einen gemeinsamen Grund voraus, der ihnen und ihren Beziehungen Sinn geben kann. Andernfalls wäre menschliches Zusammenleben nur in Form von Herrschaft über andere oder von Interessenkoalitionen möglich, nicht als Liebe zu den anderen um ihretwillen, wie sie für den Umgang mit Hilfesuchenden erforderlich ist. Dieses nötige "Grundvertrauen" könnte man auch als "Urvertrauen" bezeichnen, doch dieser Begriff wurde von der Entwicklungspsychologie für die primären Vertrauensbeziehungen von Kleinkindern vor allem zu ihren Müttern reserviert, die natürlich auch für die Entwicklung des Grundvertrauens im obigen Sinn eine fundamentale Bedeutung haben.
Ohne ein solches Grundvertrauen, oder zumindest einen auch nur unreflektierten Vorschuss davon, wäre es nicht zu verantworten, einem Kind das Leben weiterzugeben, ohne es vorher fragen zu können, ob es trotz des unvermeidbaren Leidens und Sterbens auf die Welt kommen will. Dieses Vertrauen auf den gemeinsamen Daseinsgrund sollte daher auch in den Kindern geweckt sowie in deren Umgebung gestärkt werden, um den Belastungen gewachsen zu sein. Und es ist auch eine ausschlaggebende Grundlage für eine Offenheit und Hilfsbereitschaft gegenüber Fremden, zu denen noch keine Beziehung besteht. Aber auch hier gibt es Grenzen, wenn dieses Grundvertrauen und der darauf beruhende Vorschuss an mitmenschlichem Vertrauen missbraucht werden. Denn Nächstenliebe hebt die Selbstliebe nicht auf.
Wo die Grenzen liegen, wissen wir nicht
Nächstenliebe auch zu den Fernsten gehört zum Wesen des christlichen Glaubens und ist daher ein Grundauftrag der Kirchen. Sie ist aber nicht allmächtig und kann daher nicht alle Not in der Welt beheben. Theologen sowie kirchliche Amtsträger müssten sich endlich ernsthaft der Theodizee-Frage nach der Rechtfertigung des Glaubens an einen guten Gott angesichts des Leids in der Welt stellen, das nicht einfach auf eine "Erbsünde" und weiteres moralisches Versagen der Menschen zurückgeführt werden kann. Das wird eine Korrektur der philosophisch-idealistischen Vorstellungen von einem allmächtigen Gott erfordern, der alles können soll, was wir uns denken können und wünschen. Auch der letzte, uns überlegene Grund unseres Daseins hat nur Macht über das, was real möglich ist. Wo die Grenzen liegen, wissen wir nicht.
Daher stößt auch die Praxis der Nächstenliebe an Grenzen und muss mit ihnen rechnen. Das wurde schon in der Formulierung der Allgemeinen Menschenrechte nicht beachtet. Es wäre sehr hilfreich, ebenso genau die "Allgemeinen Menschenpflichten" zu formulieren, die eingehalten werden müssten, um die Erfüllung der Menschenrechte zu ermöglichen. Der Versuch von ehemaligen Staatsmännern im Jahr 1997, an dem auch Kardinal König mitgewirkt hat, für einen noch wenig konkreten Entwurf einer entsprechenden Erklärung die Anerkennung der UNO zu erreichen, ist gescheitert.
Nur wenn in der Diskussion um Willkommenskultur gegenüber Flüchtlingen auch diese fundamentale Frage beachtet wird, kann es zu einem Einvernehmen kommen.
Der Autor ist Pastoraltheologe in Innsbruck
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!