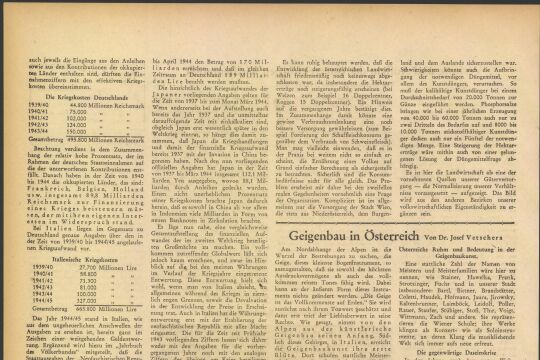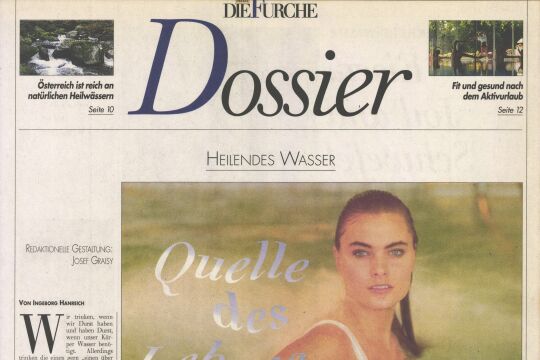Nahrungsmittelkonzerne haben freie Hand, uns täglich neue Lebensmittel vorzusetzen. Kaum ein Konsument vermag zu beurteilen, was in den Packungen wirklich enthalten ist.
Was wir wirklich essen – das entscheiden wir nicht mehr selbst, sondern die Nahrungsmittelindustrie und ihre angegliederten Entwicklungsabteilungen. Sie haben uns die Entscheidung abgenommen. Mit dem Essen schlägt sich auch die Politik auf den Magen, mit Grenzwerten, Höchstwerten, Schwellenwerten, Mindestangaben. So sehr wir uns bemühen, etwas über die Zusammensetzung unserer Lebensmittel zu wissen, so schwierig ist es, die Kennzeichnungen mit den gesetzlich vorgeschriebenen Angaben zu verstehen. Lobbyisten bestimmen, was auf unseren Teller kommt.
Eigentlich sollte der Kunde König sein, beim Essen wird er zum Narren gehalten, oft auch auf Kosten der Gesundheit, weil wichtige Informationen vorenthalten werden. Stark verdünnte Informationen in winziger Schrift auf der Verpackung spotten ob ihrer verschlüsselten Bezeichnungen jeder Beschreibung, entziehen sich der Verständlichkeit.
Normwerte, Mindestwerte Signalwerte, Ober- und Untergrenzen bieten geradezu paradiesische Zustände für unerwünschten Küchendunst über den Kennzeichnungen der Lebensmittel. Der Verbraucher ist darin verloren, die Lebensmittelindustrie kann sich bedienen. E-Nummern, vorschriftsmäßig auf den Verpackungen angegeben, sind für normale Verbraucher Kennzeichnungs-chinesisch, für den Ernährungs-Fanatiker unabdingbares Basiswissen, das den Griff in das Regal steuert. So wird es immer komplizierter und zeitaufwendiger, seine Mahlzeit zu planen.
Das E- steht für Europa
Gegenwärtig sind in der Europäischen Union exakt 315 E-Nummern gelistet. Hinter diesen verbergen sich Lebensmittelzusatzstoffe. Damit kann verdickt, verdünnt, gesäuert, gefärbt, aromatisiert oder die Haltbarkeit verlängert werden. Die Ziffern stehen für EU-einheitliche Stoffe wie E 100 für den Gelbwurzelfarbstoff Kurkumin oder E 1520 für das Lösemittel Propylenglykol. Substanzen, die allesamt zwar nicht giftig und gesundheitsschädlich, aber dennoch umstritten sind. Hoch dosiert und bei empfindlichen Essern stehen einige im Verdacht, Durchfall zu verursachen oder Allergien auszulösen. Rund 50 dieser synthetischen Substanzen werden von Verbraucherzentralen als problematisch bis gefährlich eingestuft, von einigen wird generell abgeraten, wie etwa von Amaranth (E 123), das verwendet wird, um Spirituosen zu röten.
Immerhin sind Zusatzstoffe noch angegeben. Geht es um den Geschmack, sind nicht nur Konsumenten, sondern auch manche Kenner der Materie mit ihrem Küchenlatein am Ende, ausgeliefert dem Wohlwollen der Hersteller. Rund 2700 verschiedene Aromastoffe dürfen ohne Quellenangabe verwendet werden. Und damit es appetitlicher klingt, wird manchmal das Wort „Aroma“ mit „natürlich“ verfeinert. Ein spitzfindiger Zusatz, denn alle dieser Aromastoffe kommen aus dem Labor. Entweder sie stammen aus Naturprodukten oder aus Kopien des natürlichen Geschmacks direkt aus der Eprouvette.
Aber das ist noch nicht alles, was auf den Bezeichnungen fehlt, denn einige der bei der Herstellung verwendeten technischen Hilfsstoffe, etwa Enzyme, bleiben unbenannt. Selbst wenn sie ihren Teil an Verfahren und Prozessen, etwa Gärung, erledigt haben, können Reste davon im Lebensmittel zurückbleiben. Doch wer weiß das schon. Genau dies wäre aber nötig, denn manche der Zusatzstoffe und Beigaben gehen dem Stoffwechsel des Menschen ans Eingemachte.
Alles, was nicht verboten ist, ist erlaubt
Nehmen wir Acrylamid, eine farblose, leicht flüchtige, gut in Wasser und Alkohol lösliche Substanz, die seit circa 50 Jahren bekannt ist und industriell genutzt wird, zum Beispiel zur Aufbereitung von Trinkwasser (sogenanntes Flockungsmittel).
Im April 2002 wurde Acrylamid von schwedischen Wissenschaftern in Lebensmitteln gefunden – und keiner wusste, wie es dort hineinkam. Es entsteht in Lebensmitteln, die Kohlenhydrate und einen bestimmten Eiweißbaustein enthalten, die bei der Zubereitung über 120°C erhitzt werden und wenig Wasser enthalten. Diese Bedingungen werden beim Frittieren, Backen und Braten von Kartoffel- und Getreideprodukten, die von Natur aus viel Stärke und Asparagin enthalten, erreicht. Besonders betroffen sind Pommes frites, Rösti, Bratkartoffeln und Kartoffelchips. Je stärker gebräunt die Erzeugnisse, desto mehr Acrylamid enthalten sie.
Was diese flüchtige farblose Substanz auslöst, ist beachtlich: Sie reizt Haut und Augen, ist in hoher Dosis nervenschädigend und sie verwandelt sich im menschlichen Körper in Glycidamid, das in Tierversuchen Erbgut schädigt und Krebs erregt.Wie groß die von Acrylamid ausgehende Gefahr ist, darüber besteht wissenschaftlich noch keine endgültige Gewissheit.
Werden sehr große Mengen Kartoffelchips, Pommes frites, Kaffee, Bratkartoffeln oder Knäckebrot verschlungen, füllt sich der Durchschnittsverbraucher vier Mikrogramm Acrylamid pro Kilogramm Körpergewicht ein. Eines wäre normal.
Meine Suppe ess’ ich nicht
Struwwelpeter zählt vielleicht zu den ersten Suppenverweigerern. Man ist heute geneigt, ihm recht zu geben. Suppen sind Hightech-Produkte der Lebensmittelindustrie und haben mit den Versprechungen auf der Packung – natur pur oder 100 Prozent natürliche Zutaten – wenig bis gar nichts zu tun. Wie gefinkelt vermarktet wird, zeigt der Hinweis, das Süppchen enthalte keine Geschmacksverstärker. Es mutet nach Erbsenzählerei, wenn Hefeextrakt – es besteht aus den geschmacksverstärkenden Substanzen Glutamat, Inosinat und Guanylat – nicht angegeben werden muss, weil es keine Vorschrift gibt und es sich somit um eine Zutat und nicht um einen Zusatzstoff handelt.
Ein anderes Beispiel? Erdbeeren verlieren bei der industriellen Verarbeitung das Aroma. Abhängig von der Beschriftung, müssen Fruchtstücke von einer halben Erdbeere und weniger enthalten sein. Dass sich damit kein Geschmackserlebnis erzeugen lässt, ist anzunehmen. Hersteller helfen mit Ersatzstoffen aus dem Labor nach. Geschmacksverstärker, Konservierungs- und Verdickungsmittel werden eingerührt, Farbstoffe bereiten die Beere für die Käufer auf.
Alles, was nicht verboten ist, ist erlaubt. Es gibt Verbesserungsbedarf in der Lebensmittelbeschriftung. Ob es reicht, zu wissen, aus welchem Erdteil der Apfel kommt, ist eher altmodischer Geografieunterricht. Welchen chemischen Torturen das nahrhafte Stück ausgesetzt worden ist oder wann es geerntet, in welchem Gas es gelagert wurde, darüber wird geschwiegen. Wenn der „Käse“ jetzt in der Diskussion wieder einmal aufgequollen ist, dann betrifft es nicht allein die 18.000 österreichischen Kühe, deren Milch nicht mehr gebraucht wird. „Käse“ ist ein geschützter Begriff und beschreibt ein Produkt, von dem zu Recht erwartet werden kann, dass drinnen ist, was draufsteht. Wenn aber die Beschreibungen semantisches Wissen voraussetzen, ist fast jeder Konsument überfordert und meist nicht in der Lage zu unterscheiden, was recht und billig ist. Billig ist es in jedem Fall für den Hersteller.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!