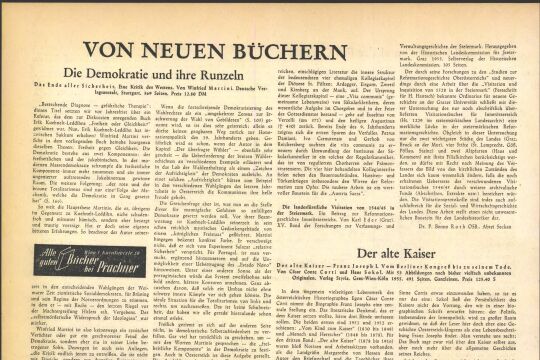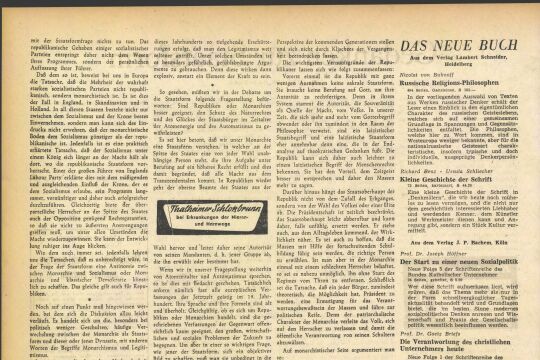Bestechende Diagnose, fragwürdige Therapie
Freiheit oder Gleichheit? Die Schicksalsfrage des Abendlandes. Von Erik R. v. Kuehnelt-Leddihn. Otto-Müller-Verlag, Salzburg 1953. 626 Seiten. Preis 98 S
Freiheit oder Gleichheit? Die Schicksalsfrage des Abendlandes. Von Erik R. v. Kuehnelt-Leddihn. Otto-Müller-Verlag, Salzburg 1953. 626 Seiten. Preis 98 S
■ Große politische Bücher sind selten geworden auf dem österreichischen Büchermarkt. Wenn uns der Oisto-Müller-Verlag kurz vor Weihnachten ein solches beschert — denn, um ein eminent politisches Buch, freilich im höheren Sinn, handelt es sich- ohne Zweifel bei der vorliegenden Sammlung geistespolitischer Essays —, so verdient dieses erhöhte Aufmerksamkeit. Nicht zuletzt wegen der Person des Autors. Erik v. Kuehnelt-Leddihn, dessen Romane, theoretische Bücher und Aufsätze in elf Sprachen und. vierzehn Ländern erschienen sind, bedarf wohl in seiner Heimat und bei den Lesern der .Furche“, die ihm wertvolle Beiträge verdankt, keiner besonderen Vorstellung. Von seinen letzten Arbeiten sei nur an die in unserem Blatt im Auszug wiedergegebene Studie „Links- und Reaktionärkatholik“ (Frankfurter Hefte, Jänner 1953) erinnert, deren ungewöhnliche, treffsichere und mutige Formulierungen den Wunsch nach einem größeren Werk des gleichen Verfassers erweckten. .
Nun liegt ein solches vor. Noch dazu kein beliebiges. Wir glauben nicht fehlzugehen in der Annahme, daß Erik Kuehnelt-Leddihn in ..Freiheit oder Gleichheit?“ nicht nur um „die Schicksalsfrage des Abendlandes“ — wie sie sich ihm stellt — bemüht ist, sondern auch selbst Antwort auf zentrale Fragen, um die seine Gedanken in anderen historischen und literarischen Werken kreisen, sucht. Damit gewinnt das vorliegende Buch den Rang eines geistigen und politischen Kredos.
Kuehnelt-Leddihn verbirgt seine politischen Glaubenssätze nicht hinter wohlgedrechselten Worten. Jedem, der es wissen will, stellt er sich bereits im Vorwort als Katholik, Liberaler und — A n t i d e m'o k rat vor. . Drei Worte, in denen •11cm Anschein nach beinahe ebensoviele Widersprüche enthalten sind! Katholik: der Begriff ist am klarsten, er braucht keine Erklärung. Katholik und Liberaler: diese Gleichung muß vor allem bei jenen, in den Ideen und Praktiken des 19. Jahrhunderts Erfahrenen, Widerspruch erregen. Jedoch — der Kritiker hält mit dem Verfasser diesen Schritt. Er teilt dessen Meinung, daß um die Mitte des 20. Jahrhunderts, bei klarer Scheidung von der „liberalen Sekte“ (wie Kuehnelt die bei Man-chestertum und Kulturkampf verharrenden Partei-liberalen treffend nennt), wahrscheinlich die dem • - Stunde aufgeschlossenen Katholiken die besten Hin • der menschlichen Freiheit sind. In einer Zeit in der der österreichische Katholizis-.ißte Manifestation seit Jahrzehnten bewufit unter die Devise „Freiheit und Würde des Menscht V stellte, erscheint es denkbar, daß jlik, trotz der zu erwartenden Mißverständnisse aus der historischen Belastung des Wortes, als ..Liberaler“, nämlich als beredter Anwalt der Freiheit im weltlichen und kirchlichen Raum vorstellt. Kann man aber allen Ernstes als Ritter der Freiheit ausziehen und gleichzeitig „Antidemokrat“ sein?
. Nach Kuehnelt kann man es nicht nur, man muß es sogar, wenn man es wirklich ehrlich mit der Freiheit meint. Der Aufdeckung dieses — nach Kuehnelt — logischen Gedankenganges dienen die vorliegenden 626 Seiten, Literatur aus 17 Sprachen wird bemüht, über 2000 Buch- und Zeitschriftentitel füllen die Fußnoten. Ob Kuehnelt die großen Geister des letzten Jahrhunderts um ihre Zeugenschaft bittet, ob er Demokratie und Monarchie gegeneinander abwägt, den „politischen Neigungen der katholischen Völker“ eine Spezialuntersuchung widmet, eine' Studie über „Hus. Luther und der Nationalsozialismus“ schreibt oder sich um einen geistigen Ahnenpaß der NS-Ideologie bemüht: überall finden wir nicht nur journalistische Meisterschaft sowie Lust und Liebe zu überraschenden, ja mitunter schockierenden Pointen, immer wieder kehrt auch die These: Freiheit und Gleichheit, freiheitliches Denken und politische Demokratie sind nicht Begriffe, die man in einem Atemzug nennen darf, sondern zutiefst Gegensätze. Unsere westliche parlamentarische Demokratie ist nicht ein erstrebenswertes Ziel, sondern ein Zwischenstadium, sie trägt ihren Todeskeim in sich. Aus der Beobachtung der Geschichte, aus den Erfahrungen eines nach 1900 geborenen Mitteleuropäers, glaubt Kuehnelt folgende „recht unheimliche Tatsache“ beobachten zu können: „die Mon-Archie, die Einherrschaft, kommt ganz bestimmt wieder zurück. So treiben wir der Einherrschaft zu auf breitem Strome, auf dem das Schifflein unseres Schicksals dahingleitet. Hier liegt gleichsam ein logisches, erfahrungsbegründetes Fatum vor ... Ob wir aber nun tatsächlich auf diesem Strom zu einer christlichen Monarchie, wie sie uns in rohen Umrissen vorschwebt, gelangen werden, das hängt von der Steuerung des Fahrzeuges ab. Kein Zweifel sollte darüber herrschen, daß am Ende der Fahrt die Einherrschaft steht. Die Frage aber bleibt offen, ob dies die Herrschaft des Zepters oder die Herrschaft des Knüppels, des Skytalismos, sein wird, die christliche Monarchie oder die heidnische Monokratie“.
Der Kritiker ist für diesen kühnen Satz dankbar. Er zeigt allen Lesern, was er selbst schon immer wußte und durch die Lektüre des vorliegenden Buches nur bestätigt fand: Kuehnelt verabscheut die modernen Diktaturen. Nicht umsonst ist er den Weg in die Emigration gegangen. Es wird schwerfallen, ihn wegen seines „antidemokratischen“ Bekenntnisses als braunen, grünen oder schwarzen „Faschisten“ zu bezeichnen. Sein Fall liegt komplizierter.
Auch der Blick auf die Alternative, die Kuehnelt uns an Stelle der Demokratie anbietet, geht in den Nebel. Zwar kennt der Verfasser sehr wohl die „sittliche Verpflichtung, ein Werk der Zerstörung zumindest mit einem Hinweis auf einen Aufbau zu beschließen“. Allein, nach einer auf 407 Seiten durchgeführten Demontage sind nur 15 Seiten der flüchtigen Skizze des Aufbaues reserviert. Ein ungleiches Verhältnis. Wie schaut der stolze Bau aus, den wir nach dem Verlassen des nicht gerade prächtigen, aber immerhin im Vergleich zu den Bunkern und Schützenlöchern, aus denen wir kommen, durchaus wohnlichen und ausgestaltungsfähigen Hauses der Demokratie beziehen sollen? Der „königliche Freistaat“ der Kuehnelt-schen Utopie kennt keine Parteien [„das Parteiensystem wegen seiner totalitären Gefahr muß abgeschafft“ werden... (p. 412). „Für Weltanschauungsparteien ist in unserem Idealstaat natürlich weder Platz noch Rahmen, doch können sich ideologische Vereine bilden“ (p. 413)], ein „Ständeparlament“ wird frei gewählt (wie und von wem?), für die sehr einflußreiche Bürokratie gibt es ein Sonderstatut. Ein „Staatschef, am besten ein Monarch“, steht an der Spitze als „Schiedsrichter und Mittler zwischen Volk und Experren“. Dazu kommt noch ein Oberster Gerichtshof, in den Mitglieder zu entsenden „die Kirchen und Universitäten“ eingeladen sind. Die sogenannten „bürgerlichen Freiheiten“ (Presse, Versammlung, Verein) bleiben, wie bei einem so leidenschaftlichen Anwalt der Freiheit nicht anders zu erwarten ist, selbstverständlich gewahrt.
Selbstverständlich? Ganz so selbstverständlich erscheint uns dies nicht, würde erst einmal Kuehnelts „Idealstaat“ auf unserem Planeten aufgerichtet. Wenn der Verfasser an anderer Stelle schreibt, genau genommen sei die Demokratie nur „bei einer erbsündelosen, perfekten Bevölkerung“ ernstlich in Betracht zu ziehen, so können wir Kuehnelts Utopia nur dann eine schöne Zukunft versprechen, wenn es allein, von engelsgleichen Geschöpfen bewohnt wird . .. Der Verfasser liebt es, den Kapiteln seines
Buches Zitate aus der Weltliteratur an die Spitze zu stellen. Wenn wir das von ihm so sehr geübte Recht scharfer Formulierungen einmal für die Kritik in Anspruch nehmen, dann sei es erlaubt, als Motto für das ganze Buch das alte •„Faust“-Zitat: ' „Grau, teurer Freund, ist alle Theorie und grün des Lebens gold'ner Baum“ in Vorschlag zu bringen. Kuehnelts Formeln und Gleichungen sind eindringlich, sind bestechend, sind erregend. In der Theorie gehen sie einwandfrei auf. Allein wir fürchten, daß im praktischen Experiment nach einer Zertrümmerung oder Selbstaufgabe der Demokratie stJtt des erwünschten Homunkulus einer auch von Kuehnelt nur sehr schemenhaft skizzierten „Ständemonarchie“ der Golem einer neuen Abart von Diktatur aus der Retorte steigen rendes Parteikönigtum, wie es das Regime Carol in Rumänien und die persönliche Herrschaft Alexanders in Jugoslawien war, gefällig? Undenkbar, daß dies in der Absicht des Autors liegt.
Zur Klarstellung: Die Frage „Monarchie oder Republik“ ist bewußt aus dieser Auseinandersetzung herausgehalten. Wir wissen aber, daß gerade ernste Fürsprecher der monarchischen Staats form in unserem Land in ihr die Versöhnung von „väterlicher“ und „brüderlicher“ Gewalt und damit nicht zuletzt den sichersten Garanten einer demokratischen Regierungs form erblicken.
Der Weg aber, den der Verfasser in bester Absicht weist, kann bei der gegenwärtigen geistigen, politischen und soziologischen Situation nicht ins Freie führen, sondern bestenfalls nach großen Wirren und Bruderkämpfen von einer siegreichen Partei erzwungen werden. Die „große Furcht“, vorder Guglielmo Ferrero — dessen Autorität Kuehnelt durch mehrfache Zitierungen anerkennt — in beredten Worten warnt, würde neuerdings ihr Haupt erheben.
Was bleibt zu tun? Wohl kaum etwas anderes, als sich unter das eben von Ferrero klar und nüchtern herausgearbeitete verbindliche „Legitimitätsprinzip“ unserer Tage zu stellen:' „die Machtübertragung durch das Volk“ (Ferrero: „Macht“, p. 445 ff.).
Dabei sind uns die Schwächen und die Anfälligkeiten der Demokratie nur zu gut bekannt. Allein, seit dem Zurückfluten der großen totalitären Woge bemüht man sich — nicht zuletzt auch in unserem Land — einer politischen Lebensform, die durch die Leitbilder „Parlament“, „Regierung und Opposition“, „freie Wahlen“ usw. bestimmt ist, in den Herzen und Gehirnen der Menschen einen festen Platz zu verschaffen. Mit mehr Erfolg, als .es der Verfasser, dessen Optik noch zu sehr auf die Verhältnisse der ersten Republik eingestellt ist, zugibt. Langsam gewinnen die Menschen und vor allem die Jugend wieder festen Boden unter ihren Füßen. Ob es in einer solchen Situation, die noch dazu durch eine massive Drohung von außen bestimmt ist, zu einem guten Ende führen kann, wenn man geistige Verwirrung in die Scharen der Verteidiger unserer politischen Lebensform trägt, wenn man vor allem die Katholiken kopfscheu macht und sie zu einer Haltung ermuntert, die sie in den Augen ihrer Bundesgenossen von heute — Gegner von gestern und morgen —■ als unsichere Kantonisten erscheinen läßt, darf ernstlich bezweifelt werden.
Wie anders klingt da der Rat, den Robert Ingrim gibt und an den wir uns halten wollen. Ingnm, dessen großer Wurf „Von Talleyrand ?u Molotow“ genau so wie Kuehnelts Werk zuerst in englischer Sprache erschien und in gleicher Weis die Ameikaner vor Simplifizierungen auf dem alten Kontinent warnte, meint: „Echte Demokraten sollen der Demokratie ergeben sein, trotz deren Schwächen, und sie nicht leugnen, genau so wie Menschen ihre Mutter lieben, trotz ihren Runzeln. Wenn wir die Demokratie vergöttern, muß sie uns enttäuschen.“
Das ist ein gutes, ein befreiendes Wort. Niemals werden Katholiken die Demokratie vergöttern — aber auch verketzern sollte sie keiner. Die Leute, denen damit eine besondere Freude bereitet wird, gefallen dem Verfasser genau so wenig wie dem Kritiker.