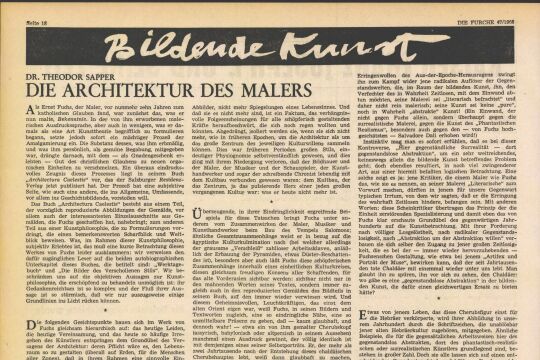Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Leibniz und die Einheit des Abendlandes
Das 18. Jahrhundert hat weithin in Leibniz seinen geistigen Wegbereiter gesehen. Gleichwohl unterliegt es keinem Zweifel, daß es ihn im tiefsten nicht verstanden hat. Wenn der Denker, dessen Lebensarbeit zu einem beträchtlichen Teil in der Popularisierung Leibnizischen Ideengutes bestanden hat, den Namen Leibniz-Wolffische ' Philosophie zur Kennzeichnung seines Systems fast leidenschaftlich abgelehnt hat, so bekundet sich in diesem Protest mehr als nur ohnmächtiges Aufbegehren gegen das Schicksal, ständig im Schatten eines Größeren leben und nur im Strahlenglanz erborgten Lichtes dereinst in die Geschidite eingehen zu sollen. In Wahrheit repräsentiert Christian Wolff, im Guten wie im Bösen, den Geist jener Epoche, in der zum ersten Male in der Geschichte des Abendlandes der Säkularismus zum Durchbruch gelangt und, ohne entscheidenden Widerstand zu finden, sich aller Lebengebiete bemächtigt. Leibniz aber steht an der Wende zweier Zeiten.
Die Gefahren, die aus solcher geistesgeschichtlichen Grenzsituation zwangsläufig erwachsen, haben auch ihn umwittert; indessen erlegen ist er ihnen nicht. Ein bloßer Polyhistor wäre von den anstürmenden, auf- und niedergehenden Wogen des Alten und des Neuen umso sicherer verschlungen worden, je mehr er kraft des Reichtums seines umspannenden Geistes befähigt, ja geradezu prädestiniert gewesen wäre, sich der Vielfalt einander begegnender und widerstreitender Ideen zu ersdiließen. In Leibniz hingegen lebt die Gewißheit seiner Sendung: wie er mit prophetischem Blick hinter dem geistigen Ringen seiner Zeit die beginnende Selbstauflösung des christlichen Abendlandes sich abzeichnen sieht, so weiß er sich zu dem priesterlichen Dienst berufen, Brücken au schlagen, über die hinweg jene Lebenskräfte in das der Aussaat harrende Neuland Eingang zu finden vermöchten, die einstens eine im Glauben gegründete Welt hatten erstehen lassen.
Die damit bereits knapp umrissene Deutung von Leibniz' geistiger Gestalt kann freilich nur dann dem Vorwurf einer schier blasphemischen Fehlinterpretation erfolgreich begegnen, wenn es gelingt, die schlechterdings entscheidende Rolle überzeugend aufzuweisen, die das Religiöse in seinem Denken und Leben gespielt hat. Wir beginnen mit dem Versuch, die treibenden Motive seines politischen Wirkens zu analysieren. Der Blick des oberflächlichen Beobachters wird freilidi hier zunächst kaum etwas anderes als eine den Forderungen fürstlicher Auftraggeber willig dienstbare, gewandte Vielgeschäftigkeit zu gewahren imstande sein. Allein wer die Mühe nicht scheut, die sich mannigfach überkreuzenden Fäden jenes in Wahrheit kunstvollen Gespinstes zu entwirren, der erkennt, wie Leibniz jede sich ihm, und sei es auch nur von ferne bietende Möglichkeit ergreift, die auf der Idee des christlichen Abendlandes gegründete Ordnung Europas vor Angriffen von außen her zu sichern, sie maditpolitisch zu festigen und gedanklich neu zu untermauern. — Nodi einmal — zum letzten Male — bedroht von Südosten her der Erbfeind der Christenheit das Herz Eurooas; so wird Leibniz zum Rufer im Streit gegen den Türken. Die Katastrophe des Dreißigjährigen Krieges hat die Macht Frankreichs erstarken lassen; im Herrscher dieses Landes glaubt Leibniz geraume Zeit den gefunden zu haben, der von der Vorsehung dazu erkoren ist, den zerrissenen Kontinent zu neuer Einheit zu führen. Als ihm das Trügerische solchen Hoffens zur Gewißheit geworden ist, da ergießt sich die ganze tiefe Bitternis seines von Enttäuschung wunden Herzens in den in gerechtem Zorn auflodernden „Mars diristianissimus“. Nein, es sind nicht die sdirillen Dissonanzen eines entfesselten Nationalismus, die hier aufklingen, sondern die erhabenen Töne echter Vaterlandsliebe;ein Bekenntnis unauflösbarer Verbundenheit mit dem eigenen Volk, das sich, aus dem Geist des Christentums, mit jener weltbürgerlichen Gesinnung harmonisch vereint, wie sie au Leibniz' Wort zu uns spricht: „daß man den Erdball betrachten müsse als das gemeinsame Vaterland des Menschen-geschledits“.
Weit entfernt davon, seit dem Fehlschlagen seiner Hoffnungen auf Ludwig XIV. resigniert die Hände in den Schoß zu legen, hat Leibniz in der folgenden Zeit nur umso eifriger nach dem ersehnten Einer Ausschau gehalten, mit einer Unbeirrbarkeit, die ihren letzten Erklärungsgrund nur darin zu finden vermag, daß in ihm die mittelalterliche Kaiseridee des gottgesandten Schutzherrn und Retters der Christenheit noch un-ersdiüttert lebendig war. Ist es da verwunderlich, daß es ihn wieder und wieder in die Residenz der Kaiser des heiligen Reiches zog? Nicht weniger als fünfmal hat er in den Mauern Wiens geweilt, mehrfach zu langem, zuletzt zu vielmonatigem Aufenthalt, ist hier heimisch geworden, ohne freilich, wie es sein Wunsdi war, für immer Wurzel schlagen zu können. Und hier schenkt ein gütiges Gesdiick dem sonst so Einsamen die Begegnung mit dem Prinzen Eugen von Savoyen: der Held und der Künder des christlichen Abendlandes reichen sich die Hand zum Freundschaftsbund.
Der geistigen Verbindung beider Heroen verdanken wir auch die letzte knappe Gesamtdarstellung des Leibnizischen Systems, die Monadologie. Als abschließende und damit für uns endgültige Formgebung seiner Gedankenwelt darf sie in erster Linie den Ansprudi darauf erheben, dem Versuch einer Deutung derselben, zugrunde gelegt zu werden, den es nun zu unternehmen gilt. Denn eines ist klar und steht unbestritten fest: soll das Verständnis der geistigen Gestalt Leibniz' als Manifestation religiöser Seelenhaltung die Feuerprobe der Kritik bestehen, dann muß es sich zuvörderst aus dem Sinngehalt seiner Philosophie rechtfertigen. Nun ist für die Erhebung des letzteren mit der Charakterisierung des Monadismus als Individualismus ersichtlich noch wenig gewonnen. Gewiß besteht für unseren Denker im Unterschied zum Pantheismus die Welt aus einer unendlichen Zahl individueller Wesenheiten von metaphysischer Dignität, eben den Monaden; aber erst dadurch, daß Leibniz zwei bedeutsame Aussagen über sie macht, eröffnet sich die Möglichkeit, die Wurzel zu finden, aus der diese Konzeption erwachsen konnte. Einmal nämlich sind die Monaden so völlig von einander geschieden, daß eine wechselseitige Einwirkung zwischen ihnen nicht statthaben kann; zum anderen aber sind sie doch dadurch miteinander verbunden und unter sich eins, daß ihnen allen die — ungeachtet der hier obwaltenden graduellen Verschiedenheiten — gleiche Wesensfunktion eignet: die Welt und Gott vorzustellen.
Damit sind aber alle Versuche, den Monadismus als Ausdruck eines Individualitätserlebnisses zu verstehen (ob nun nach Maßgabe des Ichbewußtseins des genialen Menschen oder im Sinne der naiven Reflexion auf Grund der sichtbaren Mannigfaltigkeit in der Welt) zum Scheitern verurteilt. Einzig jene Deutung aus dem religiösen Urerlebnis vermag zu befriedigen, da der Mensch in letzter Verantwortung, die ihm keine Macht dieser Welt abzunehmen imstande ist, und in bedrückender und zugleich beglückender Einsamkeit vor seinem Gott steht. Wollte man aber einwenden, daß damit ja nur bestenfalls ein allgemein religiöses, nicht aber ein spezifisch christliches Gotterleben als letzte Wurzel der Leibnizischen Philosophie erwiesen sei, dann ist dem entgegenzuhalten, daß alle auf christlichem Boden erwachsenden philosophischen Aussagen über den Bereich des Religiösen nicht nur um die Inkongruenz zwischen dem gedanklichen Ausdruck und der in ihm zur Darstellung kommenden Wirklichkeit wissen, sondern jene selbst gewollt zur Anschauung bringen.
Dies ist nun aber auch bei Leibniz der Fall. Zunächst in dem unauflösbaren Widerspruch, der darin zu Tage tritt, daß der im Grundansatz des Systems allen Monaden zuerkannte Charakter unzerstörbarer metaphysischer Wesenheit streng genommen doch wiederum nur Gott, eignet; vor allem aber im die Legitimität eines nur rationalen Begreifens der Wirklichkeit letztlich außer Kraft setzenden, fast gespenstisch anmutenden Hindurchschimmern der unzähligen möglichen durch diese eine wirkliche Welt.
Die Beweiskraft dergestalt erschlossener Christlichkeit mag gering erscheinen; um so bedeutsamer, daß, verhalten zwar, aber gleichwohl unüberhörbar spontan bekundete und in Treue dargelebte christliche Frömmigkeit vernehmbar wird. Oder sollte es ein Zufall sein, daß unter den wenigen deutsdien Liedern, die aus Leibniz' Feder geflossen sind, sidi eine innige Betrachtung der zentralen Heilstatsachc des christlidien Glaubens, des Kreuzestodes von Golgatha, befindet? Endlich: ungebeugt durch alle Mißerfolge, die ihm dabei widerfuhren, hat Leibniz hingebungsvoll für die Wiedervereinigung der getrennten christlichen Kirchen gearbeitet. Mögen wir Heutigen die Wege, die er dabei einschlug, als ungangbar erkennen: daß er nicht müde wurde, das einmal ins Auge gefaßte Hochziel beharrlich weiter zu verfolgen, scheint uns nur begreifbar aus einer starken Liebe zur Una saneta.
So reizvoll gewiß die Aufgabe ist, das Geheimnis der einmaligen Gestalten innerhalb der Menschheit zu ergründen, im tiefsten wird sie immer ungelöst bleiben. Bei Leibniz mag der äußere Reiditum seines Schaffens den inneren Reichtum seiner Seele der Nachwelt eher überdeckt als offenbart haben. Und wenn nun in diesen Wochen die ganze Kulturwelt seiner gedenkt, dann möge ihr solches Erinnern zur Rückbesinnung auf jene Kräfte werden, aus denen und um derentwillen er lebte und wirkte.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!