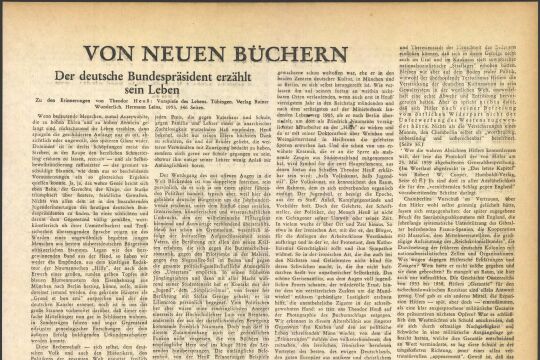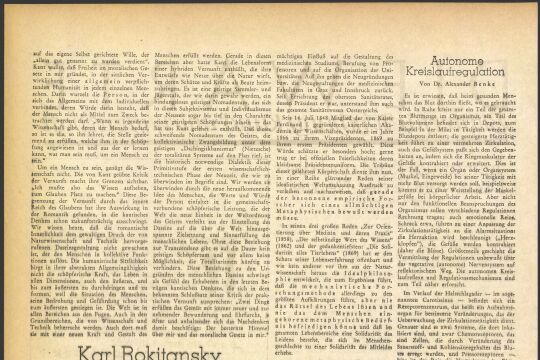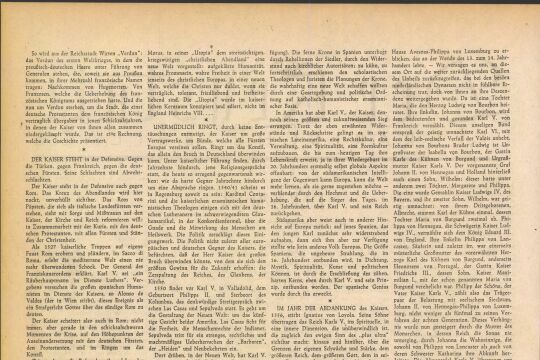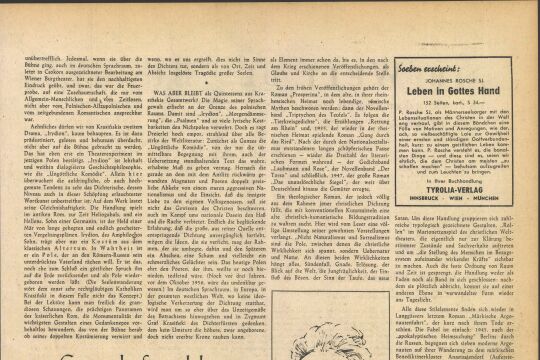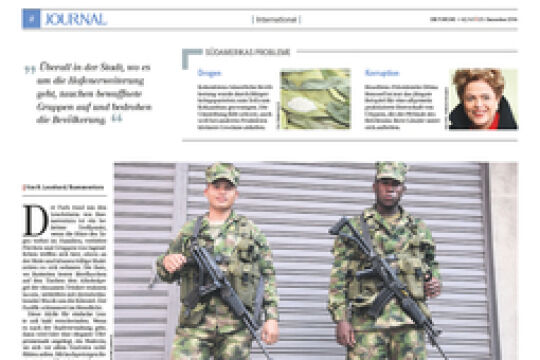Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Gottfried Wilhelm von Leibniz
Das innerlich und äußerlich so bewegte Leben des weltweisen Philosophen und Naturwissenschaftlers, Mathematikers und Theologen, Staatsrechtlers und Politikers, das, als Ganzes genommen, eine einzige Wallfahrt zu den Grenzen des Erkennens, der letzten erfaßbaren Wahrheiten war, stellt uns bei seinem Anfang vor eine gewisse Unsicherheit. Nach der beachtsamen Familienchronik seines gelehrten Vaters ist Leibniz am 21. Juni, nach den Aufzeichnungen des Leipziger Rates am 1. Juli 1646, geboren. Mag der Streit um diese Dekade offen bleiben, jedenfalls wächst der früh vaterlose, früh gereifte Knabe in die düsteren Aus-und Nachklänge des großen deutschen Krieges hinein, deren letzte Wellenschläge auch an die stillen, strengen Schulstuben der berühmten Leipziger Nicolaischule pochen. Dort hat eine sicher etwas harte Pädagogik den allzu kühnen Höhenflug des lese- und wissenswütigen Kindes, das alle gefährlichen Anlagen zum Wunderkind in sich trägt, einigermaßen zu dämpfen gewußt. Mit fünfzehn Jahren bezieht er bereits die stolze Universität seiner Vaterstadt, die ihm ein Lustrum später „wegen zu großer Jugendlichkeit“ die Promotion verweigert. Er soll diese bald danach an der Universität der freien Reichsstadt Nürnberg, zu Altdorf, erreichen, die dem juristisch wie philosophisch gleich glänzenden Disputanten sofort eine Dozentur anbietet. Man nimmt es dem jungen Gelehrten nicht übel, daß er sich solch früher Bindung entzieht, vielleicht ist es die von ihm später erkannte „praestabi-lierte Harmonie“ seines Lebens, daß er durch Boyneburg, den Minister des bedeutenden Mainzer Kurfürsten Schönborn, gar früh mit der großen Politik in Verbindung gerät, deren damaliger Mittelpunkt das Frankreich des „Roi soleil“ ist. Diesem begegnet er mit seinem kühnen .„Consilium aegytiacum“ — er, der junge „Legationssekretär“ (wenn dieser moderne Begriff erlaubt ist), möchte den Allerchristlichsten König in die Verlockung einer Eroberung Ägyptens weisen, nm ihn damit von weiteren Übergriffen auf die europäische Mitte, dem großen Raum, dem doch auch seine (Leibnizens) Heimat angehört, abzulenken. Der Plan kommt damals nicht zur Ausführung, erst Napoleon 1. soll ihn verwirklichen, ohne freilich darin die Grenze seines für Europa und sich, selbst verhängnisvollen Imperialismus zu sehen.
Die Jahre in Paris, die ihn auch wiederholt über den Kanal führen, sind wohl die fruchtbarsten in Leibniz' polyglotter geistiger Entwicklung. Er begegnet Spinozas srdhaft-monistischer Philosophie, die er bewundernd ablehnt, er schaut dem eigenwillig-skurrilen Loeuwenheek bei seinen mikroskopischen Versuchen interessiert über die Schulter, disputiert mit Huygens über die tiefsten mathematischen Probleme und empfängt sogar von dem ziemlich unnahbaren Sir Isaak Newton einige wissenschaftliche Mitteilungen. Mit dreißig Jahren macht er sich zu Hannover einigermaßen seßhaft, um dort in dem anfangs kleinen Welfenlande eine Tätigkeit zu entfalten, die an das spätere ' vielgestaltige Wirken Goethes in Weimar erinnert. Sein Herzog, der ziemlich eigenwillige, vielfach interessierte Johann Friedriebt hat fast täglich neue geistige Anregungen und Wünsche; sie führen Leibniz zur „Invention phosphori“ und zur Auswertung der Zellerfelder Bergwerke, die erst kürzlich erfolgte Konversion seines Herrn gibt zu häufigen theologischen Disputationen Anlaß und dazu soll sich der „jüngste Hofrat“ immer eingehender mit den großen staatspolitischen Fragen befassen, die dem Weifenhause nicht nur die „neunte Kur“, sondern auch die Anwartschaft auf den Thron der Stuarts erlangen sollen. Und diese vielfache Tätigkeit, die bei dem stets nach geistiger Vertiefung strebenden Gelehrten Leibniz nie zu reiner „Betriebsamkeit“ wird, führt ihn nach London wie nach Wien, an den Rialto ebenso wie - an die Spree. Sein neuer Landesherr, Ernst August, nun bald erster Kurfürst von Hannover, verschafft Leibniz den Reichsadel, Ernst Augusts geistvolle Tochter Sophie Charlotte, seit 1701 erste Königin in Preußen, ihrem Freund und Lehrer die Möglichkeiten zur Gründung einer Akademie der Wissenschaften zu Berlin.
Um weniges später sehen wir Leibniz im Schatten der prachtvoll emporwachsenden Mauern des Wiener Belvedere in lebendigster Verbundenheit mit Prinz Eugen, danach unweit von Hannover mit einem äußerst wißbegierigen Russen, Pawel J. Narischkyn. Der zuweilen verblüffenden Hellsichtigkeit des Reichshofrats kommt es erst nachträglich zum Bewußtsein, wer ihm in diesem seltsamen Fremden begegnet — Peter der Große selbst ist es gewesen. Immer weiter, immer unmeßbarer greift die Spannweite dieses großartigen Lebens, das wohl — wie übrigens auch der Savoyer — auf den geruhsameren Mikrokosmus von Ehe und Familie verzichten mußte: Seine unionistischen Bestrebungen haben ihn unter anderem mit den führenden Jesuiten seiner Zeit zusammengebracht, vor allem mit dem bekannten Sinologen Grimaldi; nun hat der Zar mit ihm Verbindung gesucht, der sich ja in den seltsamsten Verkleidungen bemüht, seinem Riesenreiche den kulturellen Anschluß an das übrige Europa zu gewinnen. Dieses Europa ist nur noch der innere konzentrische Kreis von Leibniz' Weltwirksamkeit, sie dringt durch Grimaldi über Goa und Hinterindien bis Peking, während sie dank der russischen Verbindungen von der Weichsel über den Ural bis an die Nordgrenze Chinas greift... Dabei ist Leibniz letztlich tief einsam geblieben und einsam ist auch sein letzter Weg, den er mit der Ruhe des in sich Vollendeten antritt. Der harte, hochmütigkalte Georg Wilhelm von Celle ist mittlerweile seinen Brüdern in Hannover gefolgt und hat im Jahre 1714 die stolze Krone von St. James erworben — welch hohen Anteil hat Leibniz an der Erreichung dieses Weifenzieles gehabt. Doch konnte sich dieser nicht entschließen, seine universale Haltung der einseitigen Politik des Königs zu opfern, der sich seinen weifischen Stammlanden mehr und mehr entfremdete. Darum ließ man den um das Weifenhaus so Hochverdienten in der hannoverschen Enge, anstatt ihn an den glänzenden Hof von Windsor zu berufen als gebotenen Abschluß dieses erfüllten Lebens. Ohne Bitterkeit soll der schwer Leidende die letzten Worte Gregors VII. wiederholt haben: Dilexi justitiam et odi iniquitatem, propterea morior in exilio 1 — mit der feinsinnig-wehmütigen Betonung des „propterea“. — Niemand folgte dem Sarge des in Ungnade Geratenen, seine Begräbnisstätte ist lange unbekannt geblieben. Ist es ein Zeichen der Unsterblichkeit, daß so viele ganz Große einsam sterben müssen, nur sich und ihrem Werke vorbehalten?
Soweit in aller gedrängten Kürze des „Panhistors“ äußerer Lebensgang. Seine umfassende philosophische Bedeutung kann nur eben angedeutet werden. Tief bewundernswert bleibt hiebei sein systematischer Optimismus, in dem er alle Dinge des Lebens zu erfassen und in eine große Harmonie zu bringen sucht. In ihm geschehen seine Bemühungen um die Vereinigung der christ-
1 „Ich liebte die Gerechtigkeit und haßte alle Unbill, deshalb sterbe ich in der Verbannung.“ liehen Religionen, die Ansätze zu einer Universalsprache und -schrift, das Bestreben, die gewaltigen Bereiche des Glaubens und Wissens in einen richtigen Ausgleich zu fügen. Dabei geht Leibniz unmittelbar von Aristoteles aus, findet bei Augustinus den tiefen Erfahrungssatz, daß alle Gnade die Natur zur Voraussetzung hat, um von da aus zu einer wunderbaren Erkenntnis vom Dasein Gottes zu kommen. Das Dasein Gottes offenbart sich ihm als höchste „Monas“, die er anbetet in der Demut eines gütigen Herzens. Nicht „more geometrico“, wie es die Ethik Spinozas versucht hatte, noch weniger in den verschwommenen Vorstellungen seiner deistischen Gegner oder gar mit der ganz abwendigen Gefühls- und Verstandeskälte der frühen Rationalisten. So führt ein weiter Weg von seiner sicher etwas eigenwilligen, aber durch ihren minutiös durchsichtigen Aufbau überraschenden „Monadologie“ zu seinem tiefsten und reifsten Werk, der „Theodicee“, die eigentlich nichts anderes als eine „Laientheologie“ darstellt2. Und es bedeutete eine Auszeichnung für die fürstlichen Empfänger, denen der große Verfasser die beiden Werke im Manuskript gewidmet hat: die „Monadologie“ bildete ein Kleinod im Besitz des „edlen Ritters“, die „Theodicee“ eine gleiche Kostbarkeit für Leibnizens geniale Schülerin, Königin Sophie Charlotte von Preußen, die das Manuskript der Berliner Akademie der Wissenschaften vermachte, da sie wußte, daß es weder bei ihrem Gemahl und noch viel weniger bei ihrem ihr so unähnlichen Sohn (dem späteren Soldatenkönig) entsprechende Würdigung finden würde.
Dreihundert Jahre scheiden uns von Gottfried Wilhelm von Leibniz' Geburt, doch die Not seiner und unserer Zeit lassen diesen Abstand geringer erscheinen. Er wurde in einen politischen, kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen Zusammenbruch der europäischen Mitte hineingeboren, wie wir ihn selbst — in freilich weit gigantischeren Ausmaßen und Folgerungen — erleben mußten. Doch durfte er sich an dem geistigen Wiederaufbau seiner Zeit beteiligen, was uns Anlaß gibt, auch für unsere Epoche eine solche Neugestaltung zu erhoffen. Aus der Disharmonie des eigenen Erlebens ergeben sich für Leibniz die vielgestaltigen Bemühungen um Einheit im Denken, Einheit in den Begriffen, Einheit womöglich sogar im Glauben. Immer wieder hat er sich aus den zahllosen Forderungen seines Tages auf das Wesen der Dinge zurückzuziehen versucht, in dem „Unum necessarium“ der letzten Ewigkeitsbezogenheiten den ruhenden Pol seines Lebens zu finden. Gegen Ende seines überreichen Lebens bekennt er einem gelehrten Freunde — er hatte ' deren nur wenige —: „Wer mich iur aus meinen Werken kennt, kennt mich nicht.“ — Deshalb hat dieses kleine Gedenkblatt auch mehr an den Menschen, denn an den Philosophen Leibniz erinnern wollen. Denn seine Philosophie haben spätere Systeme uns vielleicht einigermaßen entrückt, als guter Mensch, als weltweiser Apostel des Friedens vermag uns Leibniz heute wieder besonders nahe zu sein.
! Der genaue Titel des französisch verfaßten Werkes lautet in deutscher Ubersetzung: Theologische Untersuchungen über die Güte Gottes, die Freiheit des Menschen und den Ursprung des Bösen (nach der Neuausgabe von Cassirn, Berlin 1930).
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!