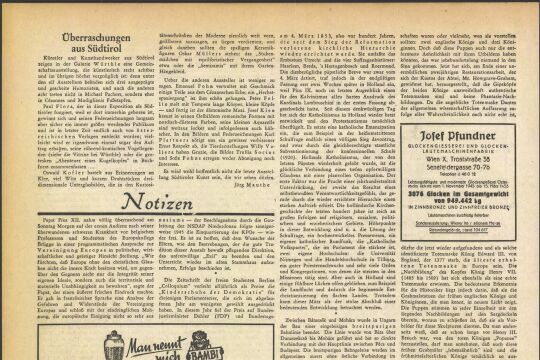Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Randhemerkungen zur woche
In der österreichischen Publizistik ist still und unvermerkt das Verschwinden einer Zeitschrift vorübergegangen, das in Anbetracht der Umstände nicht ohne die Annahme tieferer Hintergründe verstanden werden kann. Das Schicksal des sozialistischen Studentenblattes „Der Strom“, das kam, verschwand, mit einigen Veränderungen wieder):am und vor ein paar Monaten scheinbar endgültig verschwand — und dies zu, einer Zeit, da der von vielen zornigen Blitzen umzuckte CV mit seiner wohlausgestatteten „A k ademi a“ wieder hervortrat —, ist nun auch von der kulturpolitischen sozialistischen Wochenschrift „Die Zeit“ geteilt worden. Das Blatt, das sein Erscheinen am 1. Mai 1948 begonnen hatte, zeigte einen älmlichen inneren Aufbau wie die „Furche“ und sollte erkennbar für die intellektuellen Schichten bestimmt sein. Bundespräsident Dr. Renner lieferte der Wochenschrift einige Male gewichtige Beiträge, die erkennen ließen, welche Aufgabe und Bedeutung dem Blatte zugemessen wurde. Beste Köpfe der Sozialistischen Partei tauchten in den Spalten auf. Äußere
Zeichen verrieten jedoch bald, daß das Interesse führender Politiker an dem Unternehmen erlahmte, das zu einer eigenen Linie nicht fand und dem das erwartete Echo versagt blieb. Obwohl ein guter Teil der Kosten des Blattes von der Partei bestritten wurde, gestaltete sich die Entwicklung auch hinsichtlich der Auflage unbefriedigend. Wohl deshalb, weil ein selbständiges programmatisches Wollen nicht aufkam, das dem 20. Jahrhundert und der nachgerückten sozialistischen Generation zu entsprechen vermocht hätte. So kam der Schiffbruch. „Die Zeit“ ist aus dem Bilde der Zeit verschwunden. Kann man denn politisch von einem Antiquariat leben? Abermals trägt diese sozialistische Zeitungsepisode die Merkmale der Schwäche an sich, die überholte Parteidog-matik und der Widerspruch des Gegenwartsmenschen dem offiziellen österreichischen Sozialismus anlasten. — Wenn dies hier vermerkt wird, so geschieht es wahrlich ohne Schadenfreude. Man kann sich nichts von Erscheinungen versprechen, die zu einem Verflachen einer ernsten geistigen Auseinandersetzung hinführen.
•
Zum Überangebot an Ärzten steht der Mangel an Krankenschwestern in seltsamem Gegensatz. Auf einer Pressekonferenz des Wiener Stadtrates für Gesundheitswesen erfuhr die Öffentlichkeit, daß einem jährlichen Ausfall von 500 Pflegepersonen infolge Pensionierung, Kündigung, Krankheit und Tod nur ein jährlicher Nachwuchs von 120 diplomierten Schwestern gegenübersteht. Heuer fällt der Nachwuchs überhaupt aus, weil das neue Kravkenpflegegesetz die Ausbildungszeit von zwei auf drei Jahre erhöhte und der ursprünglich auszuschulende Jahrgang ein Jahr länger studieren muß. Die Unterbilanz an geeignetem Pflegepersonal führt zu Schwierigkeiten und naturgemäß auch zu Mehrbelastungen der vorhandenen 5600 Schwestern, von denen 1400 geistliche Schwestern sind. Die nachwachsende Generation scheint nicht mehr viel Interesse an der strengen Disziplin, an der internatsmäßigen Unterbringung und an der Uniformierung zu haben. Das sind wenigstens die Einwände, die man immer wieder in der weiblichen Jugend gegen diesen Beruf trotz seiner guten Verdienst- und Aufstiegsmöglichkeiten hört. Vielleicht könnte man hier doch einiges der amerikanischen Nurse abschauen, die ein gewisses Mehr an persönlicher Entfaltungsmöglichkeit gegenüber ihren europäischen Berufsgenossinen besitzt. Auch eine vermehrte Heranziehung geistlicher Schwestern wäre zu begrüßen, zumal die berufliche Beständigkeit bei dieser Gruppe viel größer ist und von vornherein eine große Konzentration auf den sehr opfervollen Beruf gegeben ist. Allerdings ist auch bei der geistlichen Schwesternschaft ein Rückgang an Pflegerinnennachwuchs eingetreten. Vielleicht ist der allgemeine Schluß erlaubt, daß noch nicht die richtigen psychologischen Methoden gefunden sind, um die heutige weibliche Jugend in größerer Zahl den Weg zu einem zwar schweren, aber innerlich befriedigenden Beruf finden zu lassen.
Die meisterliche Arbeit Wiener Bieder-, meierhandwerker und, später, die Leistungen der „Wiener Werkstätte“ haben — im Verein mit der Tüchtigkeit österreichischer Innenarchitekten — der heimischen Möbelindustrie einen internationalen Ruf verschafft, der selbst den ersten Weltkrieg noch überdauerte; die „Wiener Schule“ war in der Innenarchitektur der ganzen Welt führend. Sie ist es leider heute nicht. Was an Möbeln hergestellt wird, ist mit nicht allzu vielen Ausnahmen im Durchschnitt wertlos und das heißt in einem solchen Fall: auch vom Standpunkt des
Exports aus wertlos. Wer daran die Schuld trägt? Wahrscheinlich einerseits ein Teil des österreichischen Publikums, der et immer noch vorzieht, an Stelle einfacher und formschöner Möbelstücke pompösfurnierte Erzeugnisse in „Rund- und Vollbau“ zu kaufen, aber vielleicht auch manche Tischler und Möbelfabrikanten selbst, die wohl oder übel sich den Wüschen dieser Käuferschichte anpassen. Die seltsame Folge ist, daß das schlichte und zweckentsprechende Möbelstück — da es nicht in Serie hergestellt werden kann — noch teurer ist als das massenweise erzeugte und dank seiner komplizierten Bauweise ohnehin schon kostspielige falsche Möbelprunkstück. Die Lage erfordert Abhilfe. Die Wiener Tischlerinnung hat mit bemerkenswerter Initiative den ersten Schritt dazu getan. In einer vieldiskutierten Ausstellung wies sie auf die Möglichkeiten und Schwächen des österreichischen Tischlergewerbes hin. In einer Aussprache mit dem Publikum scheute sich die Innung nicht, neben fremden Fehlern auch die elgenen aufzuzeigen und beim richtigen Namen zu nennen. Ein ungewöhnlicher Fall in einer Zeit, in der Interessenverbände gewöhnlich eifersüchtig ihre Fehlerlosigkeit zu beweisen lieben und Kritik entrüstet abzulehnen bestrebt sind ...
Eine strenge, auch in Österreich nützlich zu. lesende Gewissenserforschung stellt im Juniheft der Schweizer Monatsschrift „Civitas“ Lucius Simeon, Zürich, unter dem Titel „Niedergang des föderalistischen Denkens“ an. Der Verfasser findet, dieses grundsätzliche Denken habe in der Schweiz unter dem zentralistischen Druck der letzten Jahrzehnte bedenklich gelitten. „Das Wissen um die staatspolitischen Notwendigkeiten, die sich aus der Struktur eines föderalistischen Bundesstaates ergeben“ — sagt der Autor — „müßte das Feld weitgehend den Argumenten einer verwirtschaftlichten Politik räumen. Der Glaube an die Lebensfähigkeit des föderalistischen Gedankens wird zwar in gelegentlichen Lippenbekenntnissen immer wieder beteuert — die praktizierenden Föderalisten aber sind rar geworden.“ Als besonders drastischen Beweis führt der Verfasser den Schweizer Volksentscheid vom 5. Juni d.J. an, der einer wichtigen Frage der Neuordnung des Finanzhaushaltes des Bundes galt. In diesem Volksentscheid, in dem 486,000 Stimmen gegen 267,000 sich im zentralistischen Sinne aussprachen, sei die Ablehnung der förderalistischen Lösung „auf einem Gebiete erfolgt, auf dem sich der Zentralismus in seiner deutlichsten und abschrek-kendsten Form zeigt.“ Dabei ist es vielsagend, daß angesichts des bevorstehenden Volksentscheides „mit dem Gedanken gespielt wurde, ins illegale Notrecht zu flüchten“, in eine „Staatsstreichpolitik“. Der Autor sieht schwerwiegende Folgen der föderalistischen Niederlage voraus, die geschehen konnte, obwohl der Zentralismus den Schweizern eine wesensfremde Macht ist. Er ruft nach einer Regeneration des föderalistischen Denkens durch eine intensive politische Schulung, solle nicht die Schweiz dem Zentralismus verfallen. — Das Schweizer Beispiel macht neuerlich erkenntlich, wie tief und gefährlich der Zentralismus, den die Diktaturen zu ihrem System gemacht haben, sich selbst dem Schweizer Volke einbohren konnte. Sein stärkster Wegbereiter in der Schweiz ist der Sozialismus.
Am 19. Juni beendete der neugewählte Oberste Sowjet der UdSSR seine erste Sitzungsperiode, die am 10. Juni begonnen hatte; in dieser Zeit von zehn Tagen verabschiedete er nicht nur das Budget 1950 für die ganze Union, sondern auch für die einzelnen Republiken. Das grenzt an parlamentarische Zauberei. — Interessant ist die Verteilung der Steueraufkommen an die Republiken, die wir der „Iswestija“ vom 21. Juni entnehmen: Bei der Umsatzsteuer schwankt sie von 60 Prozent für die Karelo-Finnische Republik und sinkt herab bis zu drei Prozent für die Lettische Republik; von der Einkommensteuer und Ledigen-, Alleinstehenden- und Kleinfamiliensteuer werden einheitlich 50 Prozent an die einzelnen Republiken überwiesen; die Steuereinnahmen der Motoren-Traktoren-Stationen, die eigens verrechnet werden, unterliegen demselben Verteilungsschlüssel; nur die Usbekische und Tadschikische Republik erhalten aus einem nicht genannten Grunde nur 20 Prozent. — Eine Reihe von Ukasen des Präsidiums des Obersten Sowjets wurde nachträglich gutgeheißen, darunter waren sogar solche, die Änderungen der Verfassung enthielten.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!