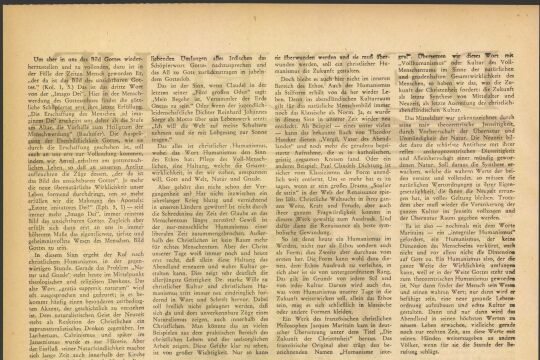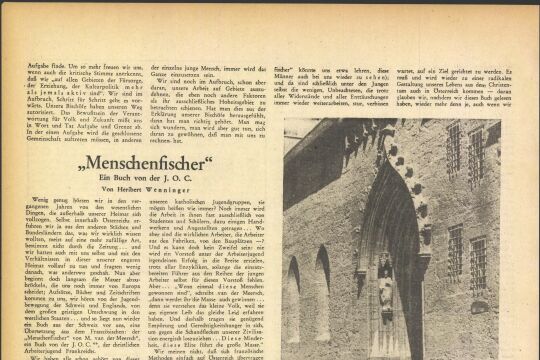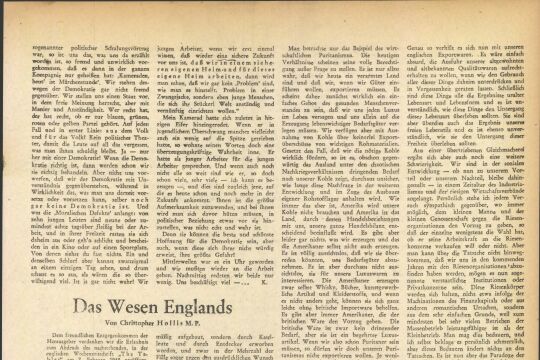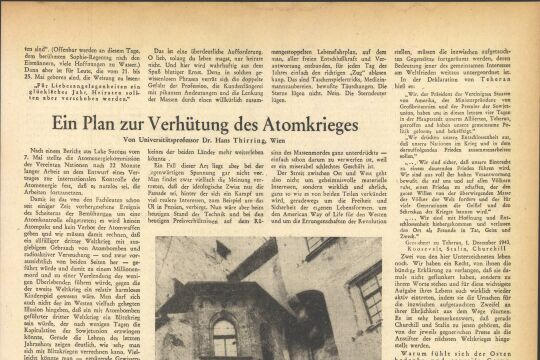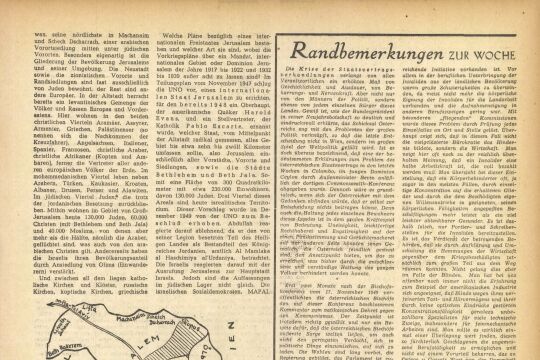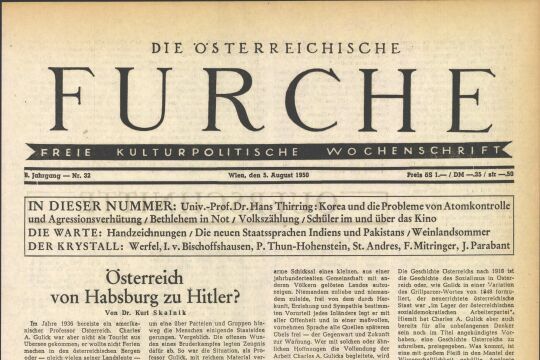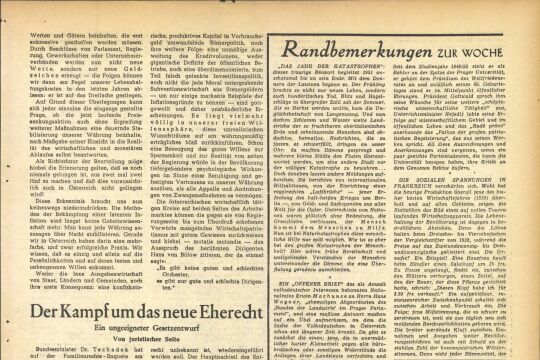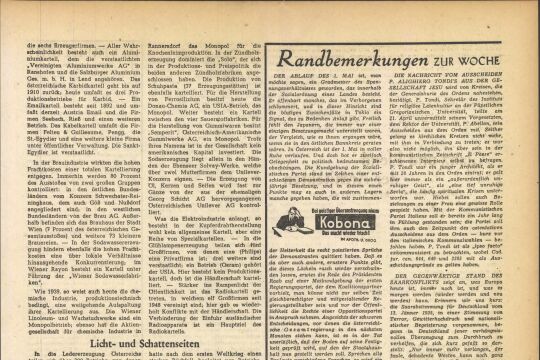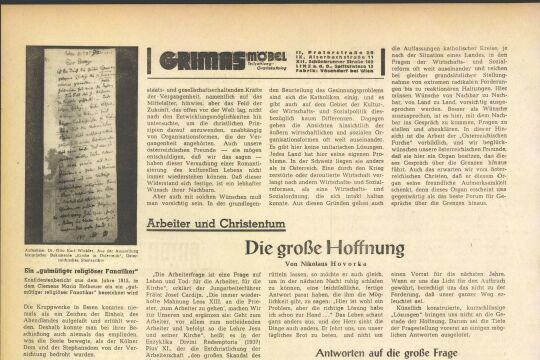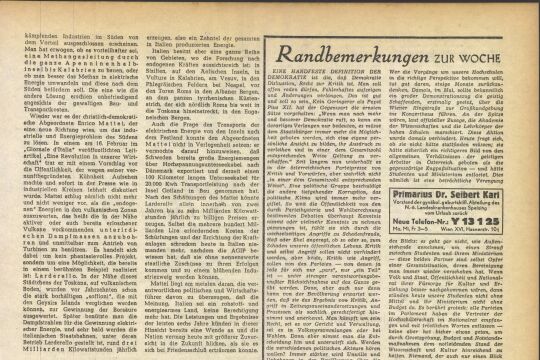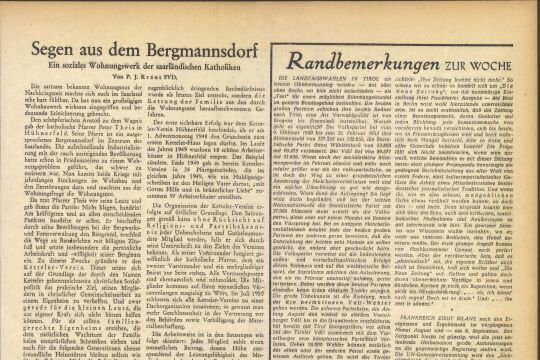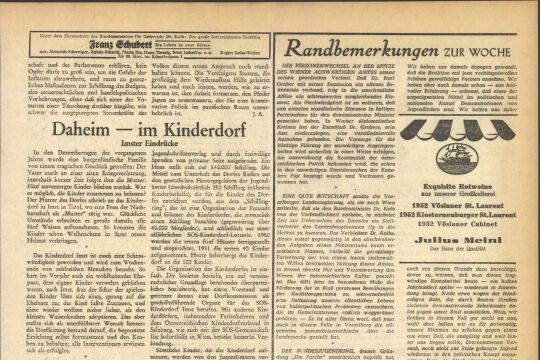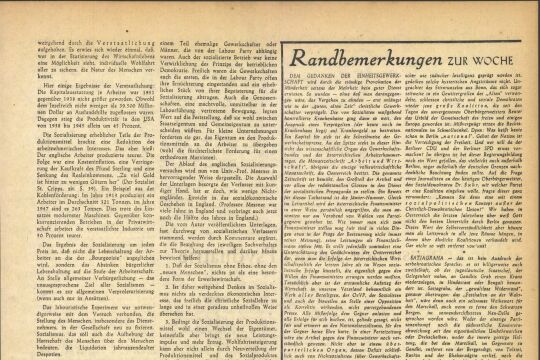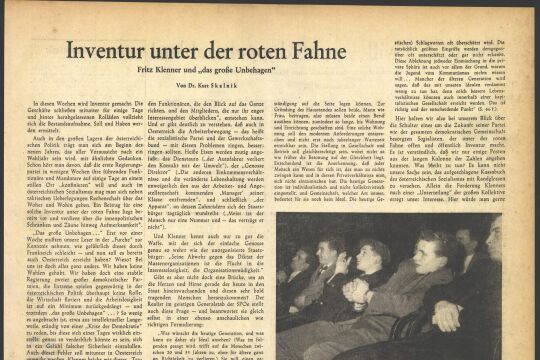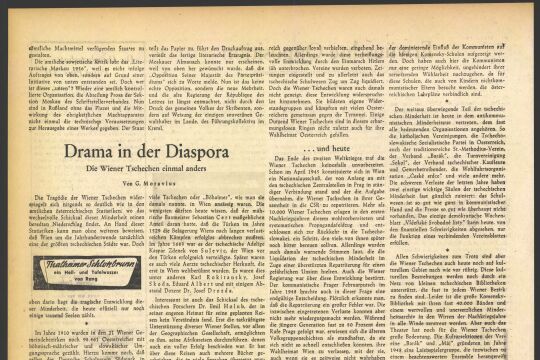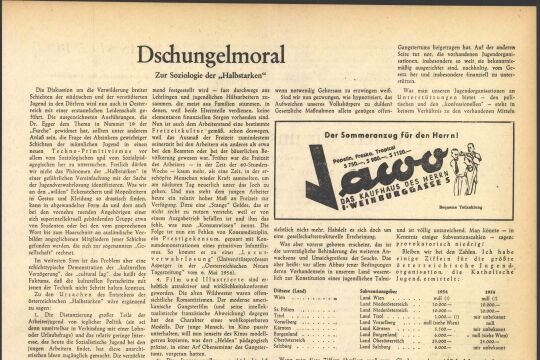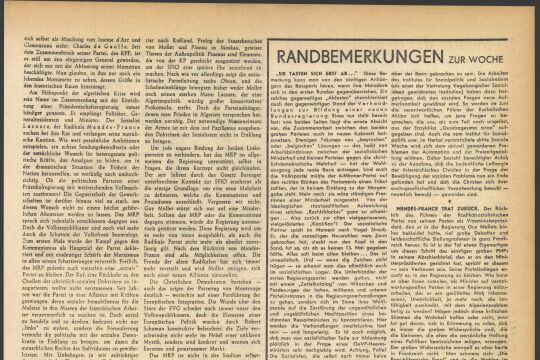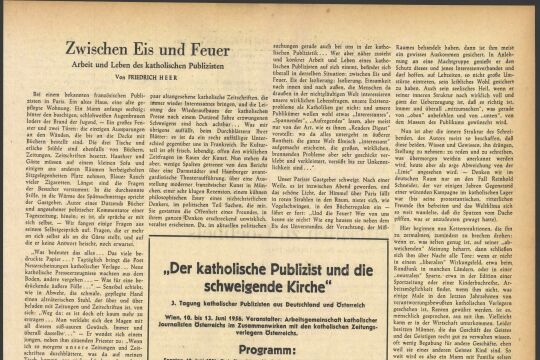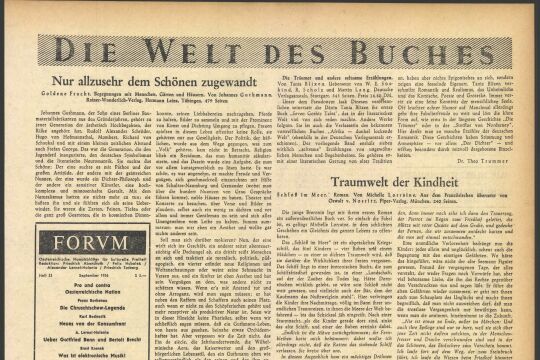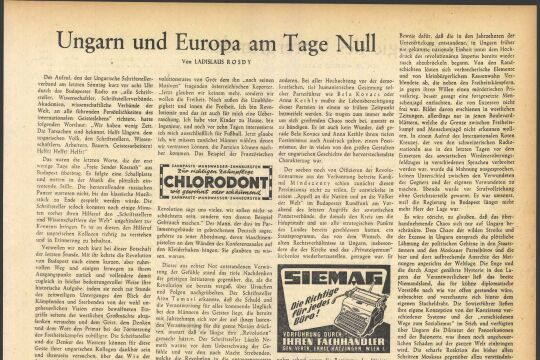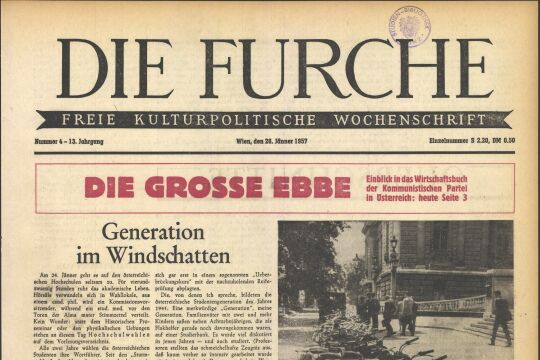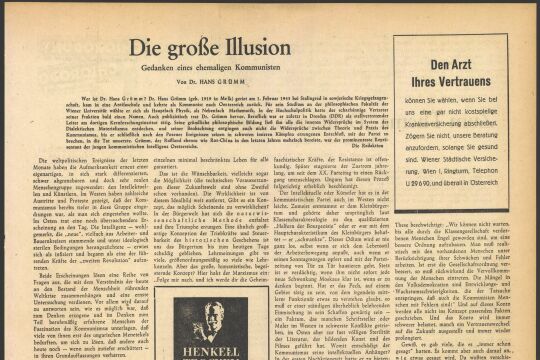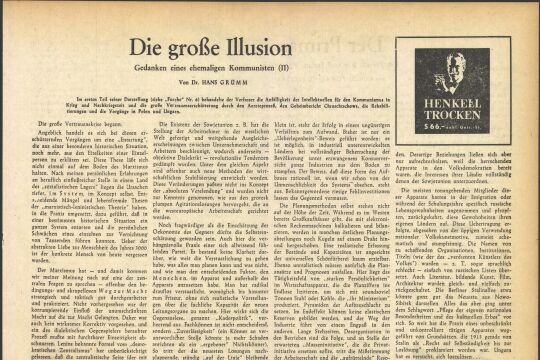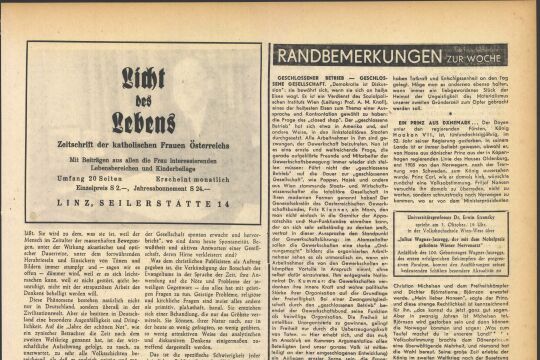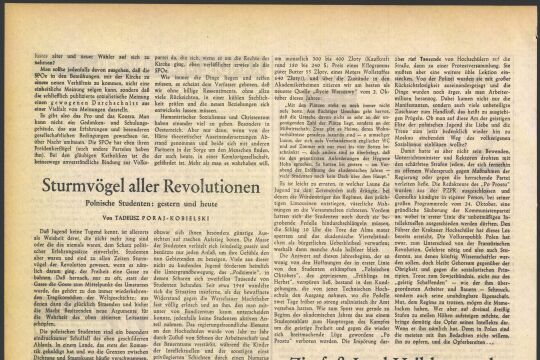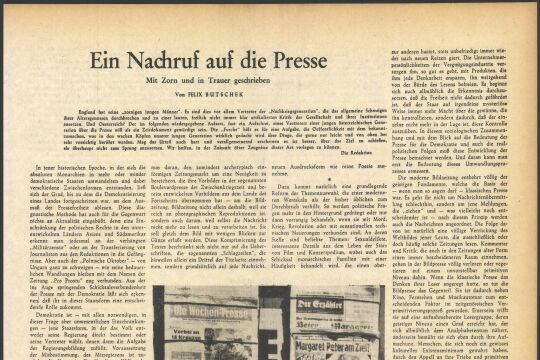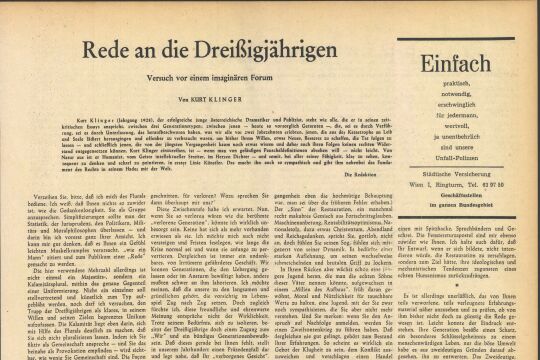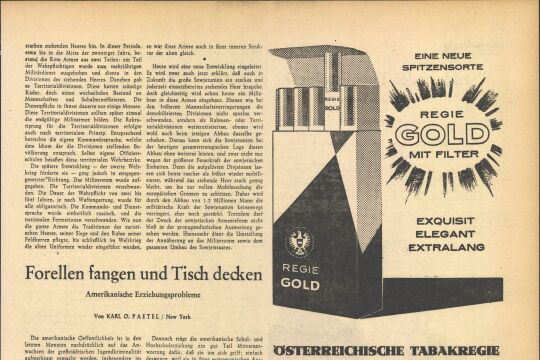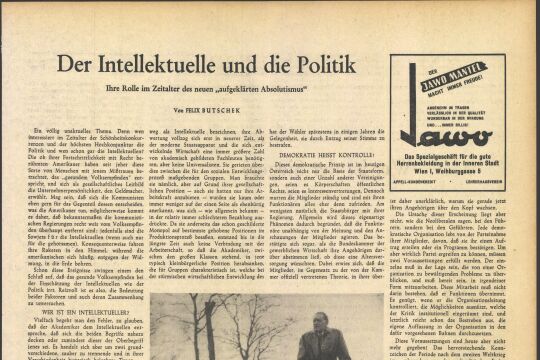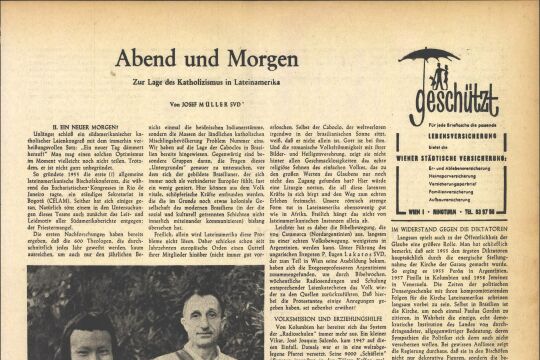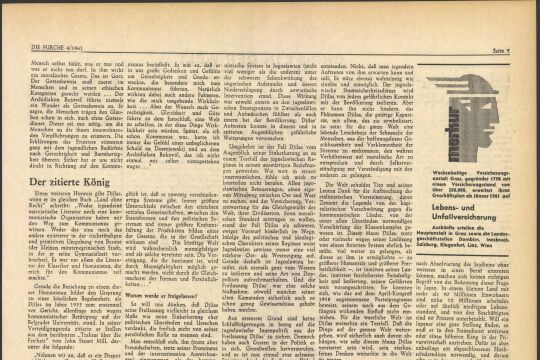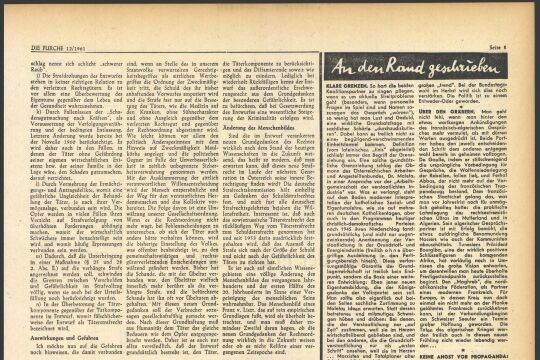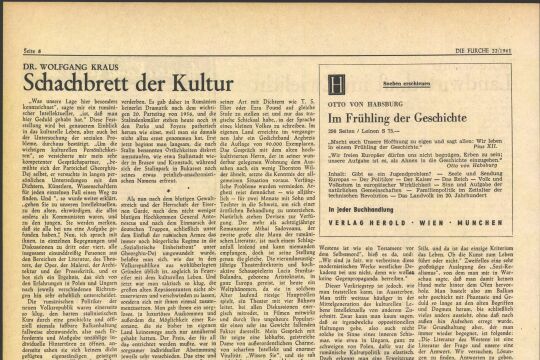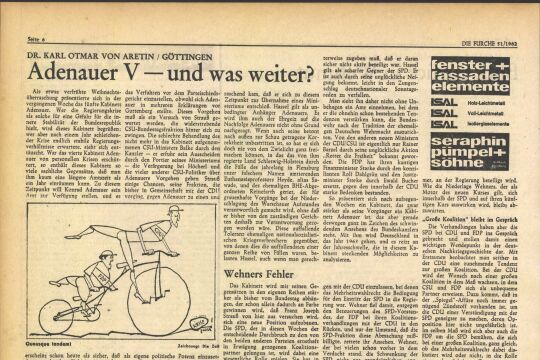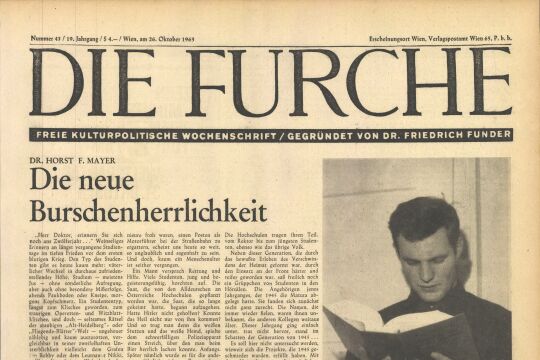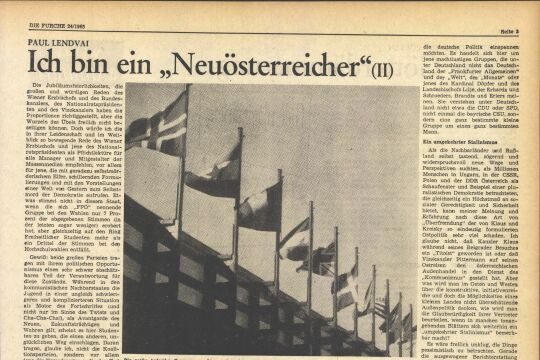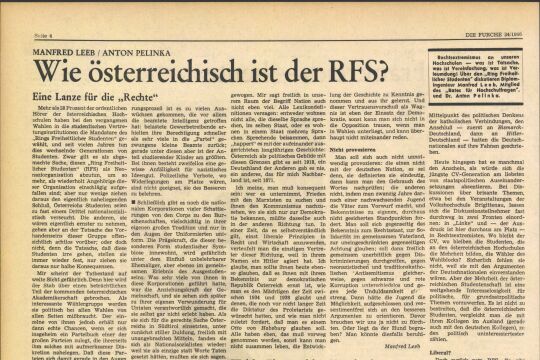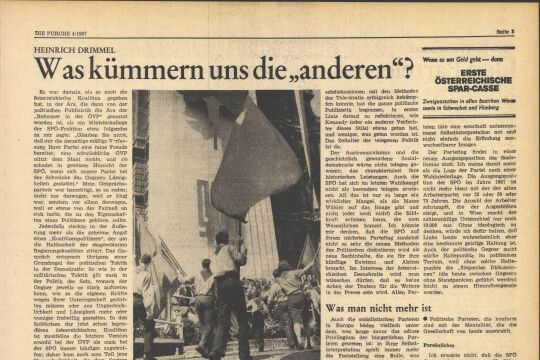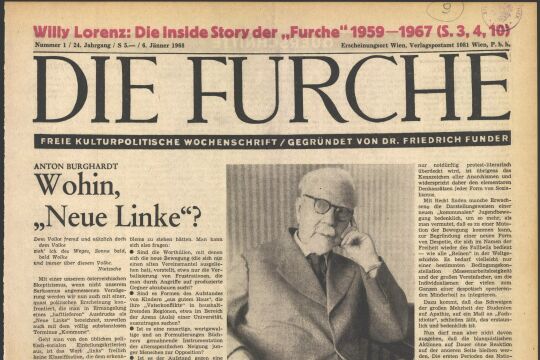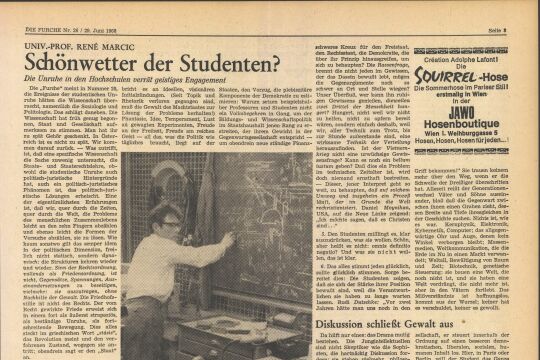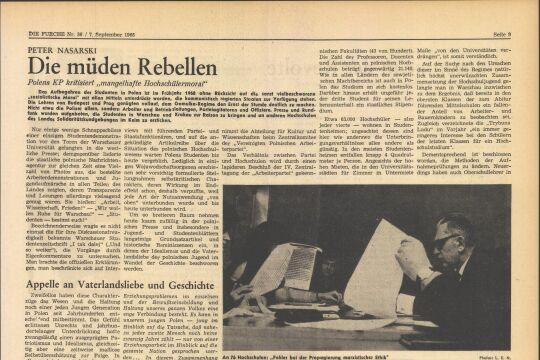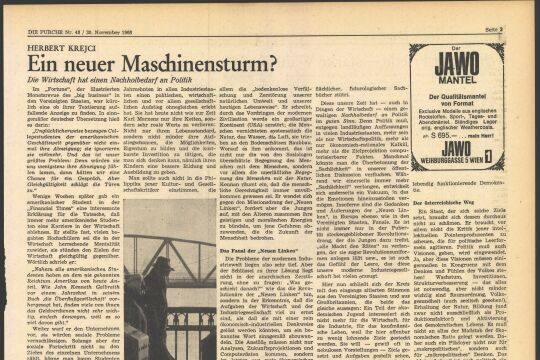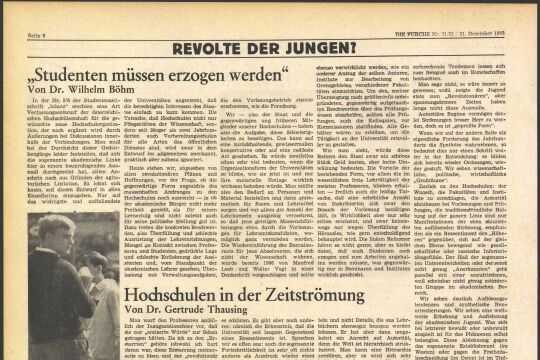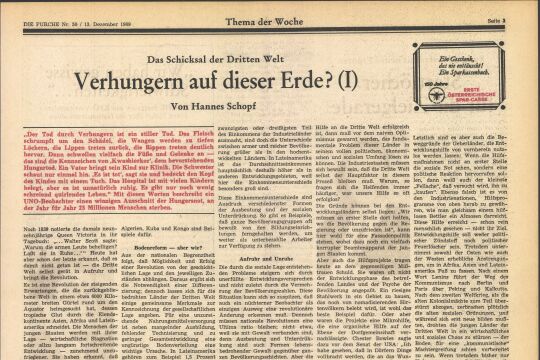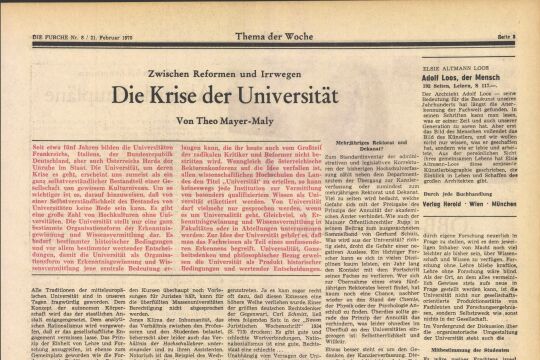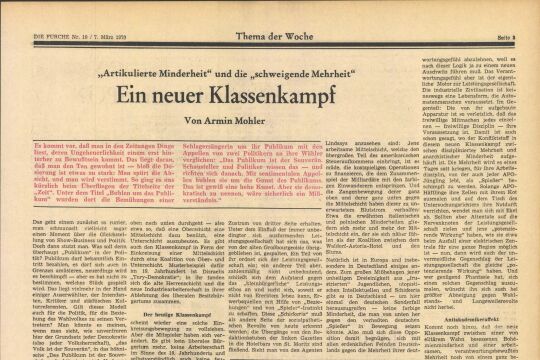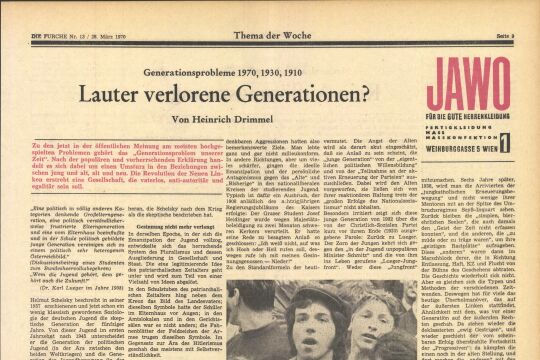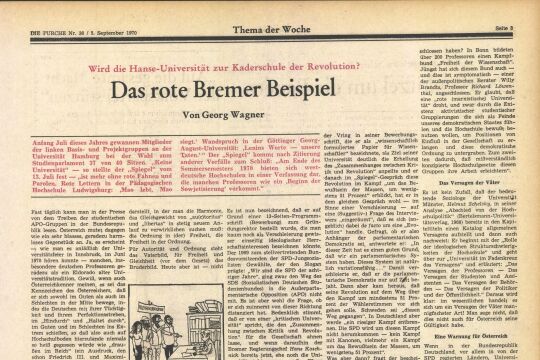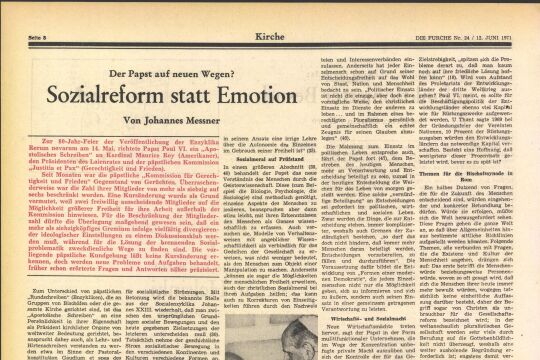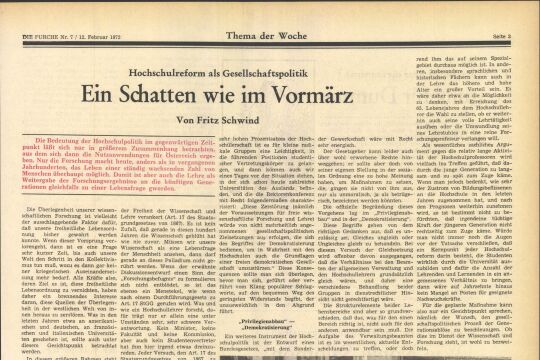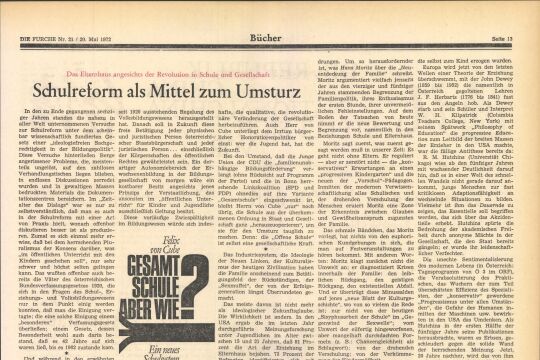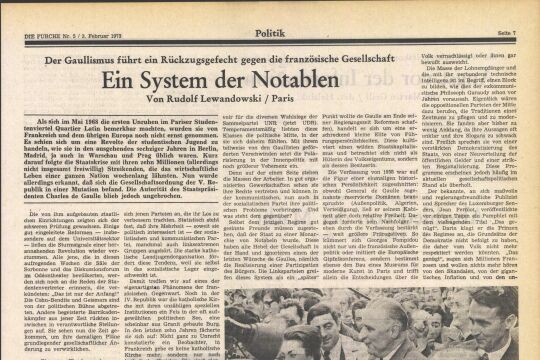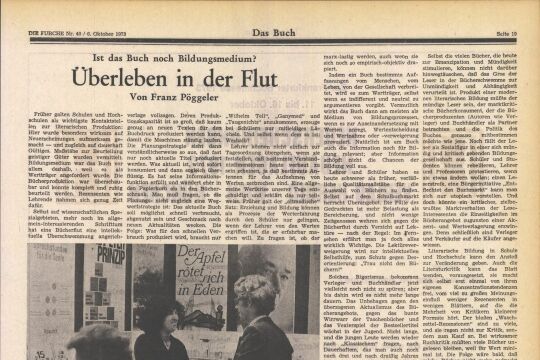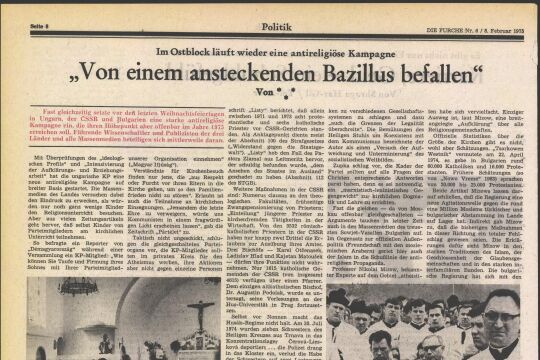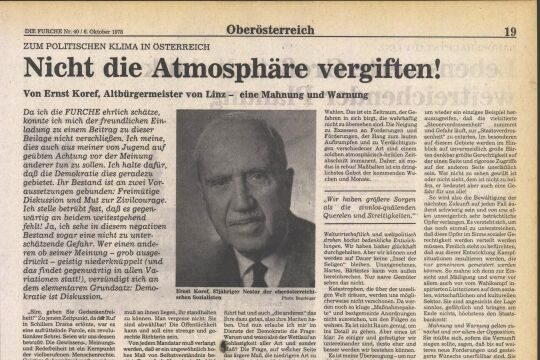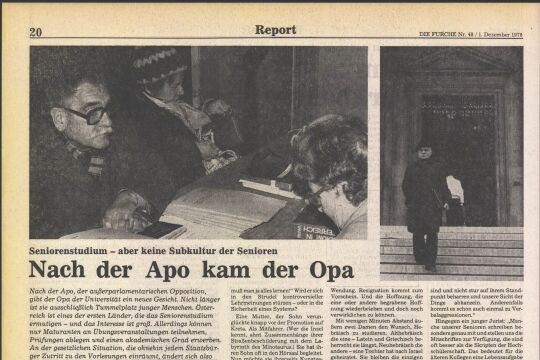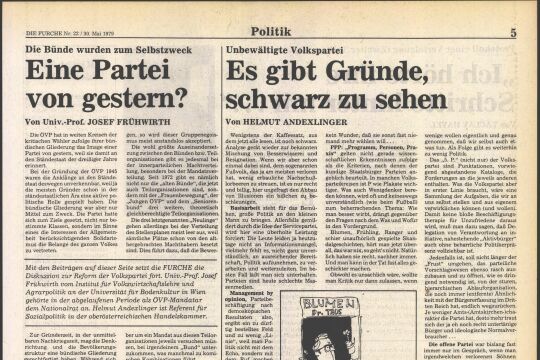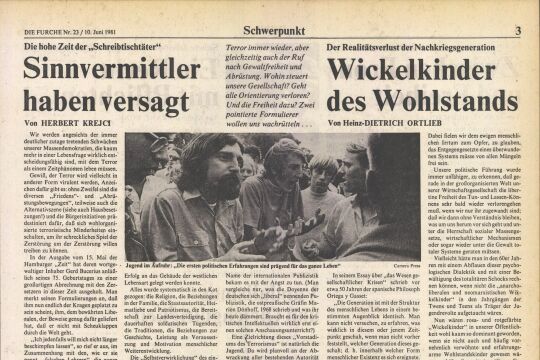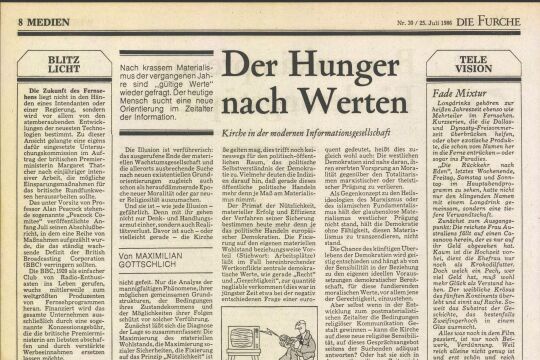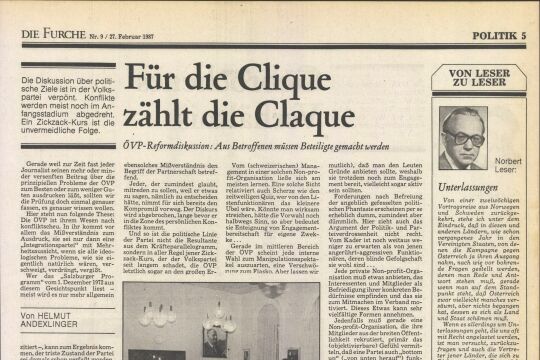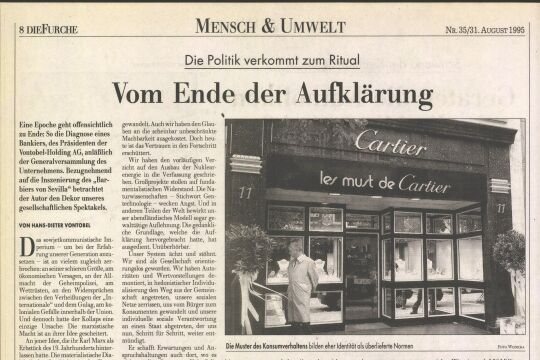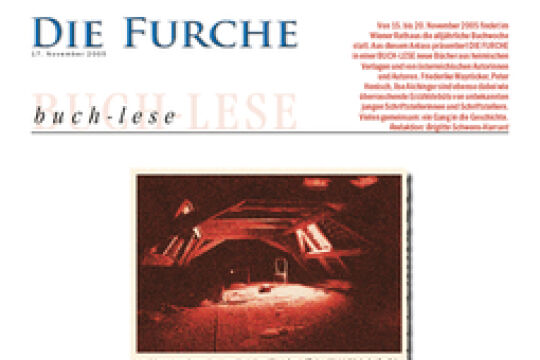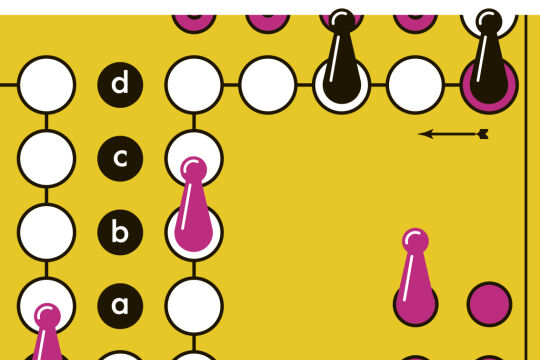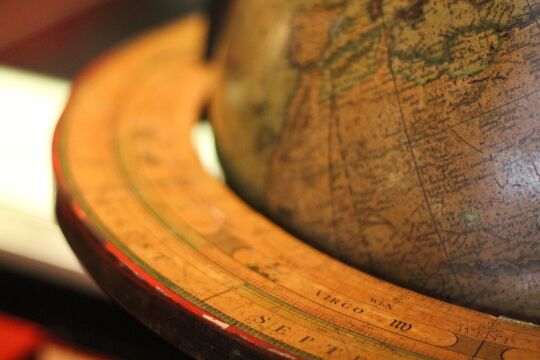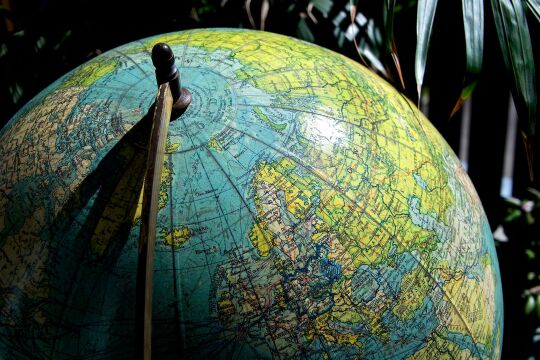Uni-Proteste: Die Vergesslichkeit einstiger Revoluzzer
Christian Schacherreiter kritisierte vergangene Woche „Die Rettung der Welt vom Hörsaal aus“. Einer seiner ehemaligen Studienkollegen kontert – und lobt das damalige und heutige Engagement.
Christian Schacherreiter kritisierte vergangene Woche „Die Rettung der Welt vom Hörsaal aus“. Einer seiner ehemaligen Studienkollegen kontert – und lobt das damalige und heutige Engagement.
Wie von Christian Schacherreiter, einem meiner Studienkollegen (in einem anderen Fach) aus den 1970er Jahren in Salzburg, werden die Protestaktionen gegen den Klimawandel auch von anderen häufig kritisiert. Dabei waren unsere eigenen Studienerfahrungen damals ebenso von heftigen und aufmüpfigen Studierendenprotesten gekennzeichnet.
Deshalb ist es bemerkenswert, dass gerade jene, die ehemals durchaus als „Revoluzzer“ galten, den gegenwärtigen Aktivismus Studierender gegen die aktuellen Krisen etwas von oben herab kritisieren. Haben sie denn alle das eigene studentische Engagement vergessen? Etwa den „antiimperialistischen“ Kampf gegen die Politik der USA während des Vietnamkriegs? Unser Plädoyer für die Überwindung des kapitalistischen Systems in Richtung einer – je nach Überzeugung – sozialistischen, wirklich christlich sozial fundierten oder „klassenlosen“ Gesellschaft? Unsere Wut auf nationale wie internationale Unrechtsverhältnisse? Unsere Hörsaalbesetzungen, unsere Vorlesungskritik an Professoren (damals nur männliche) wegen reaktionärer Lehrmeinungen, unsere Teach-ins und anderes mehr? Wenn ich mir anschaue, wie viel Kritiklosigkeit und Stromlinienförmigkeit die zunehmend entdemokratisierten Universitäten heute produzieren, dann bin ich stolz auf unser damaliges Engagement – und froh über aktuelle Protestaktionen Studierender wie „Erde brennt“ u. a.
Überwindung des Kapitalismus
Jedenfalls sollten diese nicht vorschnell wie aus der Warte scheinbar weiser Älterer als „emotional nachvollziehbar, praktisch unbrauchbar“ abgewertet werden. Die von den Hörsaalbesetzer(inne)n analysierten Gegenwartsmiseren, insbesondere der Klimawandel, sind doch tatsächlich von unserem „Wirtschafts- und Sozialsystem, dem Kapitalismus“ verursacht und nicht einfach ein „Kraut-und-Rüben-Katalog globaler Schieflagen“. Und dass ein den Planeten letztlich zerstörendes kapitalistisches System „überwunden“ gehörte, sollte nicht wegen des Scheiterns anderer Staats- und Wirtschaftsformen ad acta gelegt werden.
Dass andererseits ein „Machtwechsel“ in der Gesellschaft – so Schacherreiter – nur über Wahlen erfolgen könne, nicht durch „Selbstermächtigung politischer Avantgarden“, blendet jede Form nichtparlamentarischen Widerstands damals wie heute aus. Immer wieder bezichtigen ja auch rechte und konservative Kritiker(innen) derartige Proteste einer illegalen, undemokratischen Vorgangsweise, ja sogar der Vorbereitung „gewaltsamer“ Entwicklungen. Da frage ich mich: Haben die alle vergessen, was unsere eigenen Proteste, auch sehr ruppige, in den 1970er Jahren europaweit an demokratischem Veränderungspotenzial mit sich brachten? Auch der Kampf gegen eine Bildung, die unkritische Expert(inn)en – wenn überhaupt – produziert, war uns wie den heute engagierten Studierenden ein berechtigtes Anliegen. Das sollten wir bedenken, anstatt jetzt als saturierte Senioren das Engagement junger Leute – ohne dass man alles auf Strich und Faden teilen müsste – zu diskreditieren.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!