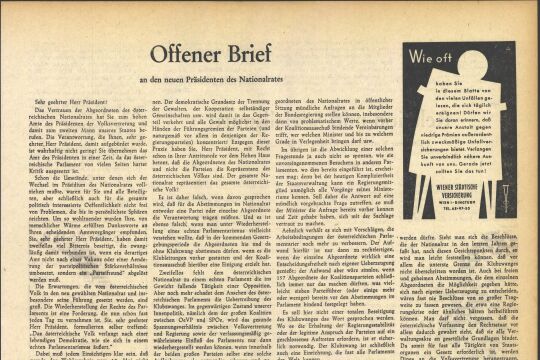Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
SPITZELAFFARE ZUM GEBURTSTAG
Vor dem 700-Jahr-Jubiläum förderte die Affäre Kopp im Herbst 1988 den „Fichen-Skandal” zutage. Die Bundesrätin Elisabeth Kopp hatte Amtsgeheimnisbruch begangen und ihren Mann Hans gewarnt, daß Ermittlungen wegen Drogengeschäften gegen die Shakarch Trading liefen, in deren Vorstand Hans Kopp damals war. Darauhin untersuchte eine parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) die Amtsführung des EJPD, auch die Arbeit der politischen Polizei. Dabei stieß sie auf 900.000 Fi-chen (Karteikarten), die Eintragungen, oft mehr Vermutungen als Fakten, über Personen und Organisationen, vor allem der (legalen) demokratischen Opposition, festhalten.
Aufgabe der politischen Polizei ist die „Beobachtung und Verhütung von Handlungen, die geeignet sind, die innere oder äussere Sicherheit der Eidgenossenschaft zu gefährden”. Dabei gingen die „Staatsschützer” sehr eigenmächtig vor.
Der Bundesrat versprach, die Bespitzelungen einzuschränken und klare Richtlinien aufzustellen. Weil Almen so abgeschieden sind und man nicht weiß, ob nicht doch a Sünd dort herrscht, werden diese regelmäßigen Kontrollen unterzogen. Vor wenigen Tagen wurden die neuen Richtlinien publik. Sie zeigen klar, daß die politische Polizei von ihrer umfassenden und vorurteilsbehafteten Datensammelwut immer noch nicht lassen kann.
Auch sonst sind die Konsequenzen mager: vorübergehend wurden die verantwortlichen leitenden Beamten vom Dienst suspendiert, arbeiten aber mittlerweile weiter. 350.000 Schweizer stellten im vergangenen Jahr Antrag auf Auskunft über „ihre” Fi-chen. Von den 100.000, überdieetwas vorliegt, müssen noch immer viele warten. Laut „Komitee Schluss mit dem Schnüffelstaat”, werden keine Auskünfte über neu erstellte Fichen gegeben. Die Trennung zwischen Bundesanwaltschaft und Nachrichtendiensten - der Bundesanwalt ist auch Vorgesetzter der gerichtlichen und der politischen Polizei - werde vom Bundesrat nicht vorgenommen. Lediglich die Kompetenzen des Bundesanwaltes würden klarer umrissen.
Über eine parlamentarische Kontrolle werde noch diskutiert.
Die willkürlichen Datensammlungen stellen für Bewerber um Arbeit beim öffentlichen Dienst eine Bedrohung dar, da sie einer „Sicherheitsüberprüfung” unterzogen werden und die in den Fichen festgehaltenen Behauptungen nicht hinterfragt übernommen werden. Zum Beispiel reichte aus, als ein junger Jurist als Untermieter in eine Wohnung einzog, die Vorjahren als „linke Kommune” eingestuft wurde, daß der arbeitssuchen-de Mann bei Bundes- und Kantonsstellen immer Absagen erhielt.
Referendum gegen Schnüffeln
Bei den Quellen erwiesen sich die „Staatsschützer” einfallsreich:
Die Kartei der Kinderhilfe des Schweizerischen Roten Kreuzes landete vor etwa zehn Jahren in der Bundesanwaltschaft, 183.000 Karteikarten in sechs Hochschränken. Angeblich erwartete man sich Hinweise zu Spionagefällen.
Zwischen 1969 und März 1986 wurden mit Hilfe der Post systematisch die in die DDR aufgegebenen Telegramme erfaßt und in Zusammenarbeit mit dem bundesdeutschen Nachrichtendienst ausgewertet.
Durch formlose Auskünfte bei Kreispostdirektionen wurden Inhaber von Postfächern, Verfügungsberech-tige über Postscheck-Konten, Adressaten von Zeitungen und Zeitschriften sowie die Identität von Personen, die auf ein bestimmtes Postscheck-Konto Einzahlungen tätigten, erfaßt.
93 Beamte und 200 bei den kantonalen Nachrichtendiensten arbeiten für die politische Polizei. Laut Wirtschaftsmagazin „Cash” kosteten die Bespitzelungen in den letzten 40 Jahren inflationsbereinigt dem Steuerzahler ein Milliarde Franken.
Kein Wunder, daß das „Komitee Schluss mit dem Schnüffelstaat” Unterschriften für ein Referendum sammelt, das fordert, daß in die Bundesverfassung aufgenommen werde, daß niemand wegen der Wahrnehmung seiner politischen Rechte überwacht werden darf. Konsequenz soll die Abschaffung der politischen Polizei sein.
Die Gefahr der Versteinerung politischer Strukturen ist in allen Staaten ein Problem, das niemand wirklich zu lösen weiß. Seit 1959 sind in der Schweiz 80 Prozent der Wähler ununterbrochen in der Regierung repräsentiert.
Nach sechsjährigem freiwilligen Rückzug der Sozialdemokraten von der Regierung gilt in der Schweiz seit 1959 eine feste Verteilung des Bundesrates: Zwei Freisinnige, zwei Konservative, zwei Sozialdemokraten und ein Bauernvertreter. Alle referendumsfähigen politischen und wirtschaftlichen Gruppen haben sich ebenfalls weitgehend ins System integriert.
Die Folge sind oft mühselige Verhandlungen bei neuen Gesetzen. Die Ordnung der Bundesfinanzen beispielsweise schleppt sich seit dem Zweiten Weltkrieg von Provisorium zu Provisorium. Das Frauenstimmrecht auf eidgenössischer Ebene gelangte erst 1971, 123 Jahre nach der Einführung des allgemeinen und gleichen Wahlrechts für Männer, zum Durchbruch.
Um ein wenig von den komplizierten Mechanismen zu verstehen, müssen die Volksrechte ein bißchen genauer betrachtet werden: Gesetzgebungsbeschlüsse des Parlaments sind nicht definitiv, da die Bundesverfassung seit der Revision von 1874 das Volksrecht des Referendums kennt. Dem obligatorischen Referendum unterliegen sämtliche Verfassungsänderungen; über sie ist vor Inkrafttreten eine Volksabstimmung durchzuführen, wobei für die Annahme sowohl eine Mehrheit im ganzen Volk (Volksmehr) als auch eine Mehrheit der Kantone (Ständemehr) erforderlich ist. Auch im Sinne des Notrechts erlassene Bundesbeschlüsse, die nicht verfassungskonform sind, müssen späte-
Volksinitiativen wurden zum überwiegenden Teil verworfen oder zurückgezogen...stens ein Jahr nach ihrer Inkraftsetzung dem Volk zum Entscheid vorgelegt werden.
Dem fakultativen Referendum unterstehen die Bundesgesetze und allgemeinverbindlichen Bundesbeschlüsse sowie Staatsverträge mit dem Ausland, die unbefristet oder für die Dauer von mindestens 15 Jahren abgeschlossen sind. In diesen Fällen findet eine Volksabstimmung statt, sofern mindestens 50.000 Bürgerdas mit ihrer Unterschrift verlangen; nach der Verfassung können auch mindestens acht Kantonsregierungen das Referendum ergreifen, doch ist das in der Praxis noch nie vorgekommen. Für Abstimmungen nach dem fakultativen Referendum zählt nur das Volksmehr.
Seit 1981 enthält die Bundesverfassung auch das Initiativrecht des Volkes. Mindestens 100.000 Stimmberechtigte können mit ihrer Unterschrift eine ErgänzungderBundesverfassung oder die Aufhebung oder Abänderung eines Artikels vorschlagen. Dieses Volksbegehren (Initiative) muß von beiden Parlamentskammern behandelt und schließlich mit einer Empfehlung zur Ablehnung oder Annahme der Volksabstimmung unterbreitet werden. Das Parlament kann dazu auch einen Gegenvorschlag vorlegen.
Die Erfahrung zeigt, daß Volksinitiativen in der Abstimmung sehr selten angenommen werden, unter am derem, weil das Parlament mit einem Gegenvorschlag reagiert. Oft dient die Volksinitiative als politisches Faustpfand, mit dem die Initiatoren die Regierung und das Parlament dazu bewegen wollen, ihren Wünschen wenigstens teilweise in einem Gegenvorschlag entgegenzukommen. Bei der Abstimmung über eine Volksinitiative, die sich ja nur auf den Inhalt der Bundesverfassung beziehen kann, ist immer auch das Ständemehr für eine Annahme erforderlich.
Bei Durchsicht der Teilrevisionen der Bundesverfassung zeigt sich, daß seit 1874 Volk und Stände 114 Teilrevisionen angenommen und fast eben-soviele abgelehnt haben. Zahlreiche Teilrevisionen sind seit 1891 durch Volksinitiativen verlangt worden. Bis jetzt wurden 183 Verfassungsinitiativen eingereicht. In den Abstimmungen wurden sie allerdings zum überwiegenden Teil verworfen oder schon vorher zurückgezogen. Häufig ist bloß der Einfluß der Initiativen dadurch feststellbar, daß Bundesrat und Bundesversammlung sich zu Reformen aufgerafft haben, die nie oder später vorgenommen worden wären.
Die Zahl der Abstimmungsvorlagen war besonders in den fünfziger Jahren groß. Seit damals sinkt die Stimmbeteiligung der Bürger kontinuierlich. Selbst an Wahlen nahm 1979 erstmals weniger als die Hälfte der Stimmberechtigten teil, Dieses offensichtliche Sinken des Interesses der Teilnahme an politischen Entscheidungen ist ein Problem, das zu heftigen Diskussionen führte. Der 1969 gestorbene Staatsrechtler Max Imbo-den meinte einmal, daß die Schweiz im 18. Jahrhundert eine „revolutionäre Nation” gewesen sei: „Heute sind wireine derkonservativsten der Welt.”
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!