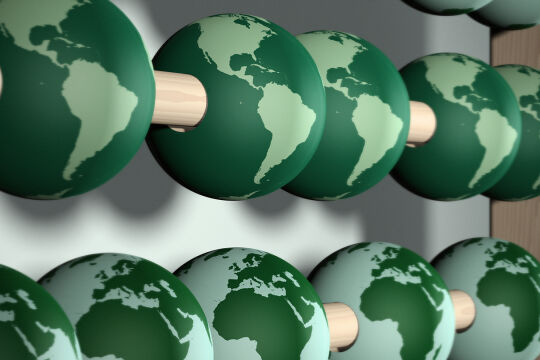"Die Idee des Guten Lebens vergessen"
Der Intellektuelle und ehemalige Energieminister Ecuadors Alberto Acosta über den Raubbau an der Natur, die Wirtschaftskrise seines Landes und die Politik vorgeblich linker Regierungen Mittel- und Südamerikas. Acosta sieht einen "rückwärtsgewandten Fortschritt".
Der Intellektuelle und ehemalige Energieminister Ecuadors Alberto Acosta über den Raubbau an der Natur, die Wirtschaftskrise seines Landes und die Politik vorgeblich linker Regierungen Mittel- und Südamerikas. Acosta sieht einen "rückwärtsgewandten Fortschritt".
Der frühere ecuadorianische Energieminister Alberto Acosta (66) ist einer der Verfechter des andinen Konzepts des "guten Lebens" im Gegensatz zur Wachstumsideologie. Er sieht die gegenwärtige Ölpreiskrise als verpasste Chance für sein Land, vom Rohstoffexport loszukommen und sorgt sich über die zunehmenden autoritären Tendenzen der linken Regierungen Lateinamerikas
DIE FURCHE: Herr Acosta, Sie sind ein Kritiker des Extraktivismus, der Ausbeutung der Rohstoffe als Wirtschaftsprinzip. Ist es eine gute Nachricht, wenn Ecuador durch den Ölpreisverfall in die Krise gerät?
Alberto Acosta: Es ist insofern eine schlechte Nachricht, als die Bevölkerung Ecuadors darunter leidet. So sehr ich die Regierung kritisiere, kann ich nicht darüber glücklich sein, dass sie durch die Krise geschwächt wird. Aber gleichzeitig ist es eine großartige Gelegenheit, auch einmal darüber nachzudenken, was der Extraktivismus für unsere Länder bedeutet. Ecuador ist in hohem Maße vom Öl abhängig. Wir haben im August 1972 begonnen, Erdöl zu exportieren. Jetzt nehmen die Reserven beschleunigt ab. Das Ende ist abzusehen. Aber 50 Prozent unserer Exporte sind Öl, etwa 30 Prozent der Steuereinnahmen kommen aus dem Ölgeschäft und 13 Prozent des Bruttonationaleinkommens. Wir sollten uns schleunigst aus dieser Abhängigkeit befreien. Aber was macht die Regierung: sie will den Bergbau im großen Stil fördern.
DIE FURCHE: Die Regierung sagt ja, die Wirtschaftsstruktur können wir nur verändern, wenn wir jetzt viel Geld einnehmen, ...
Acosta: Ja. Sie sagt, wir brauchen Extraktivismus, um vom Extraktivismus loszukommen. Zusätzliche Einnahmen würden in die Bildung investiert, in technologische Entwicklung, Infrastruktur und vor allem in den Sozialbereich. Das ist eine perverse Logik: eine Schlange, die sich in den eigenen Schwanz beißt. Ich denke, das ist nicht nur eine Illusion, sondern auch eine große Dummheit.
DIE FURCHE: Gibt es denn auch langfristig keine Strategie, vom Öl loszukommen?
Acosta: Ich möchte nicht leugnen, dass es in den letzten Jahren einige Investitionen im Energiebereich gegeben hat, vor allem für den Bau von Wasserkraftwerken. Wir exportieren ja Rohöl und müssen die raffinierten Derivate teuer importieren. Die mit Erdölderivaten getriebenen Kraftwerke sind nicht nur teuer, sondern auch extrem umweltschädlich. Jetzt wurde die Wasserkraft ausgebaut und wir werden enorme Energieüberschüsse erzielen. Aber die Regierung nützt sie nicht, um die Produktionsstruktur zu verändern, sondern sucht Wege, diese Energie zu konsumieren. Ecuador forciert jetzt die Benützung von Induktionsherden, um den Strom zu nützen. Das wäre eine perfekte Gelegenheit, unsere eigene Industrie zu unterstützen. Aber die Regierung importiert die 300.000 Herde lieber aus China und hat dafür eine Kreditlinie von 250 Millionen Dollar in Anspruch genommen. Aber das Thema ist viel komplexer, weil ein grosser Teil dieser neuen Energieinvestitionen darauf abzielt, die grossen Bergbauprojekte zu fördern. So hat der Bergbauminister angekündigt, die Energiepreise werden gesenkt, damit man große Bergbaukonzerne ins Land holen kann.
DIE FURCHE: Aber die Regierung will doch eine Industrie aufbauen.
Acosta: Ja, aber ihr schwebt das alte Muster von Schwerindustrie vor: Stahlproduktion, Werften. Man will sich am südkoreanischen Entwicklungsmodell orientieren. Aber das waren andere Zeiten. Deswegen spreche ich von einem rückwärtsgewandten Fortschritt. Wenn eine Regierung die Möglichkeit gehabt hätte, etwas zu verändern, dann war es die gegenwärtige von Präsident Rafael Correa.
DIE FURCHE: Südkorea begann doch auch mit einer Landreform und dem Aufbau einer Mittelklasse.
Acosta: Das passiert leider nicht. In Ecuador wurde zwar die Armut reduziert, was natürlich sehr gut ist. Aber es gibt keine Umverteilung des Reichtums. Was umverteilt wird, ist nur das zusätzliche Einkommen des Staates. Der Präsident glaubt nicht an die Landreform obwohl die Verfassung ihn dazu verpflichten würde. Die Landkonzentration ist enorm hoch. Kleinbauern, die etwa 60 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe ausmachen, verfügen nur über sechs p Prozent der Anbaufläche während fünf Prozent der größten Haciendas über 50 Prozent der Fläche kontrollieren. Noch krasser ist es mit dem Zugang zu Wasser. Ein Prozent der Betriebe verbraucht 64 Prozent des in der Landwirtschaft eingesetzten Wassers. Ecuador ist eines der letzten Länder des Kontinents, das ein Gesetz gegen monopolitische Marktkontrolle beschlossen hat. Ein einziger Konzern hält 81 Prozent des Marktes für Softdrinks, ein einziger Konzern kontrolliert 62 Prozent des Fleischmarkts. Zwei Firmen verkaufen über 90 Prozent des Speiseöls, fünf Zuckermühlen, die drei Familien gehören, versorgen 92 Prozent des Marktes. Die Regierung Correas spricht immer von der Revolution aber sie scheut vor einer Umverteilung zurück. Und das wäre die Voraussetzung, mit der Armut wirklich Schluss zu machen.
DIE FURCHE: Sie haben sich ja um die Präsidentschaft beworben. Wenn Sie die Macht hätten, was würden Sie anders machen.
Acosta: Es geht nicht darum, die Macht zu haben, sondern sie auszuüben. Und das bedeutet, konkrete Antworten auf die Bedürfnisse der Menschen zu geben. Wir brauchen Utopien und Visionen genauso wie diese konkreten Antworten. Da wäre die Landreform und die Umverteilung der Wasserreserven. Wir brauchen eine neue Bildungspolitik, die nicht so sehr am US-amerikanischen oder europäischen Modell orientiert ist. Wir müssen in Gesundheit investieren. Aber nicht so wie jetzt. Das meiste Geld landet bei den Pharmakonzernen und in den Privatkliniken. Die präventive Seite wird vernachlässigt. Es werden jetzt Strassen gebaut. Aber die verbinden die großen Städte. Wichtiger wäre die Stärkung der Gemeinden und Bezirke. Wir müssen dafür sorgen, dass die kleinen Gemeinden ihre Produkte zum Markt bringen können. Und die Ernährungssouveränität muss sichergestellt werden. Statt nur Megakraftwerke zu bauen, sollten wir Kleinkraftwerke für die lokale Versorgung fördern. All das erfordert mehr Demokratie und nicht weniger, mehr Bürgerbeteiligung statt mehr Zentralismus. Zuallererst muss man die Unabhängigkeit der Staatsgewalten wiederherstellen. Präsident Correa kontrolliert nicht nur Exekutive und Parlament, sondern auch die Justiz, die Nationale Wahlkommission und den Verfassungsgerichtshof.
DIE FURCHE: Correa wurde mit der massiven Unterstütung der Basisbewegungen gewählt. In letzter Zeit hat er sich aber mit der Indigenenorganisation CONAIE und anderen Bewegungen angelegt. Warum?
Acosta: Im Grunde geht es um den Aufbau eines totalitären Systems. Präsident Correa will die Bewegungen kontrollieren. Deswegen versucht er sie zu spalten. Wenn das nicht funktioniert, dann gründet er Parallelorganisationen, die ihm gehorchen.
DIE FURCHE: Kann Correa als linksgerichteten Präsident bezeichnen?
Acosta: Nein, auf keinen Fall. Hinter seinem progressiven Diskurs steckt ein zutiefst konservatives Weltbild. Er hat eine Diskussion über die Abtreibung und die Anerkennung der Homoehe verhindert. Die Familienpolitik überläßt er indirekt dem Opus Dei. Jetzt gibt es eine Kampagne, die Frauen verbieten soll, vor Abschluss eines Studiums Sex zu haben. Am Sonntag darf man keinen Alkohol verkaufen. Die Freiräume werden immer enger. Auch für die Presse. Es wurde sogar ein Comic des Wikingers Hägar verboten. (Die Bildergeschichte, in der Hägar seine Frau als "Chef" anredet, wurde als sexistisch eingestuft)
DIE FURCHE: Fast alle der linken Regierungen in Lateinamerika zeigen ja autoritäre Tendenzen.
Acosta: Ich würde die Frage stellen, ob es wirklich linke Regierungen sind. Die Regierungen von Ecuador, Venezuela oder Bolivien sind zwar nicht neoliberal im traditionellen Sinn aber auch nicht links. Ich würde sie als fortschrittlich bezeichnen. Aber sie sind der Logik des Wirtschaftswachstums verhaftet und haben die Gedanken des "Guten Lebens" vergessen. Im Grunde betreiben sie nur eine moderne Form des Kapitalismus. Gleichzeitig zeigen sie sich immer intoleranter. Und es entstehen neue Caudillos, starke Männer. Dabei wäre es eine Aufgabe der Linken, den Caudillismo zu bekämpfen.
DIE FURCHE: Eine Kombination der sozialen Gerechtigkeit mit bürgerlichen Freiheiten bleibt Utopie?
Acosta: Das wäre der richtige Weg. Wir müssen aufhören in zentralstaatlichen Kategorien zu denken. Statt starker Männer brauchen wir kollektive Führungen. Ich kann da nur zitieren, was der bolivianische Präsident Evo Morales sagt, aber leider nicht befolgt: "im Dienen regieren".


















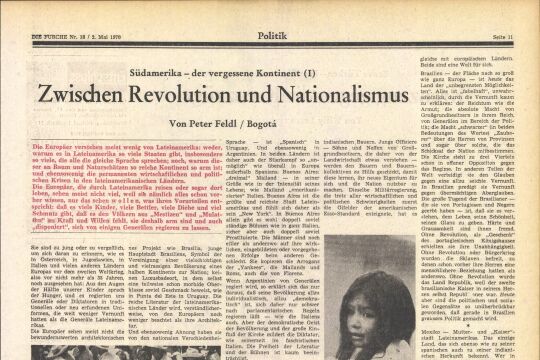




























.jpg)