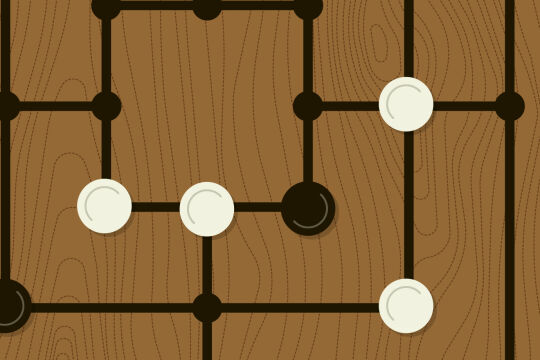Das Projekt eines Hauses der österreichischen Geschichte scheitert trotz mehrjähriger Planungen bisher an den Konflikten zwischen den Parteien. Der Politikwissenschafter Anton Pelinka begründet, warum sich die Politik stärker der Geschichte stellen sollte und was daraus zu lernen wäre.
Das Haus der Geschichte ist und bleibt vorerst nur Projekt. Gutteils deswegen, weil die Parteien nicht zu einer übereinstimmenden Geschichtsschreibung finden können.
Die Furche: Glauben Sie, wird es in naher Zukunft ein Haus der Geschichte in Wien geben?
Anton Pelinka: Lassen Sie es mich so sagen: Ich kann es nicht ausschließen. Mir fehlt aber ein Zeichen, dass es wirklich entschiedenen politischen Willen dazu gibt. Es fehlt ja auch eine eindeutige Basis der Wissenschaft. Die Zeiten sind auch nicht günstig, um für die entsprechende Budgetierung zu sorgen. Wenn man über die Medien einen Druck organisieren würde, der eben nicht schwarz oder rot, sondern rot-weiß-rot ist, könnte ich es mir aber vorstellen.
Die Furche: Warum wollen und wollten die zwei Großparteien nicht?
Pelinka: Wenn ich mich hineinversetze in den Parteivorsitzenden der SPÖ oder den Parteiobmann der ÖVP, dann kommt jedes Mal, wenn sie mit dem Projekt konfrontiert sind, einer aus den eigenen Reihen daher und sagt: Das ist ein Blödsinn, da stecken die anderen dahinter, die wollen dich über den Tisch ziehen. Das passiert ja ständig. Dann wird der sagen: Warum soll ich mich dafür einsetzen? Das kostet nur Geld und ich muss mit dem Finanzminister raufen.
Die Furche: Gleichzeitig beklagen die Parteien, dass ihre Wähler Halt und Identität verlieren. Die SPÖ gibt dafür der sozialen Politik des bürgerlich konservativen Lagers die Schuld. Kann man diese Tendenz mit der fehlenden Bewusstseinsbildung eines Museums, das es nicht gibt, in Verbindung bringen?
Pelinka: Nicht primär, aber als Teil von sekundären Faktoren. Die Parteien richten sich bequem im Heute ein und übersehen, dass man auch an morgen denken muss, indem man das Gestern in die Planung einbezieht. Die Sozialdemokratie zum Beispiel hätte erkennen müssen, dass die Vorstellung, aus der Arbeiterschaft kämen immer die progressiven Vorstöße, auch historisch eine grobe Vereinfachung war. Man hat in der Sozialdemokratie lange nicht ernsthaft diskutiert, dass und warum so viele ehemalige Sozialdemokraten Nationalsozialisten geworden sind. Und dann ist man plötzlich erstaunt – obwohl ich das nicht gleichsetzen würde, aber Analogien sehe –, dass viele junge männliche Arbeiter freiheitlich wählen.
Die Furche: Sie sehen also eine Verbindung?
Pelinka: Ganz gewiss. Wobei natürlich das, was man einmal Arbeiterklasse nannte, gerade in Europa zerbröselt. Weil die Industrie im Zuge der Globalisierung zunehmend ausgelagert wird. Ich glaube, die Analyse der Geschichte ist Teil einer Notwendigkeit, um langfristige Prozesse auszumachen, und dem weichen die Parteien aus. Weil es unangenehm wäre und die Fixierung auf den nächsten Wahltermin stören könnte.
Die Furche: Ist es ein Risiko für den politischen Prozess, ein nationales Museumsprojekt so lange schleifen zu lassen?
Pelinka: Natürlich nicht im unmittelbaren Sinne, dass gleich etwas explodieren könnte. Aber schauen Sie sich an, mit welcher Selbstverständlichkeit 2005 von vielen gesagt wurde, Österreich habe vor 50 Jahren seine Unabhängigkeit bekommen. In Wahrheit war es vor 60 Jahren, als die Unabhängigkeit erklärt wurde. So zu reden heißt der Vorgabe zu folgen, 1955 sei ein unkontroversielles Jahr, und 1945 ein sehr kontroversielles gewesen. Die entscheidende Weichenstellung für die österreichische Demokratie war aber 1945, und dem weicht man aus. Weil ein Teil der Gesellschaft, nämlich der, der sich mit dem Nationalsozialismus identifiziert hat, sozusagen ausgeschlossen war. Da reißen dann solche Vorstellungen ein und die schleift man mit. Wir sehen das auch an der Deserteursfrage, die im Sinne der Unabhängigkeitserklärung erst geregelt wurde, kurz bevor der letzte Deserteur gestorben ist.
Die Furche: Der Nationalsozialismus bedingt also immer noch reale Konflikte?
Pelinka: Natürlich. Wenn man davon ausgeht, wie rasch hier ehemalige Nationalsozialisten wieder in Führungspositionen gekommen sind – im Widerspruch zur von der Regierung ab 1945 beanspruchten Opferthese. Diesen Widerspruch aufzuzeigen, müsste Gegenstand eines Hauses der Geschichte sein.
Die Furche: Die Parteiengeschich-ten ebenfalls?
Pelinka: Bestimmt. Die Republik Österreich wurde ja zweimal von Parteien gegründet. Das heißt, die Parteien haben ihren Staat gemacht. Das war ja zumindest für die Zeit nach 1945 auch eine Erfolgsgeschichte. Aber das Abschneiden von historischen Wurzeln führt zu einer Blindheit für die Entwicklungen der Zukunft.
Die Furche: Haben Sie, seit Sie auf Bitten von Wissenschaftsminister Caspar Einem 1999 ein Konzept für ein „Haus der Toleranz“ vorgelegt haben, die Debatte um das Haus der Geschichte verfolgt?
Pelinka: Nein, seit damals bin ich ja völlig draußen. Weil man, um das Projekt fertigzumachen, es – entgegen der Position der Autoren und meiner Position als Projektleiter – als rotes Projekt hingestellt hat. Durch diese böswillige Etikettierung bin ich draußen. Ich bin aber nicht böse, es hat mir gereicht. Der politische Beschuss hätte mich noch am wenigsten gestört, damit musste ich rechnen. Aber es haben auch Kollegen, die nur, weil sie nicht dabei waren, das Projekt schlechtgemacht.
Die Furche: Ähnliche Klagen kommen von der Gegenseite, etwa von Manfried Rauchensteiner.
Pelinka: Das glaube ich ihm gerne. Es machen sich die Kollegen untereinander fertig und verwenden dann vorgeschützte Argumente wie diese Farbenlehre, die man dann drüber streut. Das, was man Scientific Community nennt, ist in Österreich in nicht sehr guter Verfassung. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es anderswo viel besser ist.
Die Furche: Haben sich in den Grabenkämpfen der Historiker die politischen Fronten verlängert?
Pelinka: Teilweise gab es Zuordnungen aus politischen Gründen, dann solche, die missbräuchlich vorgenommen wurden, um jemanden in ein Eck zu stellen. Und dann gibt es immer wieder diese Punkte. Allein schon die Beurteilung des Dollfuß-Regimes ist entgegen dem, was die Forschung völlig klar darlegt, noch immer etwas, bei dem Wissenschaftler unversöhnt auseinandergehen können, was ich für intellektuellen Unfug halte. Da ist eigentlich alles klar.
Die Furche: Die Politiker schaffen das noch viel weniger.
Pelinka: Von den Politikern würde ich mir nur erwarten, dass sie auf Druck reagieren und Dinge aufgreifen. Ich erwarte mir von keinem Bundeskanzler, Wissenschaftsminister oder sonst jemand, dass er von sich aus Impulse setzt. Er soll nur sensibel sein.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!