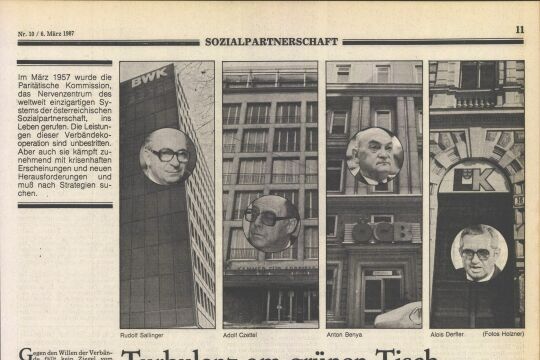Der Umbau des Sozialstaats ist politische Schwerarbeit. Deren Notwendigkeit steht außer Zweifel. Den damit verbundenen heiklen Fragen gingen Experten im Rahmen der Alpbacher Reformgespräche nach.
Ein frecher Diebstahl in dem sonst so friedlichen Tiroler Bergdorf hat die Organisatoren des Europäischen Forum Alpbach verärgert: Zwei Fahnen sind verschwunden, von den Langfingern keine Spur. Die Diebe haben sich an der spanischen und der französischen Flagge vergriffen. Dabei sollen doch über der Konferenz die Fahnen aller am Forum vertretenen Länder wehen. Um die Gemeinschaft zu symbolisieren, in der seit 59 Jahren jeden Sommer angeregt diskutiert wird.
Soziale Identitätsfrage
Fahnen sind jedoch auch Zeichen der Abgrenzung nach außen, der Identität aller unter demselben Banner Vereinten. Was aber, wenn zur nationalen noch eine überregionale Identität kommt? Wenn eine Flagge 15 Banner verbindet? Dann steht die eigene Identität im Spannungsfeld zwischen Nation und Union. Was beim Europäischen Forum Alpbach anhand der Frage nach dem Sozialstaat deutlich illustriert wurde: Gibt es ein europäisches Sozialmodell oder sind es deren 15?
Unbestritten existieren vor allem im Grundgedanken Gemeinsamkeiten in den EU-Ländern: Der Staat soll soziale Unterschiede in einem gewissen Maß ausgleichen, vor finanziellen Auswirkungen von Arbeitslosigkeit, Krankheit und Alter schützen und so die Unzulänglichkeiten einer freien Marktwirtschaft kompensieren.
Durch die sozial ausgestaltete Politik in den EU-Staaten wurde die Armut zu einem großen Teil zurückgedrängt: Wäre etwa in Belgien der Lebensstandard ausschließlich vom selbst erwirtschafteten Einkommen jedes Einzelnen abhängig, würden 40 Prozent aller Haushalte unter der Armutsgrenze leben, dank der Umverteilung von Reich zu Arm sind es nur etwa sieben Prozent. Ein Beispiel, das in dieser Größenordnung auf alle EU-Länder zutrifft.
Ganz anders das wirtschaftsliberale Modell der USA, das vor allem auf Eigenverantwortung basiert. Es gibt nur sehr beschränkte staatliche Interventionen, die soziale Sicherung ist weitestgehend den Bürgern selbst überlassen. Als Folge leben 18 Prozent der amerikanischen Bevölkerung unter der Armutsgrenze, einige Millionen haben keine Krankeversicherung und müssen im Notfall das Geld für medizinische Betreuung selber auftreiben. Dadurch werden die Staatsfinanzen deutlich weniger belastet: Die USA geben nur 15 Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes (BIP) für Soziales aus, im EU-Durchschnitt sind es 28,5 Prozent. Österreich liegt mit 29,1 Prozent darüber, Finnland wendet sogar 35 Prozent auf.
Die zentrale Idee der staatlichen Armutsvermeidung durch Umverteilung eint also die Europäer, was sich in manchen Meinungen als Beleg für die Existenz eines europäischen Sozialmodelles niederschlägt. Wie diese Armutsvermeidung jedoch erreicht wird, ist höchst unterschiedlich und hängt stark von den jeweiligen Traditionen der einzelnen Staaten ab.
"Der entscheidende Faktor in der Sozialpolitik ist der Arbeitsmarkt", erklärt Jos Berghman, Professor für Sozialpolitik an der belgischen Universität Leuven. Daran, wie in den einzelnen Ländern mit dem Problem der Arbeitslosigkeit umgegangen wird, erkennt Berghman daher drei unterschiedliche europäische Modelle: Im skandinavischen bestehen die Hauptaktivitäten des Staates darin, durch Aus- und Weiterbildung die Betroffenen wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Ein Einkommen ohne Erwerbstätigkeit ist dagegen ein Charakteristikum des kontinentalen Modells, etwa in Österreich und Deutschland, weniger ausgeprägt in Italien. Das atlantische Modell in Großbritannien wiederum stellt nur eine minimale soziale Versorgung sicher.
Auch die Entscheidungsfindung in den einzelnen Formen ist unterschiedlich: Während laut Berghman in der skandinavischen Tradition die Sozialpartner gemeinsam mit den staatlichen Entscheidungsträgern die Regeln festlegten, sei in Großbritannien das Verhältnis zwischen Staat und Bürgern von zentraler Bedeutung, im kontinentalen System übernähmen die Sozialpartner die Schlüsselrolle.
Was allen Modellen gemeinsam ist: Die Finanzierung wird zunehmend schwieriger, vom Ende des Wohlfahrtsstaates ist die Rede. Vor allem das Altern der Bevölkerung und die Notwendigkeit, im internationalen Wettbewerb zu bestehen, machen ein Nachdenken über Sinn und Ausprägung des Sozialstaates nötig. Brüche in den Traditionen seien notwendig, um die Finanzierbarkeit und somit die Kontinuität der sozialen Sicherheit zu gewährleisten, hieß es in Alpbach.
Reformhindernisse
Bernd Schilcher, Aufsichtsratsvorsitzender der Steiermärkischen Krankenanstalten GmbH (KAGes) ist aber nicht sehr zuversichtlich: Der notwendige Rückbau des Wohlfahrtsstaates in Österreich und Deutschland sei eine Herkulesarbeit mit Sisyphos-Zügen. "Denn die Barrieren liegen im Kopf und im Bauch, und dort sind sie am schwersten zu überwinden." Und auch Jos Berghman ortet im hiesigen Modell Reformhindernisse: "Während in Großbritannien und den skandinavischen Ländern ein nicht so breiter Konsens nötig ist, haben kontinentale Systeme wie Österreich mit ihren starken Sozialpartnern mehr Schwierigkeiten, Veränderungen herbeizuführen."
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!