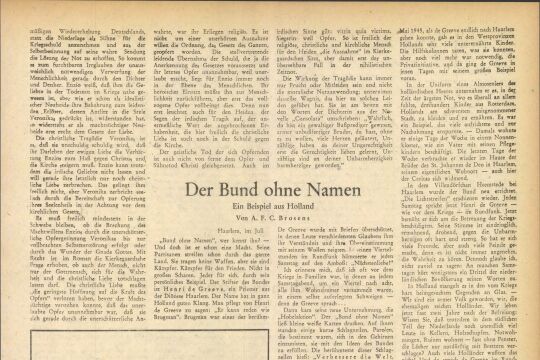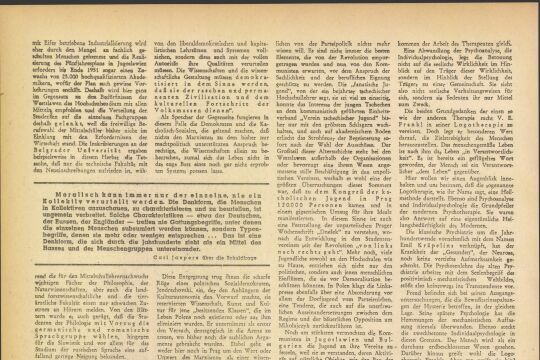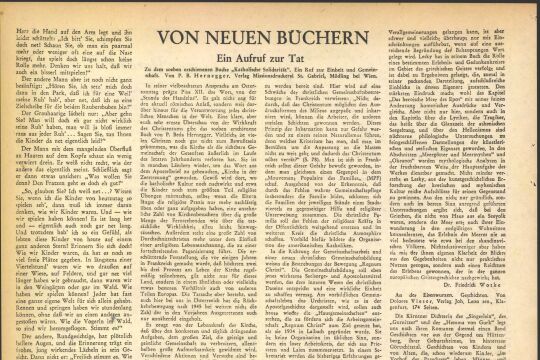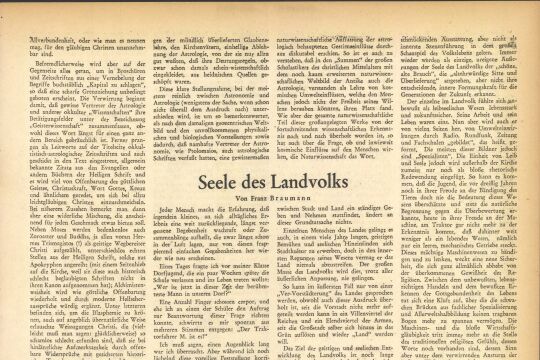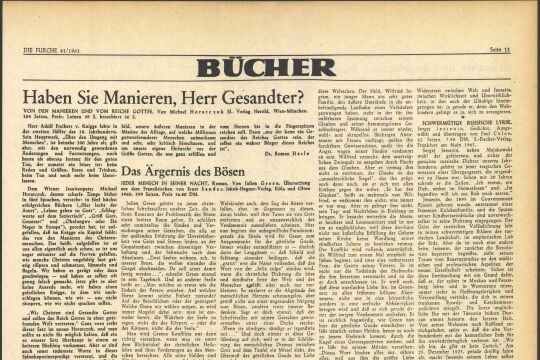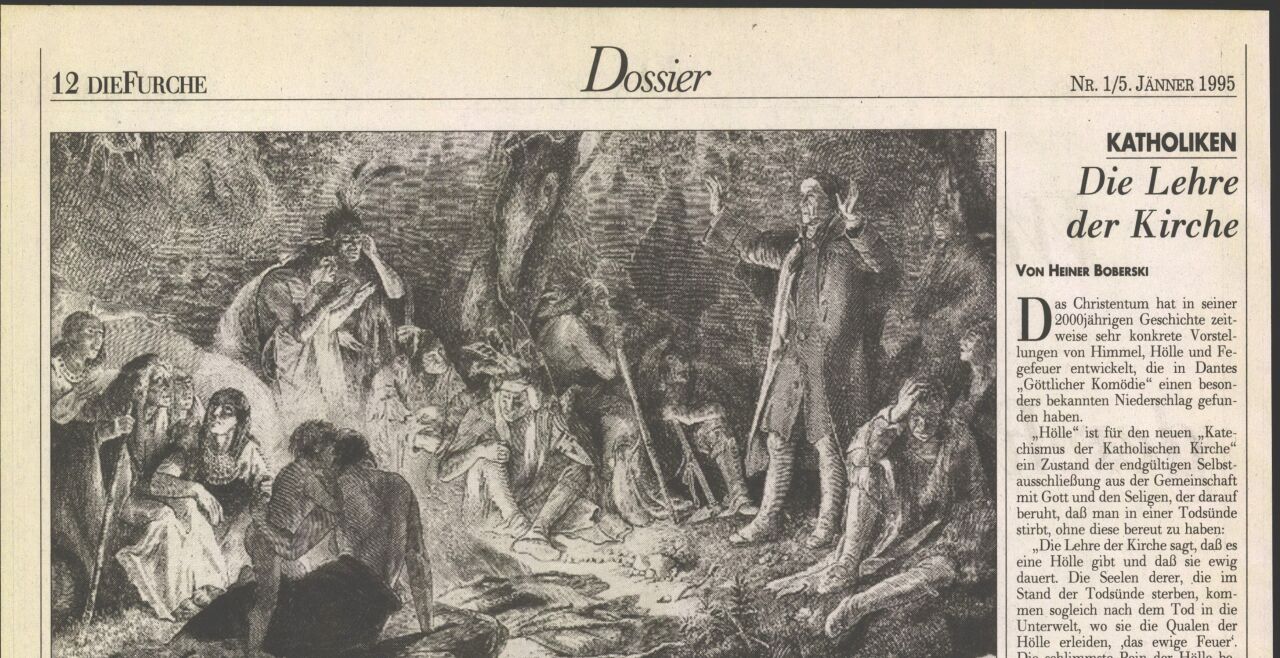
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Ethik ist kein Kriterium
Von Begräbnisriten, nicht von einem Gericht hängt es nach indianischen Vorstellungen ab, ob die Seele eines Verstorbenen Ruhe findet.
Von Begräbnisriten, nicht von einem Gericht hängt es nach indianischen Vorstellungen ab, ob die Seele eines Verstorbenen Ruhe findet.
Stärker noch als in den Hochkulturen kann man im Rereich der Stammesreligionen beobachten, wie die irdischen Verhältnisse das Jenseitsbild prägen. Soweit einzelne Ethnien oder Stämme in ihren kulturellen, ökologischen und gesellschaftlichen Lebensbedingungen vergleichbar sind, zeigen auch ihre Vorstellungen vom Jenseits und damit verbundene Kultpraktiken weitgehend Analogien.
Ackerbau treibende Stämme zeigen ihre Erdverbundenheit durch ein Erdbegräbnis, Jägervölker tendieren stärker zu der mit der Idee einer Wiederverkörperung verbundenen Leichenaussetzung. Gelegentlich korreliert damit die Lokalisierung des Jenseits. Der Erde verbundene Ethnien suchen es unter der Erde, Jägerstämme häufiger am Himmel. Gilt eine spezielle Himmelsrichtung als Ort des Jenseits, sind damit häufig Ursprungssagen des Stammes verknüpft: Man ist einstmals von dort gekommen und demzufolge werden die Toten dorthin zurückkehren. Das Jenseits selbst ist idealisiert: Die Ojibwa sprechen vom „Land des Friedens”, für andere nordamerikanische Indianer sind es die „ewigen (und ertragreichen) Jagdgründe', die Maya sehen es als Ort, an dem es nie des Grundnahrungsmittels Mais mangelt.
Ab dem Zeitpunkt des Todes existiert eine der meist mehreren unterschiedlichen Seelen in einem „Zwischenreich”, wo sie den Weg ins Jenseits gehen muß, der von gefährlichen Bewährungsproben gekennzeichnet ist: Die Seele wird von schönen Frauen vom Weg weggeführt, Geistwesen laden zum Verweilen bei einem Festmahl, Schlangen oder Raubtiere versperren den Weg, ein reißender Fluß ist zu überqueren. Dabei handelt es sich allerdings nicht um ein „Gericht” über den Toten. Ob man die Gefahren überwinden kann, hängt vielmehr von den richtig ausgeführten Begräbnisritualen der Hinterbliebenen ab; deren Unterlassung verhindert den Eintritt ins Totenreich. Wer einen gewaltsamen Tod erlitten hat oder wessen Tod unbemerkt bleibt, für den ist der Weg kaum zu bewältigen. Solche Verstorbene kehren als Wiedergänger oder Totengeister in die Welt zurück, wo sie die Lebenden schädigen können.
Hier findet man einen klaren Unterschied zum Christentum: Die erste Etappe des Jenseits ist insofern vom Diesseits abhängig, als die irdischen Beziehungen weiterwirken. Ein Übeltäter, der aus seiner Gemeinschaft ausgestoßen worden ist und somit eine innerweltliche Vergeltung seiner Vergehen bereits erfahren hat, wird zwar im Jenseits dafür nicht bestraft. Da für ihn aber - aufgrund seines sozialen „Todes” -keine Begräbnisriten durchgeführt werden, ist sein Schicksal nach dem Tod nachhaltig davon betroffen. Dieses Verhalten ist freilich zwiespältig, da ja in der Regel die Lebenden vom nichtversorgten Toten betroffen und gefährdet werden können, weshalb man aus Eigennutz letztlich auch Feinde begräbt.
Todesart wirkt nach
Die eigentliche Existenz im Jenseits ist primär eine Widerspiegelung der Art des Lebens,und des Todes. Besondere Todesarten wirken sich auf das Schicksal im Jenseits positiv aus, zum Beispiel haben Frauen, die im Kindbett sterben, bei den Eskimo oder Azteken ein besseres Jenseitsgeschick. Weithin wird der Tod als Krieger im Kampf dem Sterben als kranker und altersschwacher Mensch vorgezogen. Neben der Todesart ist auch der soziale Status zu Lebzeiten für das Schicksal nach dem Tod ausschlaggebend. Die Verwandtschaftsbande bleiben bestehen, man wohnt im Jenseits sippenweise, wobei hierarchische Unterschiede weiterbestehen.
Dieses Jenseitsschicksal gilt in all jenen Fällen, in denen die Todesart keine besondere Qualifikation des Lebens im Jenseits bringt. Dann gräbt man weiter nach Yams und Maniokwurzeln, kultiviert Mais, fängt Fische oder geht auf die Jagd -allerdings mit besseren Erfolgen als zu Lebzeiten. Ethische Kriterien spielen dabei für die Existenz nach dem Tod nur eine marginale Rolle: Ansatzhaft kommt Ethisches bei den Ojibwa zum Tragen, wenn es heißt, daß nur die Guten im „Land des Friedens” glücklich leben, während die Bösen dort Leid erleben.
Selbst für die Hochkulturen der Azteken, Maya oder Inka ist es fraglich, ob das Jenseitsschicksal von der Ethik abhing. In manchen Texten der spanischen Eroberer heißt es zwar, daß die Lebensweise ein besseres oder schlechteres Schicksal im Jenseits bestimmt, doch liegen hier christliche Verständnismuster der Beschreibung zugrunde. Die marginale Rolle der Ethik kann man somit als weiteren wichtigen Unterschied zur christlichen Sicht des Jenseits festhalten.
Das Leben nach dem Tod ist im Bereich der indianischen Stammesreligionen weitgehend eine jenseitige Fortsetzung irdischer Gegebenheiten. Daß es sich dabei um einen Ort der Strafe beziehungsweise Belohnung handelt, kommt in diesen Glaubensvorstellungen nur am Rand zum Tragen. Dennoch weiß man, daß die Kontinuität zwischen Lebenden und Toten eine trügerische ist, auch wenn im indianischen Katholizismus Lateinamerikas zu Allerheiligen (todos santos) die Verstorbenen das Leben und die Gesellschaft einen Tag lang bestimmen.
Der Autor ist
Assistenz-Professor für Religionswissenschaft an der Universität Graz.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!