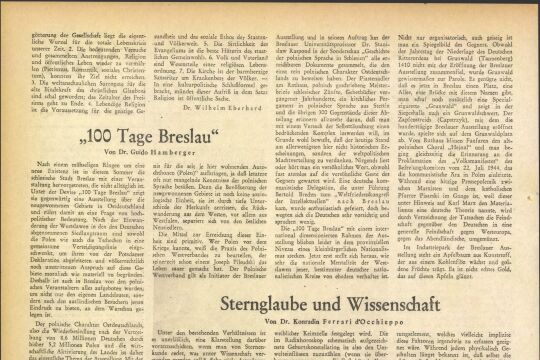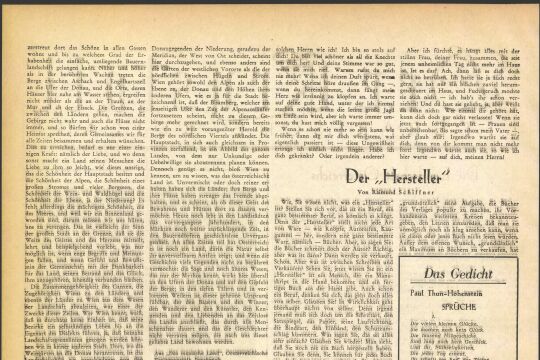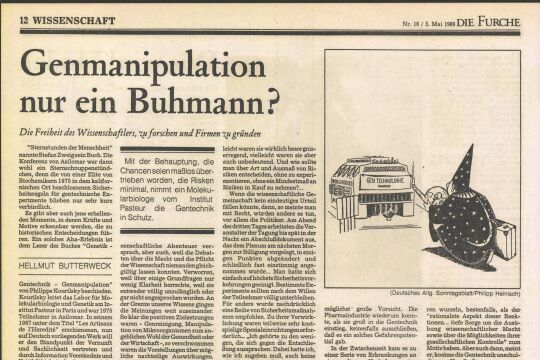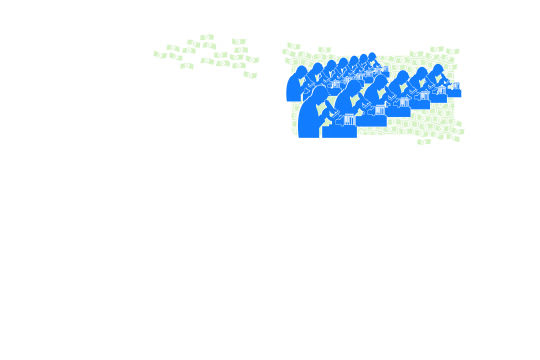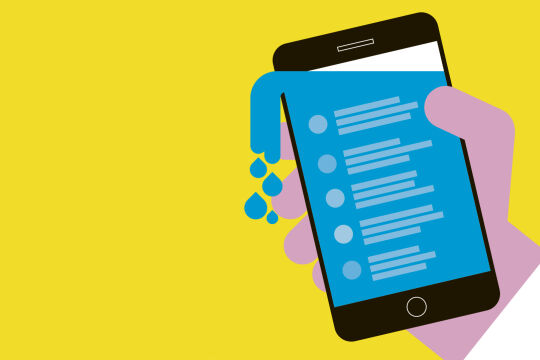Plagiat: Das Wissen der anderen
Ein Plagiat ist nicht nur wissenschaftlicher Betrug, sondern auch Selbstbetrug – eine Lebenslüge, die Diebe geistigen Eigentums jahrzehntelang begleitet. Anekdotensammlung aus dem akademischen Alltag.
Ein Plagiat ist nicht nur wissenschaftlicher Betrug, sondern auch Selbstbetrug – eine Lebenslüge, die Diebe geistigen Eigentums jahrzehntelang begleitet. Anekdotensammlung aus dem akademischen Alltag.
Wenn es um das Thema Plagiat geht, kann ich nach mehr als drei Jahrzehnten an mehreren Universitäten in verschiedenen Ländern stundenlang Anekdoten erzählen. Etwa von der Studentin, die jeden Verdacht des Plagiats entrüstet von sich wies: Das könne nicht sein, da das Kapitel ihr Freund geschrieben habe. Oder von jenem Doktoranden, der auch im dritten Anlauf an Plagiat scheiterte, beim letzten Mal als Teil einer Stille-Post-Kette, die sich von einer Hamburger Diplomarbeit über Stationen in Düsseldorf und Konstanz schließlich als Theoriekapitel in seiner Abhandlung wiederfand.
Da war auch die Studentin, die seitenweise von „Wikipedia“ ohne Nachweis und mit der Begründung abschrieb, dass sei ja keine wissenschaftliche Quelle, da dürfe man das. Besonders irritierend war eine Kandidatin, die mit derselben plagiatsverseuchten Arbeit schon einen Titel erworben hatte und dem einen zweiten im Nachbarfach hinzufügen wollte. Zum Selbstbetrug wurden Fälle, wo zum Beispiel Habermas oder ein Schweizer Managementguru ausgiebig abgekupfert wurden, ohne dies zu bemerken, da jeweils aus Texten geklaut worden war, die ihrerseits keine Fundstellen nachwiesen. Schon tolldreist ist ein Fall, den mir neulich ein Kollege berichtete: Da fanden sich in einem Promotionsvorschlag zum Thema Plagiat plagiierte Stellen.
Die wenigstens, die erwischt werden, geben den Tatbestand auf Anhieb zu. Aber nicht alle gehen so weit wie jener Student, der absolut nicht verstehen wollte, wie es für lange Passagen einen weitgehend wortidenten älteren Text geben könne. Der sei ihm nicht bekannt, sonst hätte er den im Literaturverzeichnis angeführt. Manche reden sich darauf hinaus, niemand habe ihnen die Regeln wissenschaftlichen Schreibens richtig erklärt.

Liebe Leserin, lieber Leser,
diesen Text stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung. Im FURCHE‐Navigator finden Sie tausende Artikel zu mehreren Jahrzehnten Zeitgeschichte. Neugierig? Am schnellsten kommen Sie hier zu Ihrem Abo – gratis oder gerne auch bezahlt.
Herzlichen Dank, Ihre Doris Helmberger‐Fleckl (Chefredakteurin)
diesen Text stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung. Im FURCHE‐Navigator finden Sie tausende Artikel zu mehreren Jahrzehnten Zeitgeschichte. Neugierig? Am schnellsten kommen Sie hier zu Ihrem Abo – gratis oder gerne auch bezahlt.
Herzlichen Dank, Ihre Doris Helmberger‐Fleckl (Chefredakteurin)
Das ist natürlich blanker Unsinn. Man lernt schon in der Volksschule, dass Abschreiben nicht gilt. Zudem verfolgt niemand den bedauernswerten Fall, bei dem in der Abschlusshektik ein paar Anführungsstriche verlorengegangen sind. Oft habe ich den Betreffenden anfangs nur einzelne Beispiele aus ihrer Arbeit gezeigt. Die wurden dann als bedauerliche Versehen verteidigt. Erst wenn weitere Beispiele nachgelegt wurden, kamen irgendwann ein Eingeständnis und eine mehr oder weniger plausible persönliche Geschichte. Die Betreffenden wussten durchweg genau, dass das, was sie getan hatten, ein Betrugsversuch war.
All diese Geschichten gehören zum akademischen Alltag. Schätzungen zur Prävalenz bewegen sich je nach untersuchtem Bereich zwischen einstelligen und mittleren zweistelligen Prozentanteilen. Ich selbst habe in mehr als dreißig Jahren kaum ein Semester ohne Fall erlebt. Mein Fach ist dabei nicht speziell gefährdet. Der Forschungslage nach gibt es nichts, was darauf hindeutet, dass zum Beispiel naturwissenschaftliche Fächer weniger anfällig für Plagiate oder andere Formen wissenschaftlicher Täuschung seien als geistes- oder sozialwissenschaftliche. Mit fortschreitender akademischer Karriere scheint jedoch die Wahrscheinlichkeit für Plagiat abzunehmen, Seminar- oder Bachelorarbeiten sind etwa eher betroffen als Dissertationen. Das kann aber nicht wirklich beruhigen: Ich bin zurzeit mit einem Fall an einer anderen Universität beschäftigt, wo in einer Habilitation seitenlang abgeschrieben wurde. So etwas sollte nicht auch noch eines Tages mit einer Professur belohnt werden.
Die so oft beschworene Software ist nur bedingt hilfreich. Am besten funktioniert sie bei dummdreisten Fällen.
Plagiate in Hochschulschriften sind kein neues Phänomen. Die gibt es zumindest, seitdem es akademische Qualifikationsarbeiten im modernen Sinne gibt, also seit mehr als zweihundert Jahren. Plagiate sind wie andere akademische Hochstapelei (frisierte Daten, fingierte Quellen, erfundene Evidenz) Kollateralschäden einer meritokratischen Gesellschaft, die den versprochenen Aufstieg durch Bildung an formale Graduierungen bindet.
Vergleichsuntersuchungen zufolge kann man noch nicht einmal behaupten, dass solche Plagiate heute wahrscheinlicher als früher seien. Insgesamt sind die Maßstäbe und Kontrollen eher strenger geworden. Allenfalls kann man vermuten, dass durch das Internet die Formen des Plagiierens vielfältiger geworden sind, aber auch die Chancen, solches zu entdecken und an die Öffentlichkeit zu bringen.
Wenn wieder ein Plagiatsfall öffentlich ruchbar geworden ist, ist man schnell dabei, die jeweilige Betreuung verantwortlich zu machen und nach geeigneter Software für die Plagiatserkennung zu rufen. Beides ist irreführend. Selbst die Belesensten eines Faches können nicht sämtliche Texte ihres Fachgebietes so gut auswendig können, dass ihnen Textgleichheiten automatisch auffallen müssten. Allein in meinem Spezialgebiet erscheinen jedes Jahr hunderte Beiträge mit vielen tausend Seiten. Da gerät man in Gefahr, Versuche zu übersehen, eine schwedische Abhandlung einzudeutschen oder eine Kölner Diplomarbeit auf Wiener Verhältnisse umzudichten. Bei sehr engen Betreuungsverhältnissen in wissenschaftlichen Projekten sind solche Plagiate eher unwahrscheinlich. Aber bei der Vielzahl von Betreuungen, die man an der Massenuniversität übernehmen muss, gilt es auch, viele Arbeiten zu betreuen, denen man nicht genauso eng folgen kann.
Man bleibt erpressbar
Die so oft beschworene Software ist nur bedingt hilfreich, wie die international führende Berliner Plagiatsexpertin Debora Weber-Wulff wiederholt experimentell belegt hat. Es gibt reichlich falsche Anzeigen und übersehene Plagiate. Am besten funktioniert solche Software bei dummdreisten Fällen, bei denen längere Passagen ohne jede Änderung aus leicht zugänglichen Quellen kopiert wurden. Bei geschickterem Vorgehen oder schwierig auffindbarem Material nutzt solche Software nichts.
Ich hatte einmal einen Fall, der zwischen sprachlich stümperhaften Eingangs- und Schlusssentenzen mit zum Teil glänzender Wissenschaftsprosa aufwartete. Die Plagiatssoftware hatte keine Einwände. Nur einem Zufall war die Entdeckung zu verdanken, dass viele Teile noch nicht veröffentlichten Beiträgen zu einem wissenschaftlichen Kolloquium eines anderen Instituts entnommen waren. Es ist im Übrigen nicht schwierig zu lernen, wie man die Software umgehen kann, und online verfügbare Programme helfen dabei, so lange zu optimieren, bis keine Kontrollsoftware mehr anschlägt – auch bei umfangreichem Plagiat. Gute Ghostwriter wissen das zu schätzen.
Dass Plagiat nicht immer sofort aufgedeckt wird, bedeutet noch nicht, dass es erfolgreich ist. Man bleibt ein Leben lang gefährdet, wenn nicht gar erpressbar. Noch Jahre und Jahrzehnte später kann man die zu Unrecht erworbenen Titel verlieren. Dadurch, dass immer mehr ältere Quellen online zugänglich werden, geschieht das auch. Irgendwann werden Überprüfungen mithilfe „künstlicher Intelligenz“ noch mehr aufdecken. Deswegen ist es gut, wenn Plagiat nicht verjährt.
Hilfreich wäre auch, wenn Plagiat nicht als Kavaliersdelikt oder lässliche Sünde behandelt würde, die mit einem Verwaltungsakt hinter verschlossenen Türen ad acta gelegt werden kann. Österreichische Hochschulen haben international einen schlechten Ruf, was das betrifft. Zum Glück finden sich die meisten Plagiate in Arbeiten, von denen ohnehin nie zu befürchten war, dass sie den Gang der Wissenschaft beeinflussen könnten. Das ist keine Entschuldigung, aber trotzdem tröstlich zu wissen.
Der Autor ist Professor für Bildungswissenschaft an der Universität Wien.

Hat Ihnen dieser Artikel gefallen?
Mit einem Digital-Abo sichern Sie sich den Zugriff auf über 40.000 Artikel aus 20 Jahren Zeitgeschichte – und unterstützen gleichzeitig die FURCHE. Vielen Dank!
Mit einem Digital-Abo sichern Sie sich den Zugriff auf über 40.000 Artikel aus 20 Jahren Zeitgeschichte – und unterstützen gleichzeitig die FURCHE. Vielen Dank!