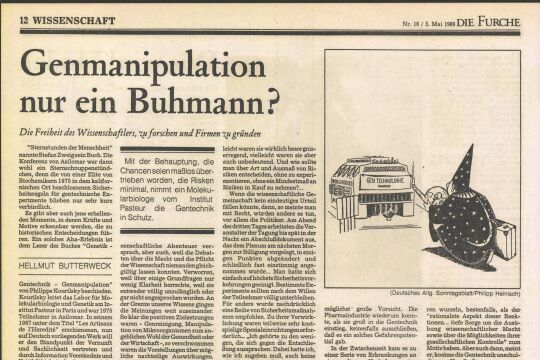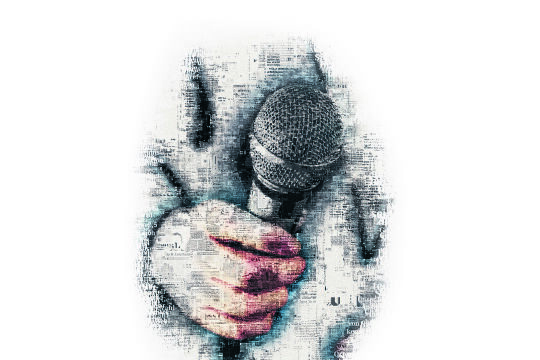Deutschlands Verteidigungsminister zu Guttenberg löste eine neue Debatte um Plagiate aus. Universitäten helfen sich mit Software, diese aufzudecken. Doch nicht alle werden entdeckt.
Wenn die eigene Dissertation über die Grenzen der Fachwelt hinaus Interesse hervorruft, ist das eigentlich ein guter Grund, stolz zu sein. Akademische Genugtuung dürfte jedoch nicht zu den Empfindungen gehören, die den deutschen Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg derzeit bewegen. Seine, 2009 vom Verlag Duncker & Humblot als Buch herausgegebene, Doktorarbeit "Verfassung und Verfassungsvertrag“ steht im Verdacht, über weite Strecken ein Plagiat zu sein. Ob es sich tatsächlich so verhält, wird die zuständige Universität Bayreuth zu klären haben. Zahlreiche Internetuser wollten nicht so lange warten und haben auf der Plattform "GuttenPlag Wiki“ bereits Hunderte Seiten als Plagiate in verschiedener Ausprägung identifiziert. Ein Vorstoß ziviler Entrüstung, der ein unabhängiges Gutachten zwar nicht ersetzen kann, aber schon mal ganz Übles ahnen lässt.
Auf der anderen Seite ruft eine vor wenigen Tagen eröffnete Facebook-Seite zum Ende der "Jagd“ auf den Minister auf. Ein Ansinnen, dem sich zu Redaktionsschluss bereits 200.000 Unterstützer angeschlossen hatten. Ob der adelige Politiker nicht nur Freiherr, sondern auch Lügenbaron ist, hat politische Relevanz. Indem sich die Diskussion auf die Person einschießt, übersieht sie jedoch, dass es in der Sache auch - und das vielleicht noch wesentlich dringlicher - um die öffentliche Reputation der Wissenschaft als solcher geht. Reflexartig drängt sich die Frage auf: Ist das ein Einzelfall?
Ethos erfordert hohe Standards
Wer die Usancen des Wissenschaftsbetriebes nicht kennt, versteht oft nicht, warum so sehr auf Exaktheit bestanden wird, auf peinlich genaues Einhalten der Zitierregeln und der Kennzeichnung fremder Gedanken in der eigenen Arbeit. "Eine paar fehlende Fußnoten machen noch kein Plagiat“, heißt es etwa auf der genannten Facebook-Seite. Das ist zwar richtig, aber auch Schlamperei sollte nicht zur Arbeitsweise eines Akademikers gehören.
Die Grenze zwischen Schlamperei und Plagiat ist fließend. "Wenn in einer Dissertation jede einzelne Seite abgeschrieben ist, liegt die Sache klar“, meint der als "Plagiatsjäger“ bekannte Medienwissenschaftler Stefan Weber. "Ab welcher Menge man von einem Plagiat sprechen kann, lässt sich nur im Einzelfall entscheiden.“ Da heißt es eben: ganz genau hinsehen. Zudem tritt Wissenschaft mit dem Anspruch auf, die Wahrheit zu finden oder zumindest - vage formuliert - die Welt zu erklären.
Dieser Ethos verträgt sich nicht mit abgeschwächten Präzisionsstandards. Freilich sind Wissenschaftler auch nur Menschen. Ihnen können Fehler passieren, sie sind aber auch nicht gefeit vor unlautereren Motiven. Betrugsfälle kennt die Wissenschaftsgeschichte zur Genüge. Man denke etwa an den, schon als künftigen Nobelpreisträger gehandelten, deutschen Starphysiker Jan Hendrik Schön. 2002 wurde ihm nachgewiesen, etliche Messdaten gefälscht zu haben.
Für die Universität, an der ein wissenschaftliches Fehlverhalten passiert, ist das besonders unangenehm. Das persönliche Versagen des Forschers lässt auch die Hochschule in schlechtem Licht erscheinen. "Kein Kavaliersdelikt“, "keine Bagatelle“, "kein Pardon“ heißt es deshalb unisono an den heimischen Unis zur Problematik von Plagiaten. Um Mängel in akademischen Abschlussarbeiten zu entdecken, greifen viele auf die Unterstützung Anti-Plagiats-Software zurück. Diese führt einen automatisierten Textvergleich zwischen der eingereichten Arbeit und Quellen im Internet durch.
Manche Prüfprogramme sind nutzlos
Sofern die richtigen Datenbanken und Suchmaschinen benutzt werden, lassen sich zeichengleich abgeschriebene Textstellen mit dieser Methode recht zuverlässig auffinden. Solche Programme sind allerdings von unterschiedlicher Qualität. Außerdem können sie mit ein wenig Aufwand ausgetrickst werden. Wer beispielsweise fremde Texte bedeutungsgleich umschreibt oder aus einer exotischen Sprache übersetzt, hat gute Chancen, nicht erwischt zu werden.
Zu diesem Schluss kommt auch eine aktuelle Untersuchung der Plagiatsexpertin Debora Weber-Wulff von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Alle zwei Jahre nimmt sie den Markt für Anti-Plagiats-Software unter die Lupe. Anfang des Jahres veröffentlichte sie die jüngste Erhebung. Von 26 geprüften Programmen sind demnach fünf "teilweise nützlich“ für den akademischen Einsatz, neun "kaum brauchbar“ und zwölf "nutzlos“. "Selbst die besten Systeme finden höchstens 60 bis 70 Prozent der plagiierten Anteile“, heißt es im abschließenden Bericht. "Zusammenfassend kann keines dieser Systeme für die generelle Nutzung empfohlen werden.“
Dieser Illusion gibt man sich seitens der Universitäten aber auch nicht hin. An der Uni Wien etwa wird zwar jede eingereichte Abschlussarbeit automatisch von einer Software geprüft, die einen Prüfbericht generiert. Danach sichten aber noch Studienprogrammleitung oder Betreuer den Bereich manuell auf Verdachtsmomente. Zugleich bemühen sich die heimischen Hochschulen um Bewusstseinsbildung. So ist das Lehrpersonal per Dekret dazu angehalten, Studierende über die Regeln korrekten wissenschaftlichen Arbeitens zu informieren. Zusätzlich werden einschlägige Lehrveranstaltungen und detaillierte Aufklärung auf Internetseiten angeboten. Es nicht besser gewusst zu haben, ist deshalb keine zulässige Ausrede.
Die Konsequenzen für Plagiatoren sind hierzulande vergleichsweise milde. Das österreichische Universitätsgesetz kennt den Tatbestand des Plagiats nicht. Als Grund für die Aberkennung akademischer Titel wird in Paragraph 89 lediglich das Erschleichen durch "gefälschte Zeugnisse“ genannt. Der Paragraph 74 gibt zudem Gründe für die Nichtigerklärung von Beurteilungen an. Darunter fällt etwa "die Verwendung unerlaubter Hilfsmittel“. In jedem Fall erhalten Plagiatoren die Möglichkeit, ihre Arbeit nachzubessern oder zumindest, eine völlig neue zu schreiben. Die Überprüfung älterer Arbeiten erfolgt nur auf konkreten Hinweis, das ließe sich anders auch kaum handhaben. Ein dauerhafter Verweis von der Hochschule ist in Österreich rechtlich nicht möglich. Die USA oder die skandinavischen Ländern gehen hier deutlich resoluter vor. Im Unterschied etwa zu Deutschland gibt es in Österreich außerdem die Möglichkeit, seine Abschlussarbeit für die Öffentlichkeit sperren zu lassen. Das dient zwar primär der Patentierbarkeit von Erfindungen, die im Zuge der Forschung gemacht wurden. Zugleich entzieht es das Werk aber der nachträglichen Kontrolle. "Die derzeit gültigen Regelungen funktionieren in Österreich gut, es gibt daher momentan keinen Bedarf für Änderungen“, heißt es dazu aus dem Wissenschaftsministerium.
Agentur prüft Integrität des Personals
Generell sei das Problem viel geringer, als es die Vehemenz der Diskussion um publik gewordene Fälle nahelegt, versichern auch die Universitäten.
So wurden an der Uni Wien in den vergangenen fünf Jahren vier Abschlussarbeiten als Plagiate enttarnt. Die Rechtsabteilung der TU Wien weiß von keinem einzigen Fall im letzten Jahrzehnt zu berichten. Es ist international allerdings nicht unüblich, dass wissenschaftliches Missverhalten jeglicher Art unter Ausschluss der Öffentlichkeit intern an der betroffenen Institution geregelt wird.
Um dem Vorwurf der Vertuschung zu entgehen, haben die österreichischen Universitäten sowie die größten außeruniversitären Forschungseinrichtungen im Juni 2009 die "Agentur für wissenschaftliche Integrität“ (ÖAWI) gegründet. Mit Diplomarbeiten und Dissertationen muss sich die fünfköpfige Kommission zwar nicht herumschlagen, die bleiben weiterhin Aufgabe der jeweiligen Uni. Etwaige Vergehen des wissenschaftlichen Personals sollen dagegen zur Überprüfung an die Agentur übergeben werden.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!