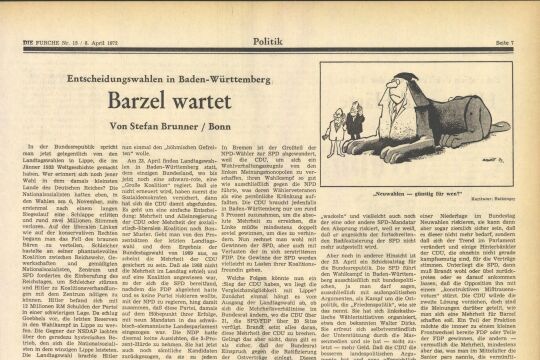Die Entscheidung ist gefallen: Deutschlands Unionsparteien werden mit Edmund Stoiber als Kanzlerkandidaten gegen Gerhard Schröder in den Wahlkampf ziehen. Ein historischer Einschnitt für die CDU mit ungewissem Ausgang ist die Kandidatur Stoibers allemal. Denn in einer Notlage den Chef der anderen als Hoffnungsträger zu rufen ist eines, die Geschlossenheit beider Parteien im Wahlkampf und darüber hinaus durchzuhalten ein anderes.
Mit dem Bayern Edmund Stoiber an der Spitze hoffen die Unionsparteien nicht nur die Turbulenzen, denen die Christdemokraten seit Ende der Ära Kohl ausgesetzt waren, vergessen zu machen und wieder stärkste Partei in Deutschland zu werden, sondern eine reale Chance zu haben, die Schröder-Regierung bei den Bundestagswahlen am 22. September ablösen zu können. Eine Überraschung war die Entscheidung längst nicht mehr trotz oder gerade wegen der internen Hahnen- und Machtkämpfe und eines gemessen an den Regeln einer parlamentarischen Demokratie fragwürdigen Verfahrens.
Obwohl der Wahlkampf nach der Kür Stoibers spannend zu werden verspricht und manche vom Zweikampf Schröder-Stoiber als von einer Idealkombination sprechen, lässt sich im Augenblick weder Sicheres über die wirklichen Wahlchancen noch über die langfristigen Wirkungen auf das politische Schicksal der beteiligten Akteure sagen. Ein historischer Einschnitt für die CDU mit ungewissem Ausgang ist die Kandidatur Stoibers aber allemal. Denn in einer eigenen Notlage den Chef der anderen als Hoffnungsträger zu rufen ist eines, die Geschlossenheit beider Parteien im Wahlkampf und darüber hinaus durchzuhalten ein anderes. Man wird also abwarten müssen wie ihr der jetzige Wechselbalg bekommt.
Den Kanzler ablösen
Um aber Chancen und Risiken für die Akteure und ihre Parteien wenigstens virtuell einigermaßen einordnen zu können sind möglicherweise einige Reminiszenzen, die einen den politischen Gegner, die anderen die eigenen Reihen betreffend, hilfreich. Denn in mancher Hinsicht glich die Situation der Unionsparteien während der letzten Wochen und Monate der Zeit der Kandidatenkür bei der SPD 1998. Aber sowohl was die Bewerber als auch das Verfahren anbelangt eben nur in mancher Hinsicht: Zwei Bewerber, beide kompetent und führungsstark und vor allem ehrgeizig genug, um dem jeweils anderen nicht kampflos das Feld zu überlassen, beherrschten damals bei den Sozialdemokraten die Szene: der eine, Oskar Lafontaine, Ministerpräsident des Saarlandes, Bundesvorsitzender der Partei und ein Stück weit ihr ideologisches wie soziales Gewissen, der andere, Gerhard Schröder, Regierungschef in Niedersachen, in der eigenen Partei nicht geliebt, aber als Wahlkämpfer und pragmatischer Modernisierer über die Grenzen der Partei hinaus hoch geschätzt.
Entschieden wurde - wie sollte es auch anders sein - auch damals nach dem Grundsatz, wer von den beiden kann am ehesten Helmut Kohl ablösen und schafft - nach 16 Jahren Opposition - den Rückgewinn der Macht. Weder Lafontaine noch Schröder wollte und konnte von sich aus verzichten, aber auch keiner den anderen einfach aus dem Rennen werfen. Im Unterschied zur Union jetzt erleichterte damals aber ein Umstand die Möglichkeit den gordischen Knoten zu durchhauen, ja machte eine eigene Entscheidungsfindung durch die Parteigremien überflüssig: die Landtagswahl in Niedersachsen im März 1998. Man musste diese Wahl schon aus Gründen der Wettbewerbsfairness abwarten, und konnte damit zugleich die späte Kür des Kanzlerkandidaten als Wahlkampfvorteil nutzen. Schröder gewann die Wahl mit Bravour und rund drei Prozent Zugewinn. Damit hatte sich der Wettlauf zwischen den Bewerbern gewissermaßen von selbst entschieden. Lafontaine konnte dem Konkurrenten und künftigen Kanzler die Kandidatur nur noch "bestätigen". Gerhard Schröder bezeichnete die damalige Wahl in Niedersachsen erst dieser Tage lobend als "streitschlichtende Instanz".
Stoibers Macher-Image
Eine solche Instanz stand der Union jetzt nicht zur Verfügung, und auch die Eigenposition der Bewerber war von der Schröders und Lafontaines grundverschieden. Edmund Stoiber hatte im zeitlichen Umfeld der Kandidatenkür keine Landtagswahlen zu bestehen, die nächste Wahl in Bayern findet erst im Herbst 2003 statt. Angela Merkel aber verfügte zur Stützung ihrer Kandidatur über keine andere Hausmacht als ihren Vorsitz in der Partei. Die Partei hatte die ehemalige Ministerin im Kabinett Kohl und CDU-Generalsekräterin unter dem Übergangsvorsitzenden Wolfgang Schäuble in schier hoffnungsloser Lage - auf dem Höhepunkt der Kampagne wegen des CDU-Spendenskandals - wenn schon nicht an die Spitze gerufen, so doch vor allem von der Parteibasis und der die Basis bestärkenden Medien mit heißem Herzen willkommen geheißen. Aber den Kopf der Partei konnte Merkel nie wirklich für sich gewinnen und deren Herz, sieht man von der Frauen-Union und vielleicht von den Sozialausschüssen, der Vertretung der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft, ab, hat längst aufgehört, für Merkel zu schlagen. Mit nachhaltiger Unterstützung aus der Bundestagsfraktion konnte die Parteivorsitzende erst recht nicht rechnen.
Vor die Alternative gestellt, zwischen einer profilschwachen, programmatisch unscharfen, die eigene Partei wie das Wählervolk wenig enthusiasmierenden, im eigenen Lager zunehmend isolierten Vorsitzenden und einem so kämpferischen wie erfolgreichen bayerischen Ministerpräsidenten wählen zu müssen, konnte sich die Union nur für Stoiber entscheiden. Dies umso mehr als die zunehmenden wirtschafts- und finanzpolitischen Schwierigkeiten der Regierung Schröder am Macher-Image des sozialdemokratischen Bürger- und Unternehmer-Kanzlers gewaltig kratzen und damit die Chancen der Unionsparteien bei der Bundestagswahl im September auch tatsächlich und nicht nur stimmungsmäßig um einiges verbessern.
Noch vordringlicher als ein noch ferner und völlig ungewisser Wahlsieg im Herbst war für die Partei und ihre Führungsgremien aber, dafür zu sorgen, dass die Union in der Wählergunst gegenüber den nur 35,1 Prozent bei den letzten Bundestagswahlen nicht noch weiter absinkt und damit die Fähigkeit zum Gewinn struktureller Mehrheiten für immer verliert. Mit Macho-Gehabe der CDU-Präsiden gegenüber der ersten Bewerberin um das höchste Regierungsamt, wie es in manchen Kommentaren zu hören war, hatte deren massives Votum für Stoiber und der entsprechend große Druck auf die eigene Parteivorsitzende ebenso wenig zu tun wie mit Vorbehalten gegenüber einer Politikerin aus dem Osten, aber sehr viel mit Selbsterhaltungstrieb.
Dass Frau Merkel an sich selbst als möglicher Alternative festgehalten, aber dann, die eigenen Parteigremien noch einmal überraschend, schlussendlich doch auf die Kandidatur verzichtet hat, ermöglichte beiden das Gesicht zu wahren: der Vorsitzenden gegenüber der Partei und der Partei gegenüber der Wählerschaft. Dennoch bleibt es für die CDU keine einfache Sache, sich dem Vorsitzenden der kleineren Schwesterpartei als gemeinsamen Hoffnungsträger zu fügen. Gewichtsverlagerungen von der größeren auf die kleinere Partei mit ihrer größeren Geschlossenheit aber dem geringeren Aktionsradius sind so unvermeidlich. Es wird nicht nur spannend sein, wie arbeitsteilig die Akzente im Wahlkampf gesetzt werden, sondern wie harmonisch oder sperrig auf den verschiedenen Kampagnen- und Arbeitsebenen kooperiert wird.
Um nochmals an die Sozialdemokraten von 1998 zu erinnern: Diese imponierten mit ihrer Doppelspitze Schröder-Lafontaine zwar durch taktische und strategische Geschlossenheit im Wahlkampf, wobei der Saarländer durch seine Blockadepolitik im Bundesrat mindestens soviel zum Wahlsieg beitrug wie Schröder selbst. Aber kaum an der Regierung zeigte sich, dass es mit der Doppelspitze nichts war, dass nicht nur die gegensätzlichen Temperamente sich aneinander rieben, sondern die unterschiedlichen Strategien erst recht im Crash enden mussten. Lafontaine räumte das Feld, Schröder wurde zum sozialdemokratischen Alleinherrscher mit der Folge, dass dieser die Entwicklung auch der SPD zu einem bloßen Kanzlerwahlverein gewaltig beschleunigt hat. Heute muckst in der SPD kaum noch jemand auf und wenn - die Vertrauensfrage des Kanzlers im Zusammenhang mit dem Einsatz deutscher Soldaten zur Terrorismusbekämpfung an der Seite Amerikas hat es eindrucksvoll gezeigt -, dann bieten sich die Grünen als Sack an, um den Esel nicht schlagen zu müssen.
Die Zukunft Merkels?
Ein ähnliches Durchgreifen Stoibers ist allerdings schon deswegen nicht vorstellbar, weil es sich bei CDU und CSU um eigenständige Parteien handelt, die beide um den Preis der politischen Existenz aufeinander angewiesen sind. Dies ist allerdings keine Sicherheitsgarantie für die politische Zukunft Merkels. Gegebenenfalls würden dann wieder die eigenen Leute für Ersatz sorgen. Allerdings böte sich für die CDU-Vorsitzende noch eine andere, für sie tröstlichere Parallele. 1979/80 musste Helmut Kohl auf die Kanzlerkandidatur gegen Helmut Schmidt zu Gunsten von Franz Josef Strauß verzichten. Strauß verlor die Wahl. Bei der Raketennachrüstung - NATO-Doppelbeschluss - versagte die SPD Schmidt die Gefolgschaft, die FDP wechselte zur Union, Kohl wurde Kanzler und blieb es 16 Jahre lang. Angela Merkel richtet sich wohl auf eine ähnliche Strategie ein. Sie hat erklärt, die Garantie größerer Geschlossenheit des Unionslagers bei diesen Wahlen habe sie veranlasst Stoiber die Kandidatur anzutragen. Was später kommt? "Schaun m'r mal". Aber dann werden noch einmal andere den Vortritt haben, die jetzt schon in der Fraktion, in Hessen, im Saarland in den Startlöchern sitzen, um die Übergangsgeneration nach Kohl endgültig abzulösen.
Und die Wahlaussichten der Unionsparteien im Herbst? Die Umfragen signalisieren ihnen wieder wachsende Zustimmung in der Bevölkerung. Und in Edmund Stoiber ist Schröder ein ebenbürtiger Konkurrent erwachsen, der jenseits aller Koalitionsspekulationen für ein gutes Ergebnis sorgen kann.
Aber eine Ablösung Schröders schon nach vier Jahren? Dies widerspräche trotz der vielen Wechselwähler als inzwischen stärkster "Partei" aller deutschen Tradition. Und im Zweifelsfall, wenn es für Rot-Grün nicht reicht oder Grün gar abhanden käme, wird die FDP für eine rot-gelbe Koalition zur Verfügung stehen. Sie kann sich im Bund mit einem politisch geschwächten Schröder als Hüterin der Marktwirtschaft bessere Profilierungschancen ausrechnen als mit einem das alt- und neubürgerliche Spektrum beherrschenden und wirtschaftspolitisch erfolgreich agierenden Edmund Stoiber.
Der Autor, freier Publizist und langjähriger Chefredakteur der "Herder-Korrespondenz", war von 1991 bis 1996 Grundsatzreferent in der Staatskanzlei Baden-Württemberg.