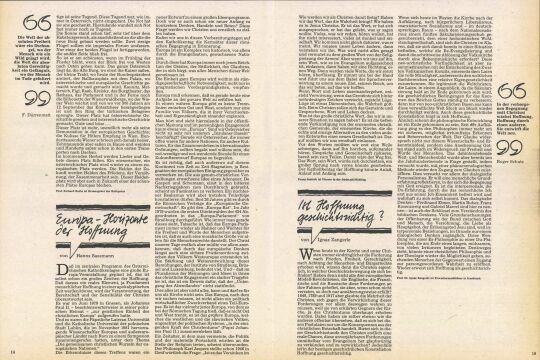Desinteresse prägt das Verhältnis der Amerikaner gegenüber der Europäischen Union. In den USA glaubt man an die eigene zivilisatorische Selbstschöpfung - an eine euro-amerikanische Wertegemeinschaft denken die wenigsten.
Die Verachtung für das "alte" Europa der Franzosen und Deutschen, die US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld im Februar 2002 auf der Wehrkundetagung in München zur Schau stellte, wurde von den "neuen" Europäern und den damaligen Ministerpräsidenten von Italien und Spanien als Bestätigung ihres Glaubens an die atlantische Gemeinschaft begrüßt.
Weder Rumsfelds europäische Kritiker noch seine Freunde begriffen, dass sich hinter der offenkundigen Arroganz der Macht ein allgemeines amerikanisches Desinteresse an Europa, nicht aber eine Initiative zur Erneuerung des atlantischen Denkens verbirgt. Amerikanische Politiker und Journalisten haben zwar langsam mitbekommen, dass sich die vormalige Europäische Gemeinschaft inzwischen Europäische Union nennt. Worin sich diese EU aber von der EG unterscheidet, interessiert sie nicht. Aus der Perspektive der USA handelt es sich beim "alten" und "neuen" Europa um nichts als Provinzen der imperialen Supermacht.
Provinzen der Supermacht
Das Desinteresse der USA für die EU reflektiert den Mangel an politischem Willen in Europa selbst. Im Gegensatz zum Verfassungskonvent der dreizehn Kolonialstaaten 1787 in Philadelphia, die gegen England einen blutigen und erfolgreichen Krieg geführt und gewonnen und die Notwendigkeit politischer Einheit begriffen hatten, gibt es diese Einsicht in Europa nicht. Die Verfassung, auf die man sich in Philadelphia geeinigt hatte und die dann von dreizehn Verfassungskonventen ratifiziert wurde, steuerte den folgenden kontinentalen Einigungsprozess, einschließlich der Aufnahme der letzten zwei Territorien, Alaska und Hawai'i, im Jahre 1959.
Dieser Verfassungsentwurf, den man wohlweislich nicht dem amerikanischen Volk, das durch die politische Verfassung der Gesellschaft erst langsam entstehen sollte, zur Annahme vorgelegt hatte, erlaubte auch die demografische Erweiterung von vier Millionen Einwohnern 1790 bis zu den 290 Millionen Amerikanern heute. Weder die territoriale Expansion noch die millionenfache Einwanderung gefährdeten die politische Einheit.
Der Verfassungsentwurf der EU lässt sich nicht mit der Verfassung vergleichen, die seit 1789 mit wenigen Änderungen das politische Regime der USA bestimmt hat. Die theoretische Vernunft und symbolische Ausdruckskraft, die sich im amerikanischen Text artikulieren, sucht man im EU-Entwurf vergeblich. Sicher, die EU der 25 Mitgliedsstaaten ist ohne Verfassung Wirklichkeit geworden und kann sich noch immer nicht über ihre politische Gestalt einigen. Das amerikanische Desinteresse lässt sich zum Teil auch mit dieser politischen Gestaltlosigkeit der EU erklären. Auch wenn dieser Mangel an formaler Gestalt langsam im historischen Prozess überwunden und die EU als neuartige kontinentale politische Formation sichtbar werden wird, gibt es Zeichen der Phantasielosigkeit, die überraschen. Es ist für Amerikaner schwer nachvollziehbar, dass sich die entstehende EU durch eine Fahne repräsentieren lässt, in der Sterne nicht für Mitgliedschaft, sondern ästhetische Kategorien stehen. Ähnliches lässt sich über Beethovens Hymne sagen, die man durch die Bannung des Schillerschen Textes sprachlich neutralisiert hat. Diese anämische (blutarme) Präsenz der EU im öffentlichen Bewusstsein Europas trägt dazu bei, dass sie von Amerikanern nur als Schemen wahrgenommen wird.
Gleich, gleiche US-Flegel
Die negative Wahrnehmung ist keineswegs als endgültig zu verstehen. Die Begeisterung, mit der Europäer amerikanische Ereignisse von der Unabhängigkeitserklärung im Jahre 1776 über den Krieg bis zur verfassungsgebenden Versammlung in Philadelphia verfolgten, wurde verdrängt von der Aufregung, die 1789 durch die französische Revolution ausgelöst worden war. Das Interesse an Amerika nahm rapide ab. Die Entwicklungen in der neuen Gesellschaft auf der anderen Seite des Atlantiks wurden nicht mehr von den politischen und intellektuellen Eliten beachtet.
Die Auswanderung der Millionen aus Europa bestätigte nur, dass sich die neue Welt, wie Heinrich Heine das 1830 herablassend formulierte, den "lieben deutschen Bauern" öffnete, weil dort alle Menschen "gleich, gleiche Flegel" seien. Die USA verschwanden aus dem europäischen Horizont, tauchten erst wieder mit der amerikanischen Kriegserklärung im April 1917 gegen die Zentralmächte und den späteren Truppenlandungen in der europäischen Wahrnehmung auf. Das heutige Desinteresse Amerikas an Europa spiegelt das historische Desinteresse Europas an Amerika wider.
Die Unterschiede zwischen dem europäischen Desinteresse für die USA im 19. Jahrhundert und dem heutigen Desinteresse der Amerikaner an der EU sollten jedoch nicht verschwiegen werden. Europäer glauben noch immer mehrheitlich, dass es zwischen ihnen und den USA tief verwurzelte zivilisatorische Verbindungen gibt. Mit Ausnahme einiger Intellektueller an der Ostküste halten Amerikaner nicht viel von dieser euro-amerikanischen Wertegemeinschaft. Amerikaner glauben an ihre eigene zivilisatorische Selbstschöpfung und interessieren sich nicht besonders für transatlantische Genealogien.
Selbst der britische Premierminister Tony Blair musste die bittere Erfahrung machen, wie illusorisch sein Versuch war, aus einer behaupteten anglo-amerikanischen "special relationship" Entscheidungseinfluss im Irak abzuleiten. Sein Einfluss beschränkte sich darauf, dass seine rhetorischen Fähigkeiten von den Amerikanern ausgenutzt wurden, den Krieg gegen den Irak publizistisch erfolgreich abzudecken.
EU ist auf sich selbst gestellt
Blairs Illusion, die von der englischen politischen Klasse geteilt wird, sollte die Kontinentaleuropäer daran erinnern, dass sie auf sich selbst gestellt sind und deshalb beginnen müssen, die EU als unabhängige politische Formation anzuerkennen und sie zu stärken. Die Annahme einer Verfassung, die von einer langsam entstehenden europäischen Zivilgesellschaft akzeptiert wird, ist deshalb unabdingbar. Diese Einsicht können die Europäer aus der amerikanischen Gründungsgeschichte im späten 18. Jahrhundert lernen. An die Erneuerung einer trans-atlantischen Gemeinschaft zu glauben ist eine Vision, in der die Zukunft jeglichen Realitätsbezug verloren hat.
Der Autor ist Professor für Politikwissenschaft an der University of Hawai'i in Manoa, wo er politische Theorie unterrichtet.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!