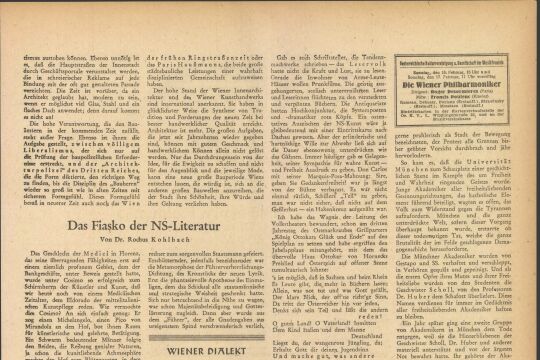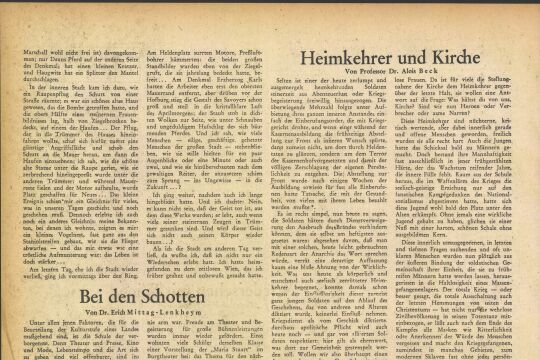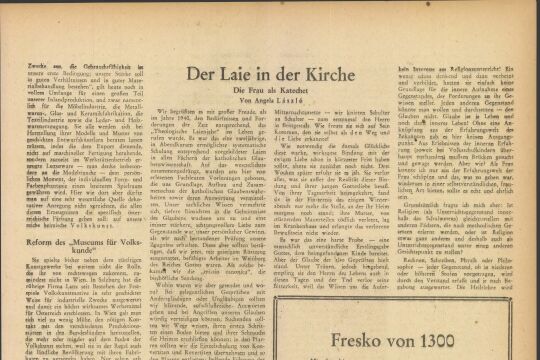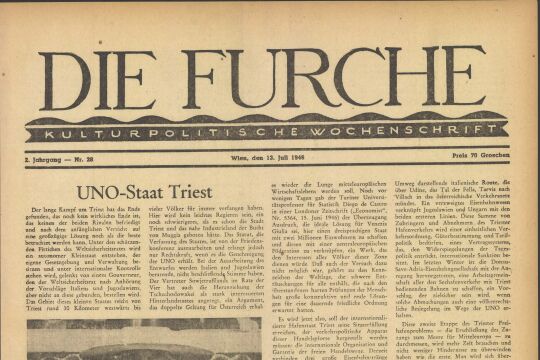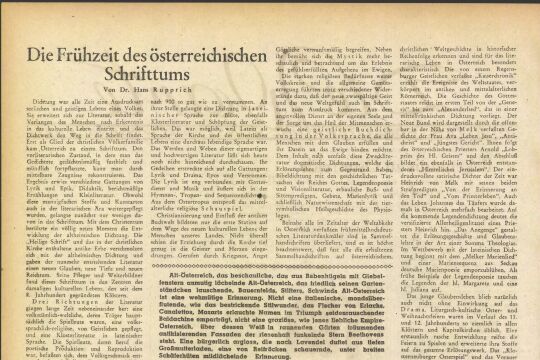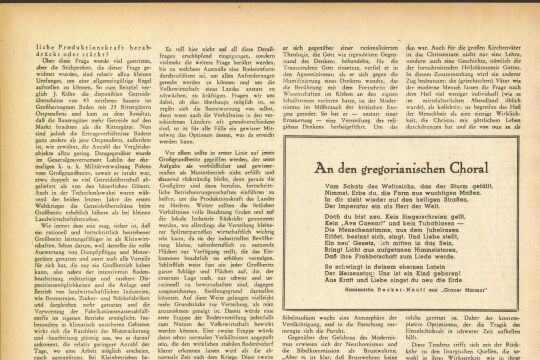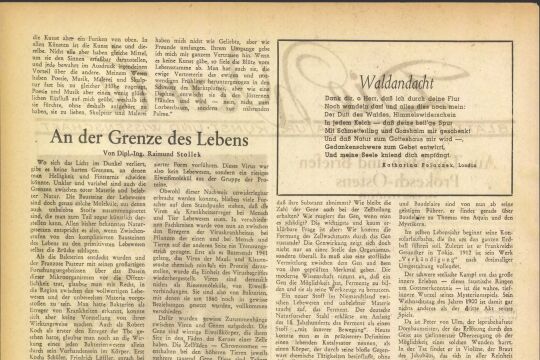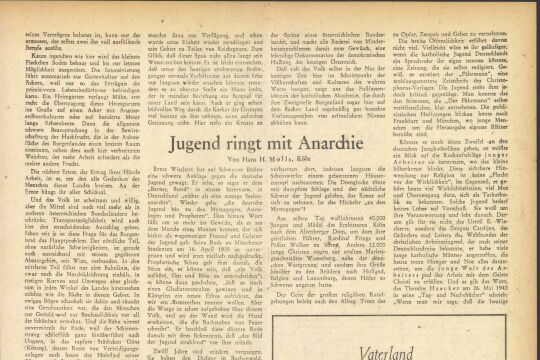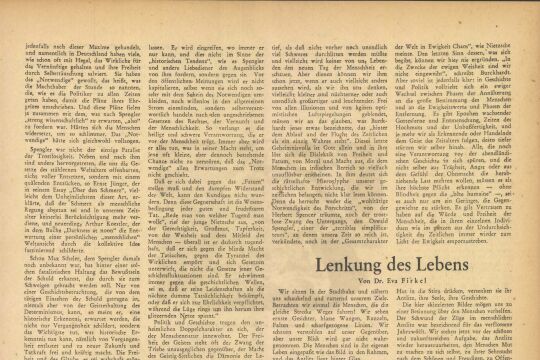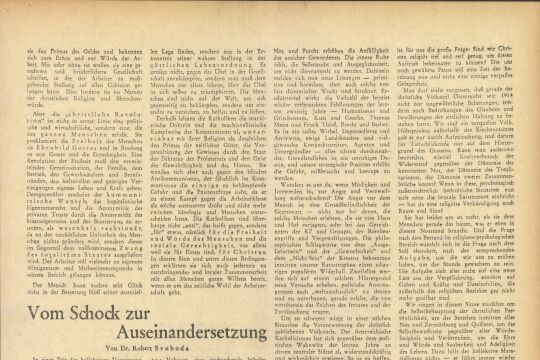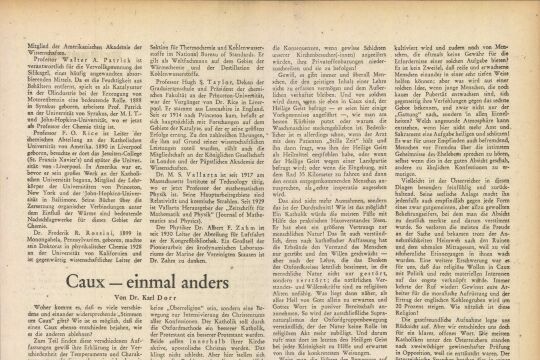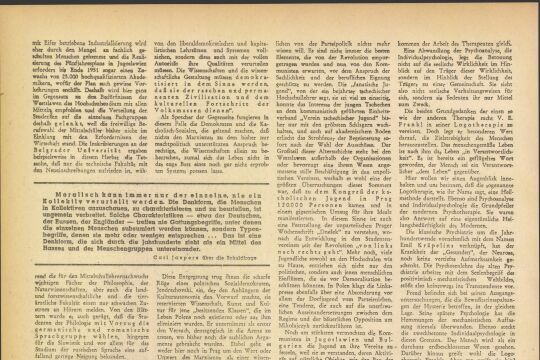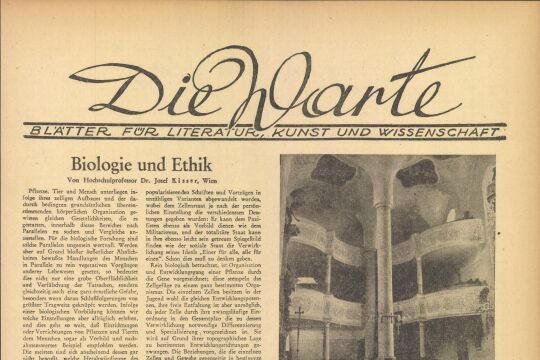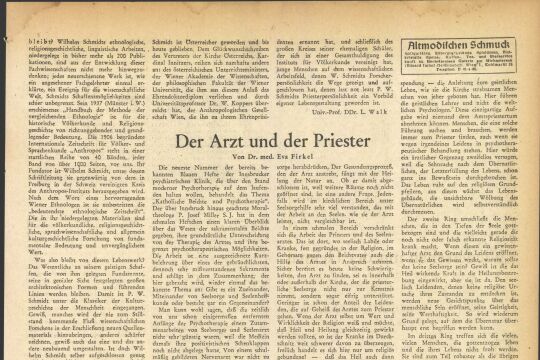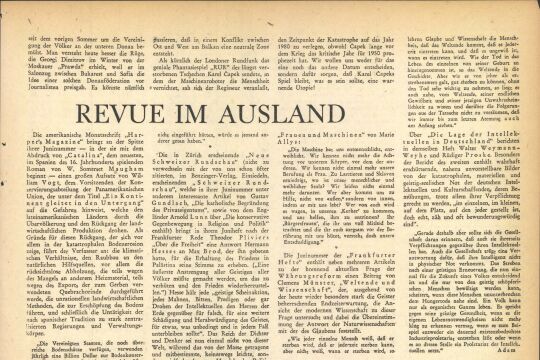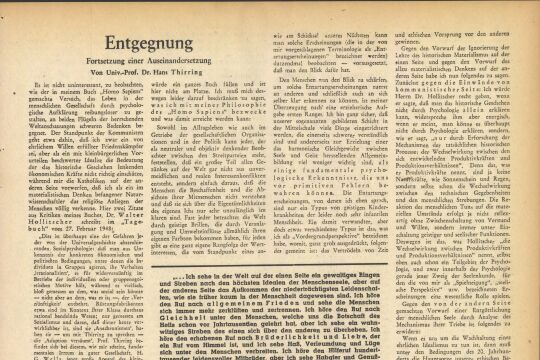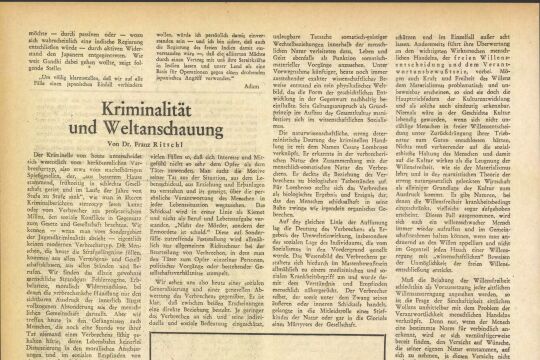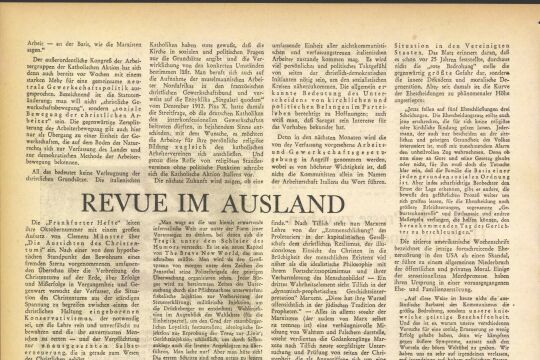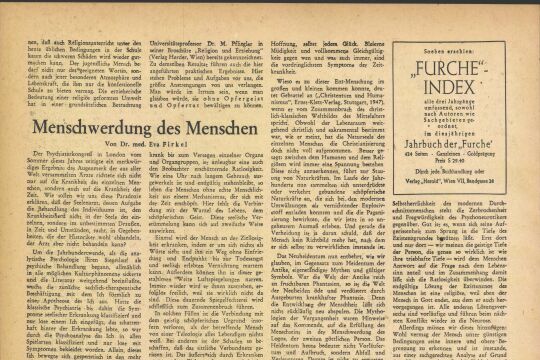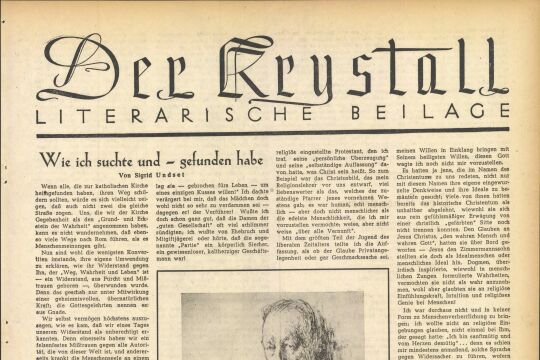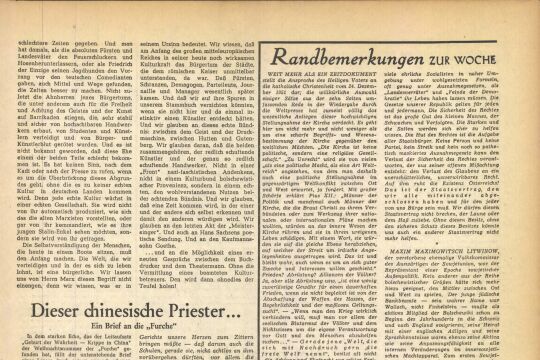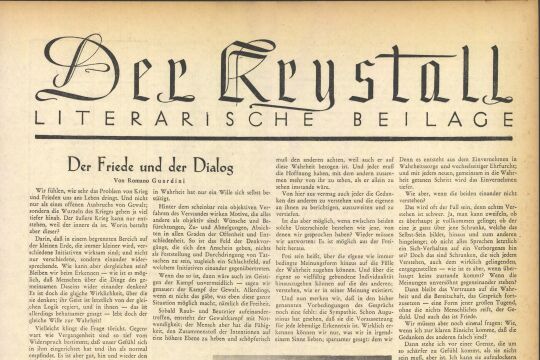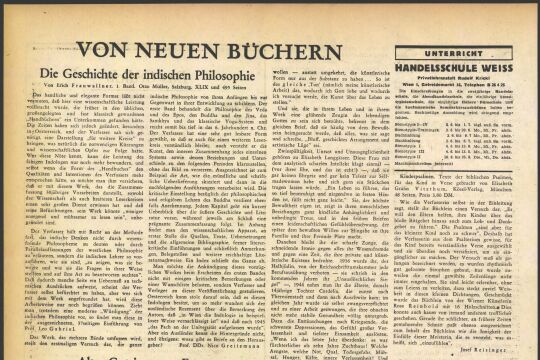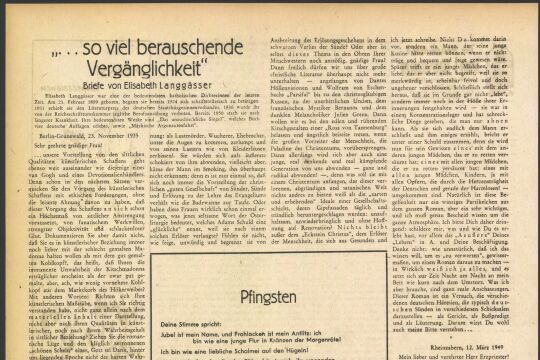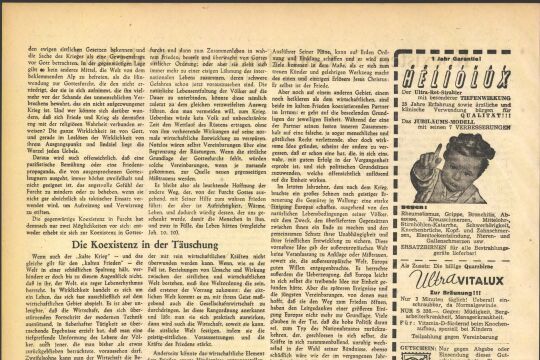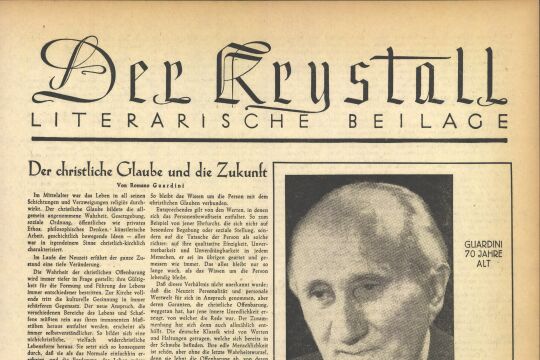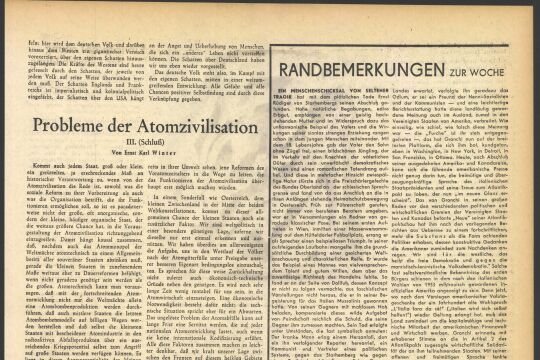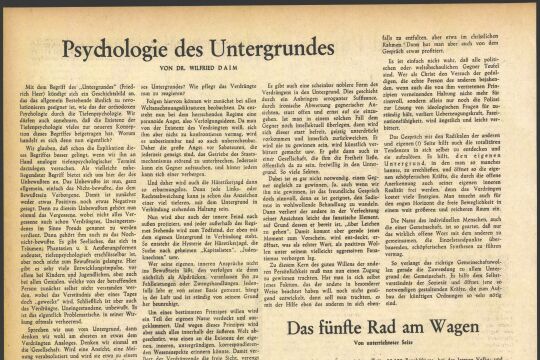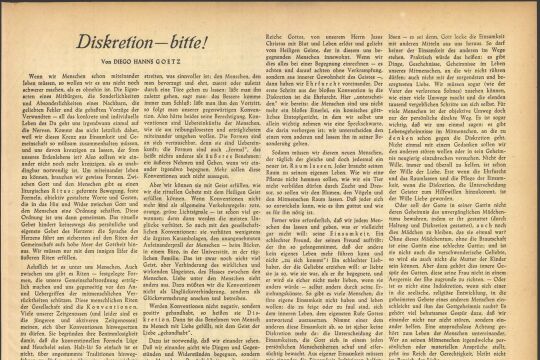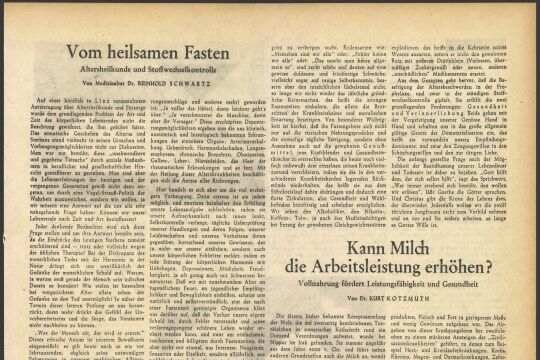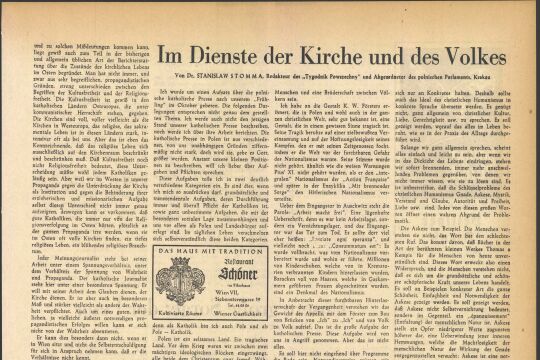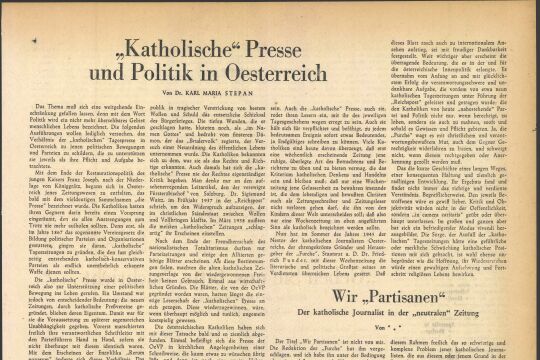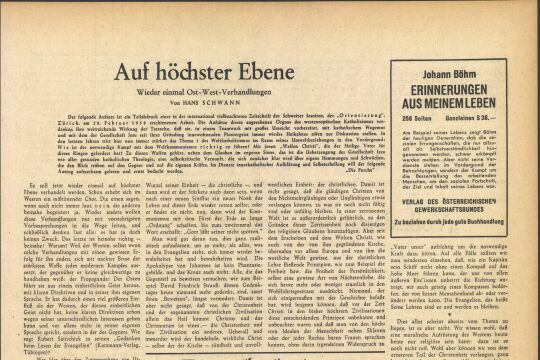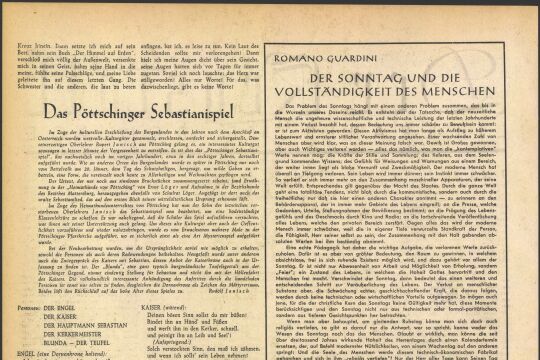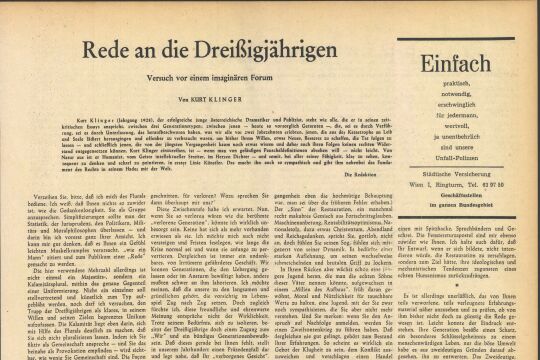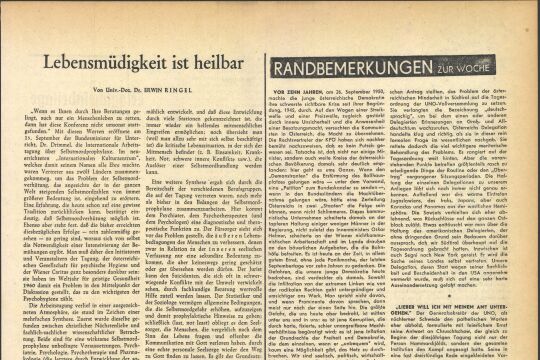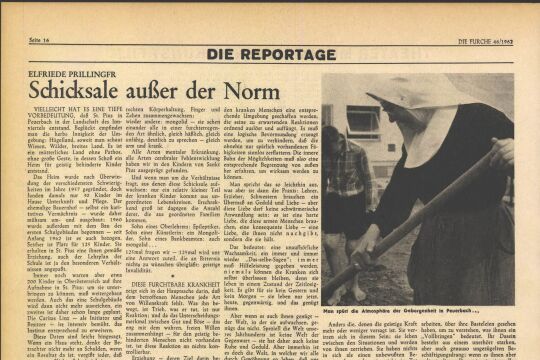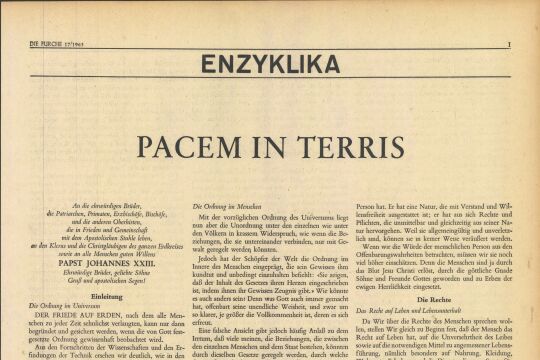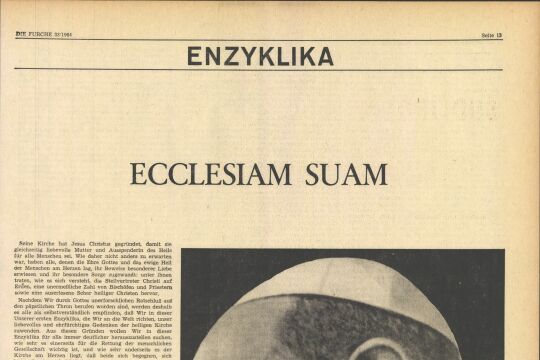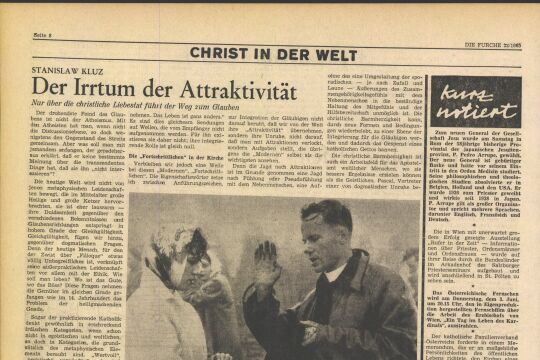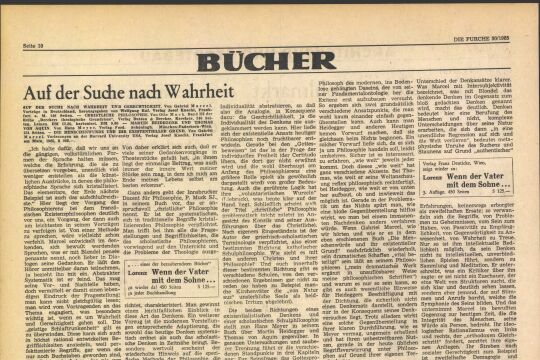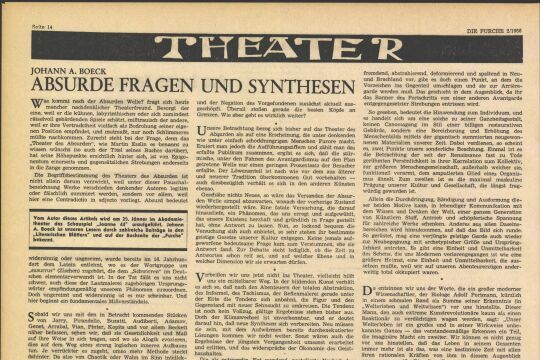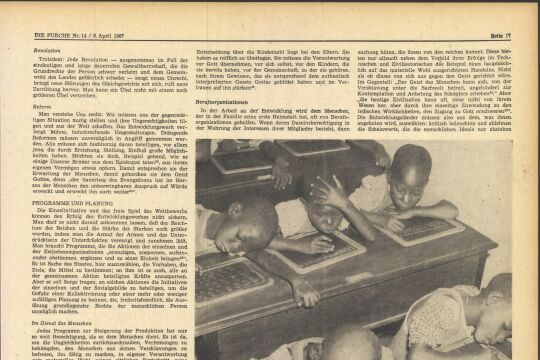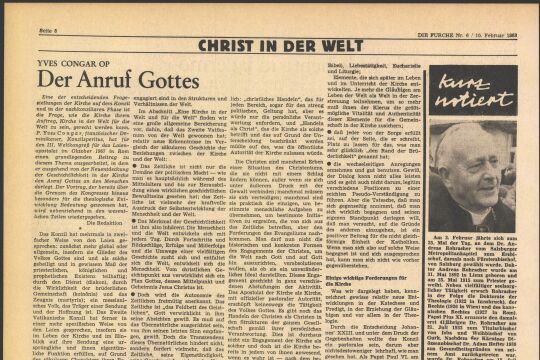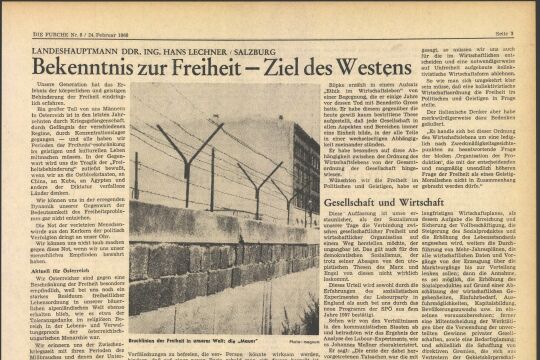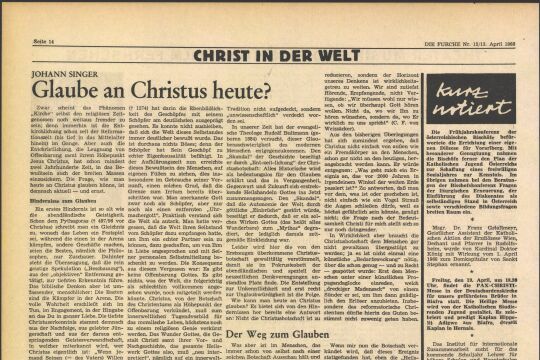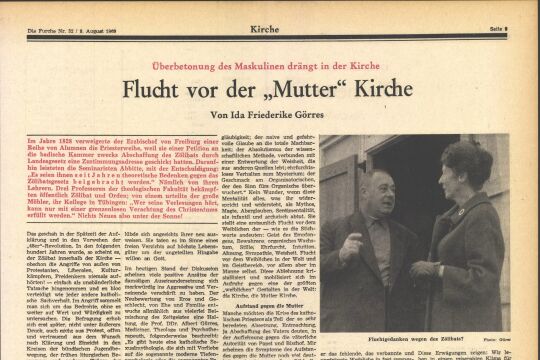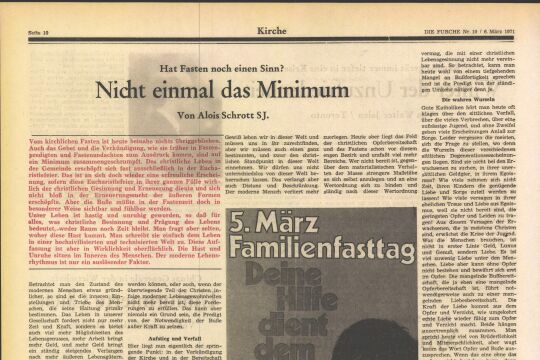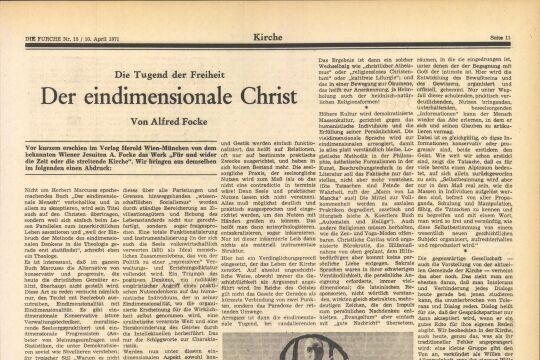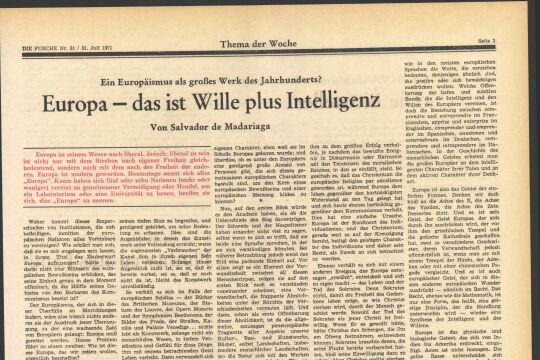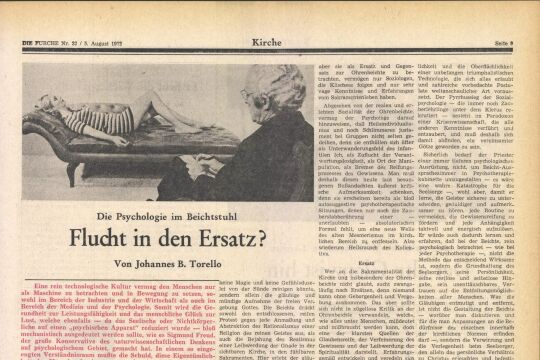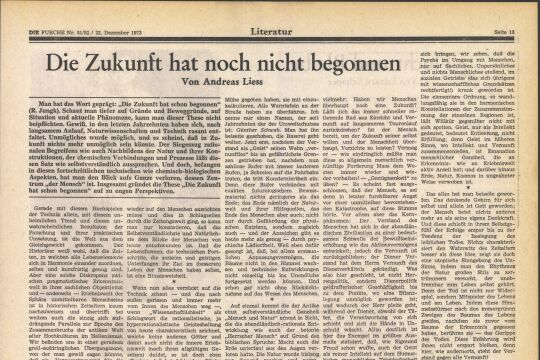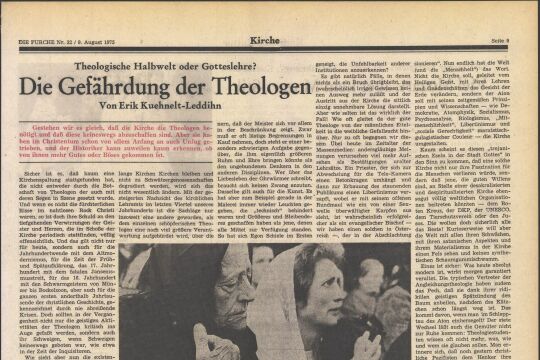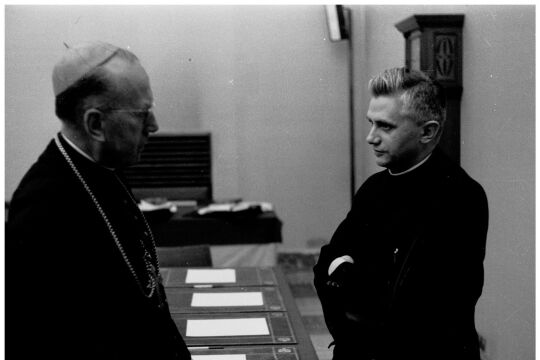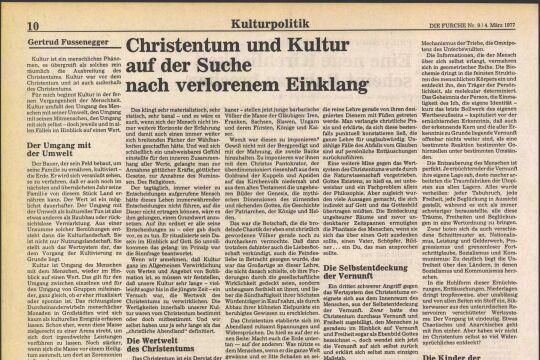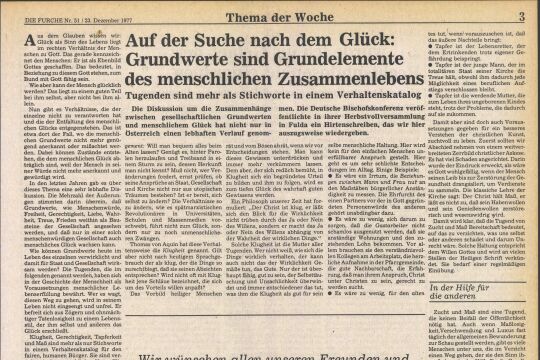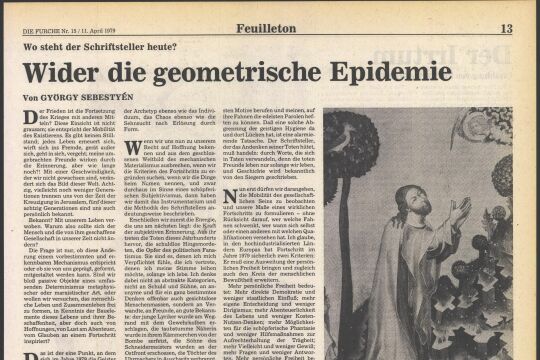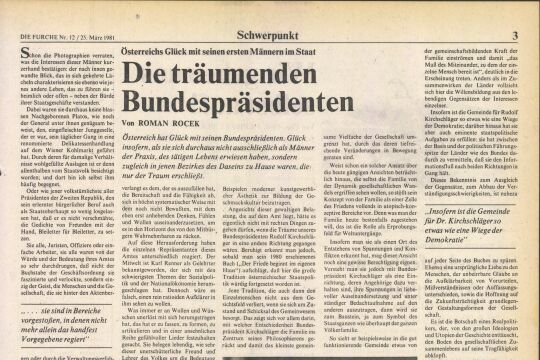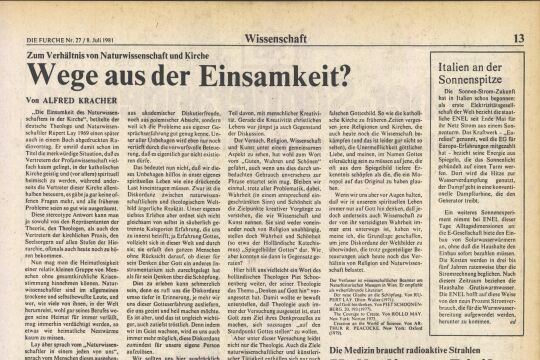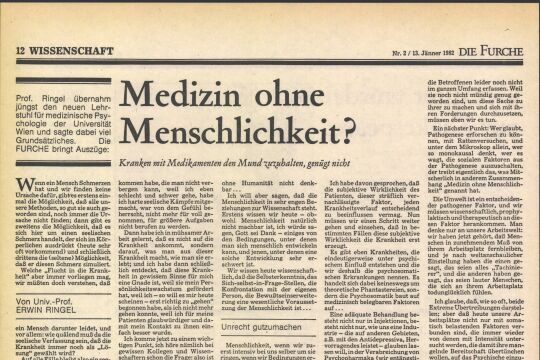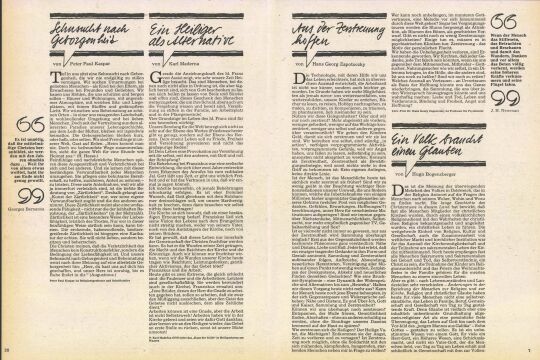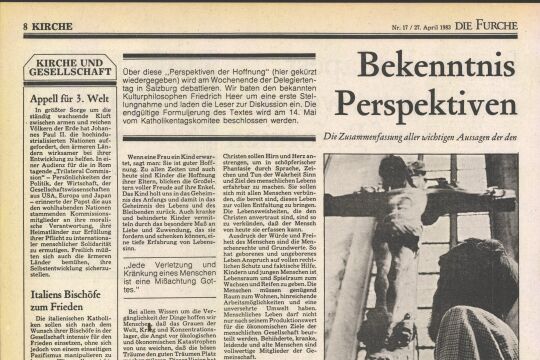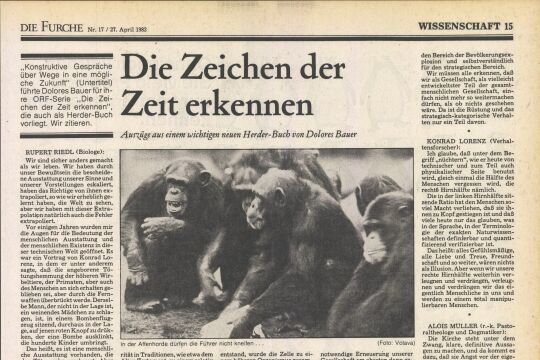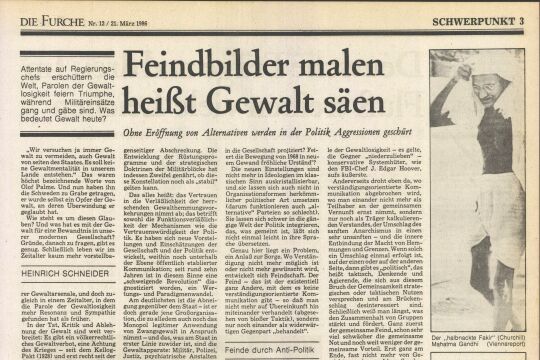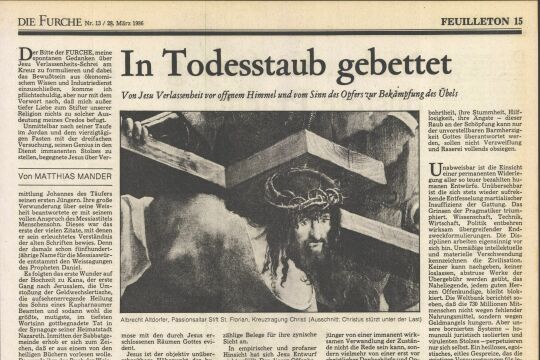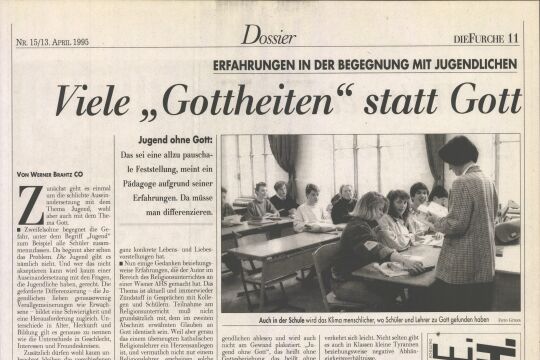Barmherzigkeit: Helfen mit Herz oder Helfersyndrom?
Ehrenamtliches Engagement ist besonders in Krisenzeiten gefragt. Doch die Motive dahinter verdienen eine tiefere Betrachtung. Therapeutische Gedanken zur „Barmherzigkeit“.
Ehrenamtliches Engagement ist besonders in Krisenzeiten gefragt. Doch die Motive dahinter verdienen eine tiefere Betrachtung. Therapeutische Gedanken zur „Barmherzigkeit“.
Besonders in Zeiten der Krise wird es als selbstverständlich erachtet, dass Menschen denjenigen Unterstützung bieten, denen es schlechter geht als ihnen selbst. Tun sie es nicht, wird ihnen Barmherzigkeit abgesprochen – oder überhaupt gleich „das Herz“. Doch was hat es mit diesen Begrifflichkeiten auf sich?
Alles, was ein Mensch tun kann, hat er erlernt – das heißt, er hat Wahrnehmungs- und Handlungsnervenzellen gebildet. Wo solche fehlen, mangelt es an Erkennen, Verstehen und Handeln. All dies sind dynamische Seinsweisen – sie können sich aufgrund der Plastizität des Gehirns immer wieder ändern, also mehren oder mindern.
Der Begriff „Barmherzigkeit“ als spezifische Seinsweise kann unterschiedlich interpretiert werden – als Motivation, als Handeln, als Charakter usw. Wenn Barmherzigkeit als „tätige Nächstenliebe“ gedeutet wird, besagt das freilich nichts über den leib-seelisch-geistigen Zustand oder die Motive der tätigen Person. Wenn man aber die Wortbildung hinterfragt, so zeigt sich, dass ein „barm-herziger“ Mensch einer ist, dessen Herz sich (er)barmen lässt – wie auch das lateinische Pendant misericordia („ein Herz für die Elenden“) bedeutet.
Eigene Emotionen beherrschen
Grundsätzlich symbolisieren wir in den uns zur Verfügung stehenden (verbalen und nonverbalen) „Sprachen“, was wir wahrnehmen. So hat der russische Neuropsychologe und Sprachforscher Alexander Lurija (1902–1977) aufgezeigt, wie analphabetische Bauern grafische Formen als Gegenstände – zum Beispiel Teller statt Kreis, Spiegel statt Viereck – wahrnahmen und bezeichneten. Das erklärt in weiterer Folge auch, wieso Menschen, die „gelernt“ haben und daher gewohnt sind, visuell wahrnehmbares Verhalten als sachlich begründet wahrzunehmen, dieses selten als emotionale Reaktion erkennen. Dazu zählt auch die Reaktion, eigene Emotionen bewusst zu beherrschen.
Die Sichtbarkeit von Handlungen – etwa „barmherzigen“ – besagt freilich noch nichts über die fundierende leib-seelisch-geistige Basis im Individuum. Die kann man nur „erspüren“, bei sich selbst wie auch bei anderen. Doch das braucht Zeit.
Und das Herz? Als Organ ist es ein Muskel. Es kann sich weiten – also entspannen – oder verengen, also anspannen. Im Sinne der Leib-Seele-Geist-Einheit geschieht dies mehr oder weniger synchron mit dem, was man fühlt, denkt bzw. was die eigene geistige (spirituelle) Grundhaltung ist. Man kann hier auch biblische Anleihen nehmen: Im zweiten Buch Mose wird etwa beschrieben, wie „verstockt“, „verhärtet“ das Herz des ägyptischen Pharaos war, weil er das Leid der versklavten Israeliten nicht wahrnehmen konnte oder wollte. Erst der eigene Schmerz über den Tod seines Erstgeborenen sprengte den Panzer um sein Herz. Wenn man Gott entsprechend dem biblischen Bilderverbot nicht anthropomorph, sondern als Urgrund („Vater“), als die große (Schöpfungs-)Kraft interpretiert, zeigt sich diese Dynamik dahingehend, dass und wie der Pharao auf die Zumutung von Barmherzigkeit sein Herz „zumacht“.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!