Hilfe am Mittelmeer
Auf den griechischen Inseln leisteten 2015 vermehrt Frauen Arbeit für die ankommenden Familien und unbegleiteten Minderjährigen. Doch der Job des Helfers ist vorwiegend männlich dominiert.
Eine Frau in dunklem Gewand hockt vor einer Baracke aus Kartons, Stoffbahnen und Aluminiumplatten, die bei Glück den nächsten Windstoß überlebt. Ihr zerschundenes, zu früh gealtertes Gesicht kann das Grauen kaum verbergen. Schützend drückt sie ein halbnacktes Baby an ihre Brust. Bilder wie diese sind uns allzu bekannt. Ob humanitäre Nöte oder Naturkatastrophen, Krisen treffen das "schwache Geschlecht" am schlimmsten. So zeigte etwa die Studie "The Gendered Nature of Natural Disaster" im Jahr 2007, dass Frauen viel eher bei Naturkatastrophen sterben als Männer. Sie werden außerdem öfter Opfer von geschlechtsspezifischer Gewalt, Vergewaltigung, Zwangsprostitution oder Menschenhandel. Entkommen sie diesen Gefahren, stehen Frauen und Mädchen in den Lagern und Auffangstationen vor erneuten Bedrohungen: "Meist müssen Flüchtlingscamps auf die Schnelle hochgezogen werden", erklärt Kathleen O'Brien von der Hilfsorganisation "CARE International", "man hat keine Zeit, über die unterschiedlichen Bedürfnisse von Männern und Frauen zu achten." Dabei stellen für Letztere mehr als für männliche Flüchtlinge schlecht beleuchtete und kaum geschützte Lager, lange Wege zu Wasserstellen oder abgelegene, nicht versperrbare sanitäre Anlagen enorme Sicherheitsrisiken dar.
Derzeit sind nur 40 Prozent der Katastrophenhelfer Frauen. Der humanitäre Helfer der Zukunft hat einen mitfühlenderen Tonfall, er arbeitet anders und muss auch anders gemanagt werden.
Hohe Risiken
Alleinstehende Mütter oder Schwangere schaffen es laut "UNHCR" oft erst gar nicht zu diesen Verteilerstellen. Mangelnde Hygiene, Lebensmittelknappheit und fehlende medizinische Versorgung treffen diese geschwächten Frauen besonders hart. Die erhöhten Gesundheitsrisiken machen sich auch in Statistiken bemerkbar: Während Todesfälle von Müttern bei der Geburt laut einer Studie der "Weltgesundheitsorganisation" (WHO) 2014 weltweit deutlich zurückgegangen sind, verteilen sich 60 Prozent der Müttersterblichkeit auf zehn Länder. Es sind arme und von Krisen gebeutelte Nationen wie Indien, Nigeria, Kongo, Somalia und Tschad.
Angesichts dieser traurigen Entwicklung hat die UNHCR den Schutz von Frauen und die Reduktion dieser Gefahrenherde zur Priorität erklärt. Beides kann jedoch nur gelingen, wenn die speziellen Bedürfnisse von Mädchen wie Frauen in Krisensituationen ausreichend bekannt sind. Um eben jene zu eruieren und sensibel damit umzugehen, hat die Hilfsorganisation CARE vor Jahren das Programm "Gender in Emergencies" ins Leben gerufen. Zu dieser Gender-Sensibilität gehört außerdem, sich um ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Männern und Frauen in den Katastropheneinsatzteams - den sogenannten "Rapid Response Teams", die weltweit und innerhalb kürzester Zeit Hilfe in Krisengebieten leisten -zu bemühen. Denn: "In vielen Kulturkreisen können nur Frauen zu Frauen durchdringen", begründet Kathleen O'Brien diese Strategie, "gerade in patriarchalischen Strukturen ist es schwierig, Frauen zu einer Teilnahme zu bringen und ihre Bedürfnisse zu erfahren."
Doch nicht nur CARE bemüht sich in seinen eigens geschulten Katastrophenteams um einen Frauenanteil von 50 Prozent. Dass in den bisher traditionell männlich besetzten Einsatzteams in Zukunft verstärkt weibliche Experten gefragt sind, darüber herrscht auch Einigkeit unter elf multinationalen Hilfsorganisationen, die sich 2014 in der britischen "Transforming Surge Initiative" zur Verbesserung der Katastrophenhilfe zusammengefunden hatten.
Während CARE im letzten Jahr ihren angestrebten Frauenanteil um sieben Prozent übertroffen hatte, bleibt die Akquirierung und das Halten der weiblichen Nothelfer allgemein hinter dem Potenzial zurück: Schätzungen zufolge sind nur 40 Prozent aller Katastrophenhelfer in internationalen Noteinsätzen weiblich. "Es ist ziemlich schwierig, diesen Lebensstil zu führen", erörtert Kathleen O'Brien, die bei CARE für die Vermittlung der Einsatzkräfte rund um den Globus zuständig ist, die Situation, "man muss für alles gewappnet sein. Man weiß nie, wann man zum Einsatz gerufen wird. Das gilt für Männer wie für Frauen." Anders als ihre männlichen Kollegen stehen Letztere jedoch vor zusätzlichen Herausforderungen: "Bei Männern wird es von der Gesellschaft eher akzeptiert, dass sie monatelang unterwegs sind", so O'Brien und spricht von sechs bis siebenwöchigen Einsätzen, "bei Frauen ist das anders."
Probleme bei Helferinnen
Wie "anders", das zeigt die jüngst durchgeführte Untersuchung "How can Humanitarian Organisations Encourage More Women in Surge?", bei der CARE und "ActionAID" rund 40 Nothelferinnen aus aller Herren Länder interviewt haben. Ziel war es, die Zugangsbarrieren und Herausforderungen für Frauen vor, während sowie nach dem Einsatz herauszufinden. Sieben Konfliktfelder brachte die Studie zutage -das Thema Familie ist eines davon. "Eine Helferin erzählte, dass sie jedesmal vor einem Einsatz gefragt würde, wo sie denn ihre Kinder ließe", berichtet Kathleen O'Brien. Wie viele ihrer Kolleginnen muss sich die Befragte rechtfertigen, wenn sie in den Einsatz zieht und ihre Familie wochenlang allein lässt. Ohne einen unterstützenden Partner wäre die Arbeit nicht möglich, meinte die Mehrheit der Frauen unisono. Doch selbst mit diesem Rückhalt sehen sich viele vor die Wahl zwischen Beruf und Familie gestellt - und bleiben mit Schuldgefühlen zurück, egal, wie sie sich entscheiden.
Die Schwierigkeiten beschränken sich aber nicht nur auf den Zeitraum vor oder nach dem Einsatz. Auch während des Jobs selbst sind die weiblichen Nothelfer mit größeren Herausforderungen konfrontiert als ihre männlichen Kollegen: So äußerten manche Frauen Sicherheitsbedenken, weil sie in den Unterkünften mit Männern zusammenleben oder in Zelten schlafen mussten und keine Privatsphäre hatten. Letzteres stellte vor allem wegen der eigenen Hygiene ein großes Problem dar. "Ohne funktionierende Toiletten, fließendes Wasser oder ausreichend Privatsphäre war es ein Albtraum, die Periode zu haben", berichtet eine CARE-Helferin, die 2013 nach dem verheerenden Taifun Haiyan auf den Philippinen im Einsatz war.
Überraschend kamen diese Ergebnisse für die Verantwortliche Kathleen O'Brien nicht. "Überrascht hat mich jedoch das große Interesse der Organisationen, über diese Themen zu diskutieren." Mit dem Diskutieren allein ist es jedoch bei Weitem nicht getan. Damit Frauen den Weg in Rapid Response Teams finden, vor allem aber bleiben, gilt es, bessere Bedingungen für die weiblichen Helferinnen zu schaffen.
Dazu zählt, den Zugang zu Kinderbetreuungseinrichtungen zu erleichtern und finanzielle Unterstützung anzubieten; in Camps eigene Unterkünfte und absperrbare Toiletten für die Nothelferinnen einzurichten sowie Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Dazu gehört aber auch, versteckte Rollenbilder in den Organisationen aufzuzeigen und zu hinterfragen: "Die Zeiten, in denen humanitäre Helfer als toughe Cowboys auftreten, sind vorbei", so O'Brien, "der humanitäre Helfer der Zukunft hat einen mitfühlenderen Tonfall, er arbeitet anders und muss auch anders gemanagt werden."
Offen Probleme thematisieren
Gender-Sensibilität und unterstützende Angebote wie die Genannten sind nach Meinung der Expertin nur ein Schritt auf dem Weg und müssten nicht nur im Krisenteam, sondern auf allen Ebenen gelebt werden. "Dieses 'Walk-the-Talk' hat bei CARE zu einer verstärkten Präsenz von Gender-Experten in unserer Organisation geführt", erzählt Kathleen O'Brien und fügt hinzu: "97 Prozent davon sind Frauen." Diese hätten wiederum großen Einfluss nicht nur auf die Programme von CARE, sondern auf die gesamte Organisationskultur.
Ein Umfeld wäre entstanden, in dem Frauen offen über ihre Probleme und Bedenken sprechen können und die nötige Unterstützung erhalten. Dieser Wandel in der Organisationskultur ist für die Zukunft der humanitären Hilfe entscheidend, ist die Einsatzkoordinatorin überzeugt. Und er mache sich bezahlt: Einerseits räume er die derzeitigen Zugangsbarrieren für Frauen in der Katastrophenhilfe aus dem Weg, andererseits könne er die hohe Fluktuation in diesem Bereich eindämmen -und zwar bei Frauen und Männern. CARE scheint hier auf einem guten Weg zu sein: "Durchschnittlich bleiben Einsatzkräfte zwei, vielleicht drei Jahre", erzählt O'Brien, "zwei unserer sechs Rapid Response Teamleader sind hingegen seit vier Jahren bei CARE tätig. Sie haben über die Jahre wertvolle Erfahrung gesammelt, die sie jetzt in die Organisation einbringen." Damit im Katastrophenfall besser geholfen werden kann.















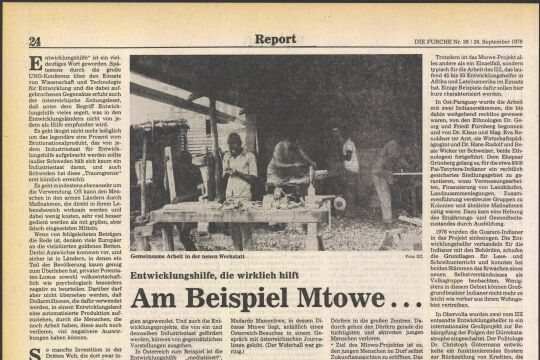


































































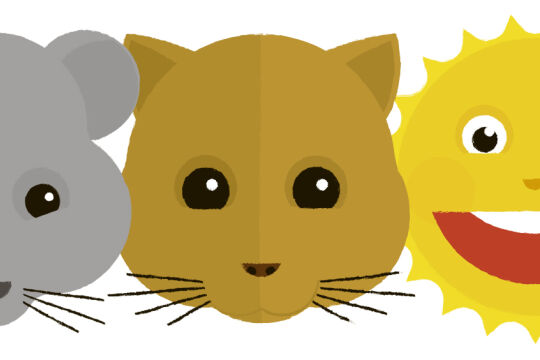







_Sheryl%20Rose%20M.%20Andes.jpg)


