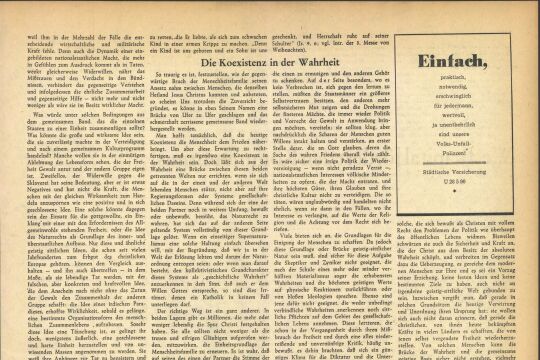Moria: Ist das unchristlich?
Moria sei eine „Gewissensfrage“, schrieb Maria Katharina Moser an dieser Stelle. Doch Gläubige könnten in der Migrations- und Flüchtlingspolitik zu unterschiedlichen Antworten kommen, meint Ludger Schwienhorst-Schönberger. Eine Replik.
Moria sei eine „Gewissensfrage“, schrieb Maria Katharina Moser an dieser Stelle. Doch Gläubige könnten in der Migrations- und Flüchtlingspolitik zu unterschiedlichen Antworten kommen, meint Ludger Schwienhorst-Schönberger. Eine Replik.
„Jeden Tag passiert genau so viel, wie in eine Nachrichtensendung passt“, sagt das Kind zur Mutter. Dieser kindlich-naive Realismus prägt auch den Umgang einer breiten Öffentlichkeit mit den Medien. Für einige Tage war der Brand im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos in Österreich und Deutschland die Top-Nachricht. In anderen europäischen Ländern rangierten die Vorkommnisse unter „ferner liefen“. Weder das eine noch das andere ist falsch.
Im Hintergrund stehen hochgradige Formen der Auswahl. „Was wichtig ist“, wird von einigen Verantwortlichen in den Medien entschieden. Rückt man das Unglück, bei dem meines Wissens kein Mensch zu Tode gekommen ist, in einen globalen Zusammenhang, so handelt es sich um eine der vielen Katastrophen und schrecklichen Missstände weltweit. Überall muss geholfen werden. Hilfsorganisationen und NGOs ringen um Aufmerksamkeit. Die Politik hat die Aufgabe, in der Not zu helfen, abzuwägen, Prioritäten zu setzen, Entwicklungen im Auge zu behalten, angemessen Vorsorge zu treffen und die Folgen politischer Entscheidungen abzuschätzen und abzuwägen. Wer das Unglück in Moria und eine spezifische Form der Hilfe zum status confessionis hochstilisiert, muss sich die Frage gefallen lassen, warum gerade dieses und nicht ein anderes schreckliches Ereignis diesen Status erlangen soll (vgl. dazu den Gastkommentar von Maria Katharina Moser).
Knappheitsbedingungen
Die traurigen Bilder, die uns die Nachrichten vermitteln, rufen Mitleid hervor. Mitleid ist eine wesentliche Quelle sittlichen Handelns. Auch der barmherzige Samariter handelt aus Mitleid (Lk 10,33). Nun war die Notlage, mit der er sich konfrontiert sah, vergleichsweise überschaubar. Wäre er auf eine Gruppe Schwerverletzter gestoßen, hätte er schwerwiegende Entscheidungen treffen müssen, wem zuerst, wem später und wem vielleicht gar nicht mehr geholfen werden kann. Er hätte die der katholischen Moraltheologie vertrauten Vorzugsregeln anwenden müssen. Das im Rahmen der Corona-Pandemie jüngst diskutierte Modell der Triage hat auf schmerzhafte Weise in Erinnerung gerufen, dass unter Knappheitsbedingungen Vorzugsregeln anzuwenden sind.
Auch in der Migrationspolitik ist zwischen der Grundhaltung und ihrer konkreten Verwirklichung zu unterscheiden. Der Philosoph Robert Spaemann hat dies klar zum Ausdruck gebracht: „Uneingeschränkt kann die Hilfsbereitschaft sein, aber nicht die tatsächliche Hilfe. Es kann nicht unsere Pflicht sein, uneingeschränkt zu helfen, weil es nicht möglich ist. Wir können es nicht. Und wir sollten auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn wir unserer Hilfe Obergrenzen setzen. Zudem ist es so, dass, wenn es solche Grenzen gibt, man auswählen muss, wen man nimmt und wen nicht.“
Groß angelegte Hilfsaktionen bei Umweltkatastrophen wie Erdbeben, Tsunami und Ähnlichem sind in der Regel politisch unumstritten. Dass die Flüchtlings- und Migrationspolitik in allen europäischen Ländern zu derart heftigen politischen Auseinandersetzungen geführt hat, dürfte unter anderem mit den Entscheidungen im Herbst 2015 zusammenhängen. Die medial verstärkte Euphorie im Zeichen von Refugees welcome wurde zu spät von einem vernunftgeleiteten Diskurs abgelöst. Als fatal erwies sich zudem, dass von einigen Politikerinnen der Eindruck erweckt wurde, dass Grundprinzipien moderner Staatlichkeit – wie Staatsvolk, Staatsgebiet und Staatsgewalt – angesichts der Migrationskrise nicht mehr aufrechtzuerhalten seien. Von einigen Theologen wurde diese Position noch dahingehend verschärft, dass die Idee nationaler Souveränität als mit dem Universalitätsanspruch des christlichen Glaubens unvereinbar erklärt wurde und als unchristlich abzulehnen sei. Jesus habe Brücken gebaut und keine Grenzen gezogen, war zu hören.
Derartige Ansichten widersprechen eindeutig der katholischen Soziallehre. Zwar ist, wie Johannes XXIII. in seiner Enzyklika Pacem in terris geschrieben hat, „das Gemeinwohl einer Nation untrennbar mit dem Gemeinwohl der gesamten Menschheitsfamilie verbunden“, gleichwohl aber erkennt „das Lehramt die Wichtigkeit der nationalen Souveränität an, die vor allem als Ausdruck jener Freiheit begriffen wird, die die Beziehungen zwischen den Staaten regulieren muss. Die Souveränität steht für die politische, wirtschaftliche, soziale und auch kulturelle Subjektivität […]. Die Kultur stellt eine Garantie dafür dar, dass die Identität eines Volkes bewahrt bleibt, indem sie seine geistige Unabhängigkeit zum Ausdruck bringt und stärkt.“ Wer den Begriff der kulturellen Identität eines Volkes aus dem Vokabular der katholischen Soziallehre verbannen möchte, muss sich nicht wundern, wenn er von Kräften aufgegriffen wird, die ihn missbrauchen.
Keine Ausschließlichkeit
Es gibt, so lehrt das Zweite Vatikanische Konzil, eine recht verstandene „Autonomie der zeitlichen Dinge“. Auch die Migrationspolitik gehört zu den zeitlichen Dingen. Und da kann es sein, dass Gläubige aus christlicher Sicht zu unterschiedlichen Lösungen gelangen. „Wenn aber die von beiden Seiten vorgelegten Lösungen [...] von vielen leicht mit der Botschaft des Evangeliums verknüpft werden, so sollen sie daran denken, dass es niemandem erlaubt ist, in den vorgenannten Fällen für seine eigene Meinung die Autorität der Kirche ausschließlich für sich zu beanspruchen“ (Gaudium et Spes, 43,3).
Auch in der Migrationspolitik gibt es unterschiedliche Optionen. Die Überführung sämtlicher oder einiger Flüchtlinge des Lagers nach Österreich oder Deutschland ist – wenn sie rechtlich möglich wäre – aus christlicher Sicht sicherlich eine von mehreren Optionen. Die einzig mögliche ist sie nicht. Dass Hilfe vor Ort weniger christlich sei, leuchtet mir nicht ein. Wer einer Regierung, die nach Abwägung unterschiedlicher Gesichtspunkte die Entscheidung trifft, allein vor Ort zu helfen, eine unchristliche Haltung unterstellt, wird meines Erachtens der Komplexität der Sache nicht gerecht.
Der Autor ist Professor für Alttestamentliche Bibelwissenschaft an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!