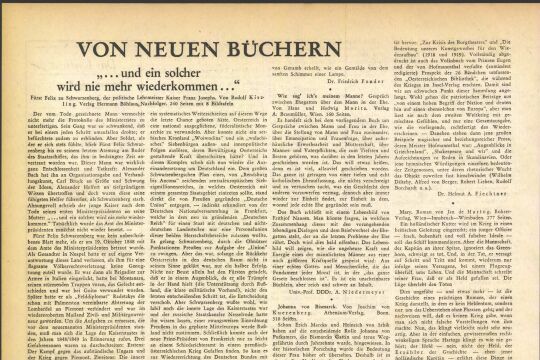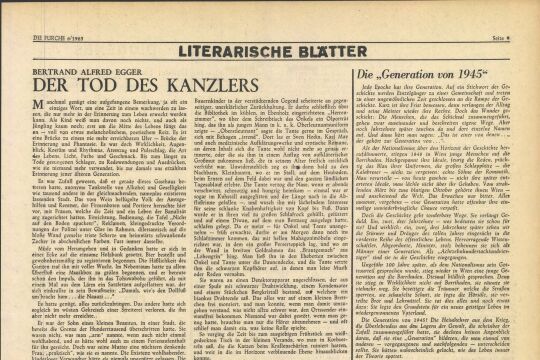Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Luise Rinser
Lange ist es her, daß Luise Rinser zur Literatur zählte. Wie bezeichnend, daß ein marxistischer Literaturkritiker — Heinrich Vormweg, der in Kindlers Literaturgeschichte der Gegenwart über die Prosa-Literatur der Bundesrepublik Deutschland seit 1945 schrieb — nur zwei Werke von ihr aus der ersten Nachkriegszeit kurz erwähnt und alles Nachfolgende verschweigt! Man sieht daran, daß die progressiven Wortführer einer jungen Generation über ihr Werk zur Tagesordnung gegangen sind, unbekümmert darum, daß sie selbst an Radikalität sozialer Gesinnung kaum zu überbieten ist. Diese Mitleidlosigkeit einer Frau gegenüber, die nur aus Mitleid besteht, ist geeignet, gerade bei denen, die ihren Standort nicht teilen, ein gewisses Mitleid hervorzurufen.
Seit je liebt es Luise Rinser, Bekenntnisse abzulegen. Vielleicht wuchs ihr dadurch die große Lesergemeinde zu, die in ihren Worten Lebenshilfe sucht. Daß sie einst literarisch stark begonnen hatte, liegt an die dreißig Jahre zurück. Mehr und mehr glitt sie seit den fünfziger Jahren in Bezirke des Erbaulichen ab. Literarische Anerkennung konnte sie am ehesten noch da beanspruchen, wo ihre menschliche Ehrlichkeit am stärksten zutage trat, in ihren Tagebüchern aus der Zeit von 1968 bis 1972, die sie in zwei Bänden veröffentlichte. „Ich bin in erster Linie ein mitleidender Mensch. Darum fällt mir das Leben heute schwer.” Dem Eindruck solcher Bekenntnisse konnte man sich nicht ganz entziehen. Sie litt an der Zeit, an deren politischem Geschehen sie engagiert Anteil nahm, und schwieg seit fast einem Jahrzehnt als Erzählerin. Jetzt überrascht sie mit einem Roman, den sie „Der schwarze Esel” nennt.
Von Luise Rinser sprechen, bedeutet: an unbewältigte Vergangenheit denken. Sie wurde für sie zu einem Trauma und bildet auch das Thema ihres neuen Romans, der sichtlich autobiographische Züge trägt. Eine oberbayrische Provinzstadt zwischen München und Salzburg ist der Schauplatz des Geschehens. Die Ich- Erzählerin erhält im September 1973 eine Todesanzeige. Die Namen der Hinterbliebenen — Berthie Kaunigger, Klara und Stefanie Martin — sagen ihr zunächst nichts, erst allmählich werden Erinnerungen wach, sie entschließt sich der Teilnahme an der Beerdigung. Es wird eine Fahrt in die Zeit ihrer Kindheit, die sie zum Teil dort verbrachte. Sie bleibt länger als vorgehabt, und ihr Besuch hat unbeabsichtigte Folgen: sie verfolgt das Geschehen in der Stadt bis zum heutigen Tag, erforscht-, in vielen Gesprächen das Schicksal der ihr damals begegneten Menschen, klärt die Widersprüche der Aussagen und gewinnt ein eigenes Bild, wie alles gewesen sein könnte. Die Jahre vor und nach 1945 bekommen noch einmal Leben. Die Kleinstadt wird zur Brennlinse, in der sich Geist und Ungeist der ganzen Zeitspanne einfangen läßt.
Eine Fülle von Figuren bevölkert die Szene. Im Mittelpunkt die beiden Schwestern, entfernte Verwandte der Besucherin, die bucklige Klara, voller Vernunft und Reformeifer, und die Pianistin Stefanie, sensibel und an Migräne leidend, beide Stiefkinder des Lebens, und dazu ihre senile gefräßige Cousine, die dicke Berthie, die im Altersheim auf das Ende ihrer Tage wartet. Der Mann, den man zu Grabe trägt, ist Berthies Vater, dem das Cafe am Marktplatz gehörte. Seine Frau, die Tante Bertha, war bereits 1943 auf den Friedhof gekommen, bei einem Bombenangriff getötet. Wer aber sind die anderen, deren Namen noch auf dem Grabstein stehen: Amalie Kaunin- ger, 1904-43, und Siegfried Kaunin- ger, 1940-41? Wer ist der Vater, wer die Mutter der beiden Schwestern?
In welchen Beziehungen haben all diese Menschen zueinander gestanden? Wer hat in ihrem Leben eine Rolle gespielt? Der Doktor Fleckmann, später Kreisleiter, der sich beim Einmarsch der Amerikaner erschoß? Erich Bernheimer, der Sohn des jüdischen Tuchfabrikanten, Dora Lilienthal, die jüdische Klavierlehrerin, beide zugrunde gegangen im KZ? Peter Niels, der Sohn des Zeitungsverlegers, als Kommunist auf der Flucht erschossen? Der Pfarrer, von dessen Bombentod in der Kirche eine Gedenktafel kündet: „Getötet durch amerikanische Bomben, während er am Altar für die Rettung der Stadt betete”. Wo aber ist die Tafel für alle Menschen, „die von uns, den deutschen Katholiken, den deutschen protestantischen Brüdern in Christo, erschossen, ermordet, vergast, verbrannt wurden?” Wie ein Detektiv dringt die Besucherin ins Dunkel der Vergangenheit. Immer größer wird der Kreis der Menschen von einst, die wieder in ihr Blickfeld treten, derer, die schon unter der Erde sind, und der Lebenden, die sie zu Gesprächen aufsucht. „Schuld oder Nichtschuld, wie das zusammenhängt, wer weiß das?” reflektiert Klara, „dafür ist der schwarze Esel zuständig.” Wer dies ist? „Wenn ich das wüßte. Weil ich es nicht weiß, rede ich ja vom schwarzen Esel.”
So bleibt manches in der Schwebe, auch wenn die einzelnen Menschen der kleinen Stadt in ihrem Tun und Lassen, ihrem Denken und Fühlen greifbar nahe Gestalt bekommen. Sicher hat der Roman literarisch dadurch gewonnen, daß sich seine Verfasserin in ihrem persönlichen Engagement, das über lange Jahre der Kunstgestaltung ihrer erzählenden Prosa im Wege stand, Zurückhaltung auf erlegt hat: „Ich kann alle verstehen, diese kleinen Geschlagenen, die sich vor neuen Katastrophen fürchten. Law-and-order. Im Nest hocken, sich verbergen, vegetieren. Nur keine Revolutionen, nur keine Reformen, die sich zu Revolutionen auswachsen können.” Wer Luise Rinser aber gerade wegen ihres Engagements schätzt, braucht dennoch nicht enttäuscht zu sein — als Grundmelodie ist es auch hier stets vorhanden. Wer jedoch aus Enttäuschung über manches literarisch schwache Werk von ihr sich scheut, nach dem „Schwarzen Esel” zu greifen, dem sei er als ein literarisch beachtlicher, gut lesbarer Zeitroman empfohlen. Auch wer ihre oft so penetrant sentimentale Weltverbesserungssucht nicht mag, muß dies zugeben.
DER SCHWARZE ESEL. Roman von Luise Rinser: S. Fischer, Frankfurt 1974. 271 S. Ln. DM 26.-
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!