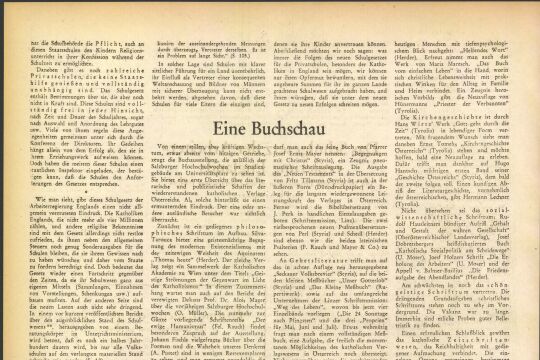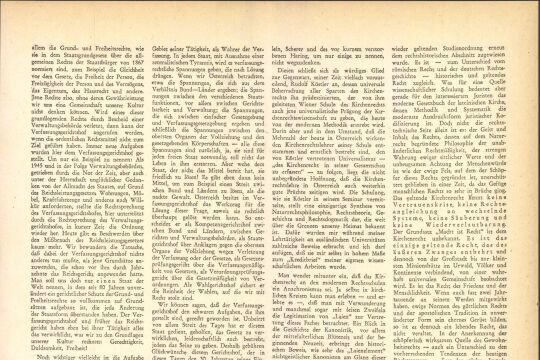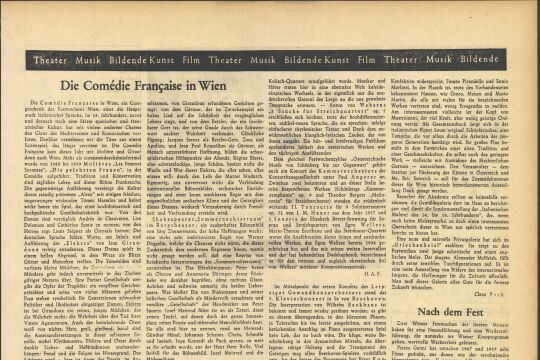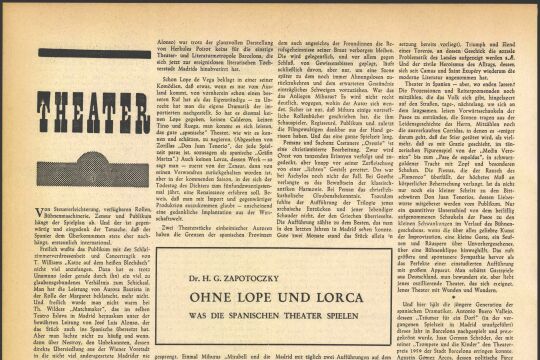Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Mord als Theaterritus
Die Antike gehört nicht mehr zum allgemeinen Vorstellungsbereich der Gebildeten wie noch vor den beiden Weltkriegen, obwohl in jenen Jahrhunderten das Fundament unserer Kultur gesetzt wurde. Wirkt daher die „Orestie“ des Aischylos, die derzeit im Burgtheater aufgeführt wird, als Relikt einer uns kaum mehr berührenden Zeit? Haben die Morde, die da geschehen, keine Beziehung zu uns?
Die Antike gehört nicht mehr zum allgemeinen Vorstellungsbereich der Gebildeten wie noch vor den beiden Weltkriegen, obwohl in jenen Jahrhunderten das Fundament unserer Kultur gesetzt wurde. Wirkt daher die „Orestie“ des Aischylos, die derzeit im Burgtheater aufgeführt wird, als Relikt einer uns kaum mehr berührenden Zeit? Haben die Morde, die da geschehen, keine Beziehung zu uns?
Doch, gerade unser durch und durch rationalistisches Zeitalter ist eines des gigantisch gehäuften Mordens. Wir stehen hierin der Antike keineswegs nach. Allerdings, welch ein Gegensatz! Es hat den Anschein als seien die täglichen Morde für uns zur Selbstverständlichkeit geworden, so sehr, daß man daran zweifelt, ob es überhaupt noch ein Gewissen, eine Bindung an das Überrationale gibt. Die dreiteilige „Orestie“ aber zeigt in den Kräften, die zum Mord treiben, zugleich die gewaltige Gegenwirkung des Gewissens, die Abhängigkeit von einem überirdischen Bereich.
Im ersten Teil „Agamemnon“ kehrt dieser Herrscher aus dem trojanischen Krieg heim und wird von seiner Gattin Klytaimnestra ermordet, weil er seinerzeit bei der Ausfahrt um eines guten Windes für die Schiffe willen beider Tochter Iphigenie der Artemis geopfert hat. Im zweiten Teil „Die Choephoren“ („Die Grabspenderinnen“) rächt der Sohn Orestes die Ermordung des Vaters, tötet die Mutter und ihren nun regierenden Liebhaber Aigisthos. Im dritten Teil „Die Eumeniden“ verfolgen die Erinyen den Muttermörder, er wird entsühnt, die Erinyen wandeln sich in die wohlmeinenden Eumeniden.
Kann Mord die verletzte Ordnung wiederherstellen? Muttermord? Grausige Vorstellung. Orestes zückt den Stahl -wider die Mutter auf göttliches Gebot, Apollon befahl das Furchtbare eben zwecks Wiederherstellung der Ordnung, mit der Drohung, daß Orestes ansonsten „unerträglich bitteres Leid“ erwarte. Doch die Erinyen verfolgen den Muttermörder trotzdem. Gegensätzliche Einwirkung metaphysischer Gewalten. Auch der gottbefohlene Mord macht schuldig, aber Apollon kann den Folgsamen nicht entsühnen. Erst dem Areopag des Volkes ist dies möglich, wobei nun doch wieder die Göttin Athena durch ihren weißen Stein den Ausschlag für den Freispruch gibt.
In vollem Gegensatz zu den so sehr in reinem Rationalismus verfangenen, sich autonom dünkenden Menschen von heute, sind die Gestalten dieser Tragödie völlig eingebettet in transrationale Bezüge, die sich allerdings sehr widersprüchig in göttlichen Personen manifestieren. Es gibt lange Gebete, die Götter ruft man immer wieder an, beruft sich auf sie. Die Tragödie wird zum Gottesdienst der Polis. Doch das anscheinend so bestimmt erfaßte Transzendente erweist sich eben in den Widersprüchen als ein letztlich Unerfaßbares.
Diese dreiteilige Tragödie wurde bei der Premiere in über fünfstündiger Spieldauer aufgeführt, wobei eine Pause von eineinhalb Stunden zwischengelegt war. In weiterer Folge wird sie an zwei Abenden gegeben, der erste Teil am ersten als Vorgeschichte, am zweiten die beiden anderen Teile, in denen Orestes auftritt.
Während der bekannte „progressive“ Regisseur Peter Palitzsch der Meinung ist, die Aktualität werde um so größer, je fremder uns die Zeit erscheine, meinte der Spielleiter der Aufführung Lwca Ronconi, fast alles Griechische nähere das Optische der Gegenwart. Der Bühnenbildner Luciano Damiani ordnet plane, helle Vorhänge an, die immer wieder anders herabgelassen werden, sich mitunter in großen Schwüngen teilen. Klytaimnestra erscheint in einem Schlitz des Vorhanges, der Vorhang selbst wird in unserer Vorstellung zum Palast. Apollon und Athena, Agamemnon und Klytaimnestra, tragen Kostüme einer Phantasie-Archaik, Orestes und die Chöre sind
in die Kleider der Jahrhundertwende gewandet. Diskrepanz: Wenn dieser Orestes in Sakko und langer Hose von Apollon und Zeus spricht.
Merkbar strebt Ronconi, den Stücken entsprechend, eine Monu-mentalisierung an. In „Agamemnon“ entsteht der stärkste Eindruck. Es werden immer wieder andere Statuen seitlich hereingeschoben und ebenso die Protagonisten, die dadurch fast statuenhaft wirken, sich wenig bewegen. Die Bürger als Chor tragen lange Mäntel, bleiben im Dunkel silhouettenartig im Vordergrund als wirkungsvoller Kontrast zum helleren Bereich des eigentlichen Geschehens. Die Grabspenderinnen im zweiten Teil sind schwarz gekleidet — Blusen mit Schinkenärmeln, die Erinyen im dritten erhalten etwas archaisch Verfremdendes als Zusatz. Im weiteren Verlauf der Aufführung läßt allerdings die Dichte der Eindrücke erheblich nach, Ronconi setzt mehr und mehr Gags ein. So wird Orestes dem Areopag auf einem Bett vorgeführt.
Die Darsteller sind — wie in der Antike — vorwiegend Sprecher, das stimmt mit dem weitgehend Statuarischen der Aufführung überein: Norbert Kappen als beherrscht-ernster Agamemnon, Judith Holzmeister als leidenschaftliche Klytaimnestra, Martha Wallner als tragisch-düstere Kassandra, Frank Hoffmann als anmaßender Aigisthos, Joachim Bissmeier als sehr schlichter Orestes, Elisabeth Orth als haßerfüllte Elektra, Sebastian Fischer als hoheitsvoller Apollon, Hilde Krahl als geifernde Chorführerin der Erinyen. Es wird die Ubersetzung von Johann Gustav Droysen verwendet, die in einer Burgtheaterbearbeitung etwas simpler, aber auch sprechbarer wurde. Die großen Vorzüge dieser Inszenierung schmälert mancherlei Zwiespältiges. *
Brecht im Volkstheater
Es gibt Stücke, die sich vor allem durch ihre Hauptfigur lebendig erhalten. Solch eine Gestalt ist der finnische Gutsbesitzer Puntila in dem Volksstück „Herr Puntila und sein Krecht Matti“ von Bertolt Brecht, das derzeit im Volkstheater aufgeführt wird. Für ihn gibt es da eine treffliche Besetzung: Karl Paryla. Er ist gewiß kein Koloß, wie man sich diesen Kerl vorstellt, aber das Saftstrotzende, die Vitalität hat er. Und Paryla kommt ohne Übertreibung aus. Der Regie von Herwig Seeböck fehlt freilich ein Konzept, die zu wenig erkannten Schwächen des lose gefügten Stücks werden um so krasser spürbar, die Schauspieler bleiben merkbar ohne Führung. Als Matti bietet Bernhard Hall nichts als ständige Überlegenheit, die ergiebige Gestalt der Puntila-Tochter mißlingt Brigitte Swoboda. Die anderen verharren in ihren bekannten Klischees. Kristian Schieckel entwarf überaus unruhige Bühnenbilder.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!