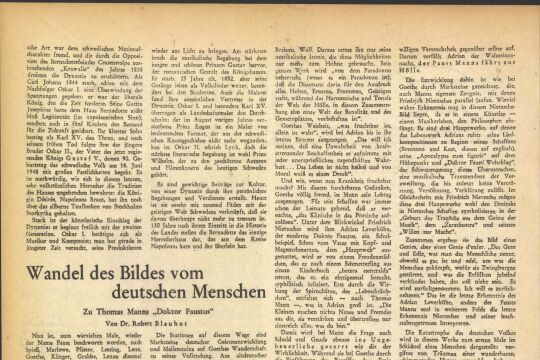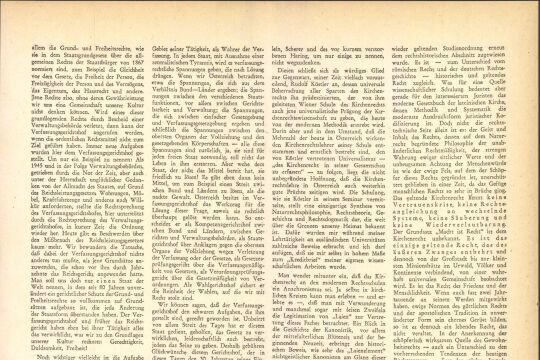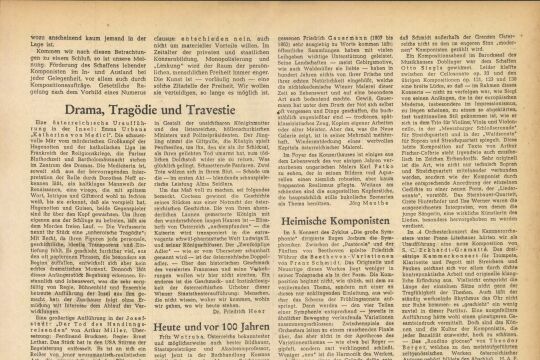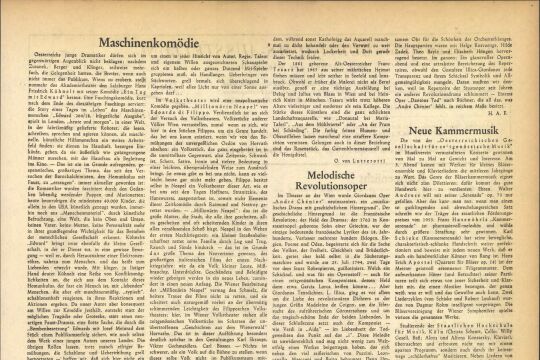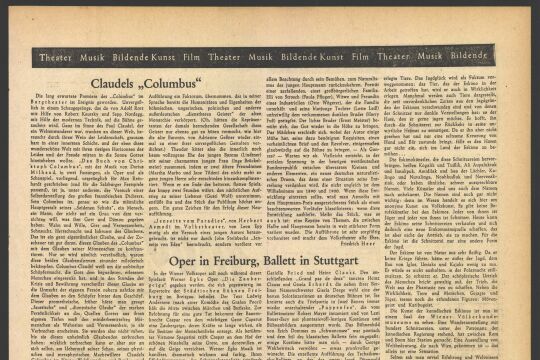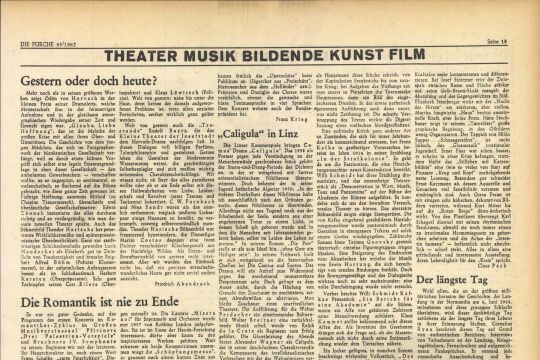Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Das Hohe und das Niedrige
Lessing zitiert im „Laokoon” Winckelmann, wonach die berühmte vatikanische Skulptur den Schmerz des Apollonpriesters nicht zeige. Er verweist aber auch darauf, wie sehr bei den Dichtern jener Zeit, in vollem Gegensatz dazu, die Gestalten weinen und schreien. Goethe folgt ihnen hierin in seiner „Iphigenie auf Tauris” — derzeitige Neuinszenierung im Burgtheater — keineswegs, sondern er wendet das mäßigende antike Prinzip der anderen Kunstgattung, der Bildkünste, wie es damals gesehen wurde, auf seine Dichtung an.
Nur bei Goethe, nicht in der gleichnamigen Tragödie des Euripides, gibt es den großartigen menschlichen Zug, daß Iphigenie die Anwendung von List verabscheut und dem Thoas den geplanten Raub des Götterbildes aufdeckt, wodurch der König zur Milde gestimmt wird. Nur bei Goethe ist die Mitnahme dieses Bildes nicht nötig, da der Götterspruch falsch verstanden wurde, nur da heilt Iphigenie den Muttermörder von seiner Verstörung. Dagegen fehlt die lodernde Dämonie im Wahnsinnsausbruch des Orest, während bei Euripides geschildert wird, wie der Tobende eine Herde Rinder für die Erinnyen hält und die Brüllenden tötet, wodurch „von Mordblut blüht das ganze Meer”.
In Goethes Dichtung spürt man das Streben, den Gewalten der Leidenschaften entgegenzuwirken, das Aufgestörte zu besänftigen und es der Harmonie, dem Gleichgewicht, dem Maß zuzuführen. Für unsere rasant sich überschlagende Zeit, in der dag Ungeheuerliche fast täglich aufspringt, und gerade in diesen Tagen, da ein Apostel der Mäßigung ermordet wurde, wirkt Goethes Dichtung als ein humanes Ziel, an dessen Realitätsmöglichteeit man nur schwer glauben kann, aber so gerne glauben möchte.
Das Apollinische der Dichtung bringt Leopold Lindtberg als Regisseur im Burgtheater zu wohlausgeglichener Wirkung. Da sich meist nur zwei Personen auf der übergroßen Bühne befinden, umgibt diese Menschen Leere, Einsamkeit, was Heinz Ludwig durch das Bühnenbild noch besonders bewußt macht. Dem Klassizismus Goethes werden sowohl Judith Holzmeister als Iphigenie gerecht, indem sie den menschlichen Gehalt der Rolle überzeugend darbietet, als auch Walter Reyer als männlicher Orest, der die Angst vor den Erinnyen nicht übersteigert. Wolfgang Stendar erweist als Pyla- des Lebenszugewandtheit und Energie. Statuarische Verhaltenheit mit Andeutungen des Barbarischen kennzeichnet den Thoas von Erich Auer, rauhere Akzente gibt Gerhard Geister dem Arkas.
Franz Werfel erklärte, Odön von Horvath habe das Niedrige, die Niedertracht als Norm angesehen, das Motto seiner letzten Romane sei Kälte als Schuld. Tatsächlich läßt sich die Dėcouvrierung des Wiener Kleinbürgers als vorwiegend egoistisch. rücksichtslos, falsch auch bei den Gestalten des derzeit im Volkstheater aufgeführten Volksstücks „Geschichten aus dem Wienerwald” letztlich auf Kälte zurückführen. Doch verhält sich der kleine Mann in London, Paris, Berlin kaum anders.
Marianne will nicht die Frau des Fleischermeisters Oskar werden, weil das ihr Leben „verhunzen” würde, sie hat mit dem Strizzi Alfred ein Kind, gerät ins Elend und folgt schließlich doch resignierend dem Abgewiesenen. Die Träume der Menschen verwirklichen sich nicht, folgen sie ihnen, wird dies zum Unheil. Jeder einzelne jagt einem vermeintlichen Glück nach, hat eine meist nur selbstsüchtig bedingte Auffassung vom Nebenmenschen, scheitert daran und sei es in scheinbarer Erfüllung. Die bis in kleinste Redewendungen und Dialogreaktionen meisterhaft gezeichneten Gestalten, ihre verlogene Sentimentalität und moralischen Phrasen, ihr spärliches echtes Gefühl, das nur gelegentlich ihren Egoismus, ihre Kälte durchbricht, die veristische Sicht Horvaths überzeugt, und doch fühlen wir Mitleid mit diesen Menschen mit ihrer Armseligkeit, ihrer Schwäche. Strindbergs „Es ist schade um die Menschen” fällt einem ein.
Gustav Manker kontrastiert als Regisseur die scheinbare Gemütlichkeit mit der nötigen Schärfe. Gerhard Hruby bietet naturalistische Bühnenbilder teilweise fragmentarisch dar. Jutta Schwarz ist als Marianne glaubhaft das schlichte Geschöpf, das ein Opfer seiner Lie- bessehnsucht wird, Bernhard Hall hat in aller Herzlosigkeit das Schlurfhafte des Alfred. Die krasse Selbstsucht von Mariannes Vater wirkt durch Helmut Qualtinger fast dämonisch. Friedl Czepa weiß als Trafikantin Männersucht mit primitivem Charme zu verbinden. Herbert Propst zeichnet als Fleischermeister überzeugend sentimentale Selbstgerechtigkeit. Auch unter den sonstigen Mitwirkenden gibt es trefflich konturierte Gestalten. Ein großer Abend des Volkstheaters mit einem starken Stüde.
Im Theater in der Josefstadt ist derzeit ein etwas antiquiert wirkendes Stück von Franz Molnar zu sehen: „Das Märchen vom Wolf.” In einem Nobelrestaurant wird die Eifersucht eines Ehemannes erregt, als dessen Frau einen Bekannten wiedersieht, der ihr vor sieben Jahren den Hof machte. Nachts träumt sie dann, was er inzwischen geworden sein könnte: ein Kriegsheld, ein Staatsmann, ein großer Künstler, ein Lakai. Die Wirklichkeit enttäuscht sie, er ist Konzipient bei einem Rechtsanwalt in der Provinz. Man sollte dieses Spiel nicht überschätzen. Hans Holmann erweist als Regisseur im ersten und letzten Bild beachtliches Geschick für szenische Valeurs, das Traumbild übersteigert er ins Pompöse. Gertraud Jesserer, Peter Vogel, Kurt Sowinetz, Vilma Degischer bieten gut gezeichnete Gestalten.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!