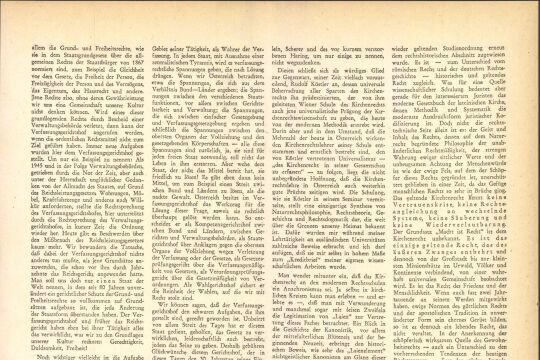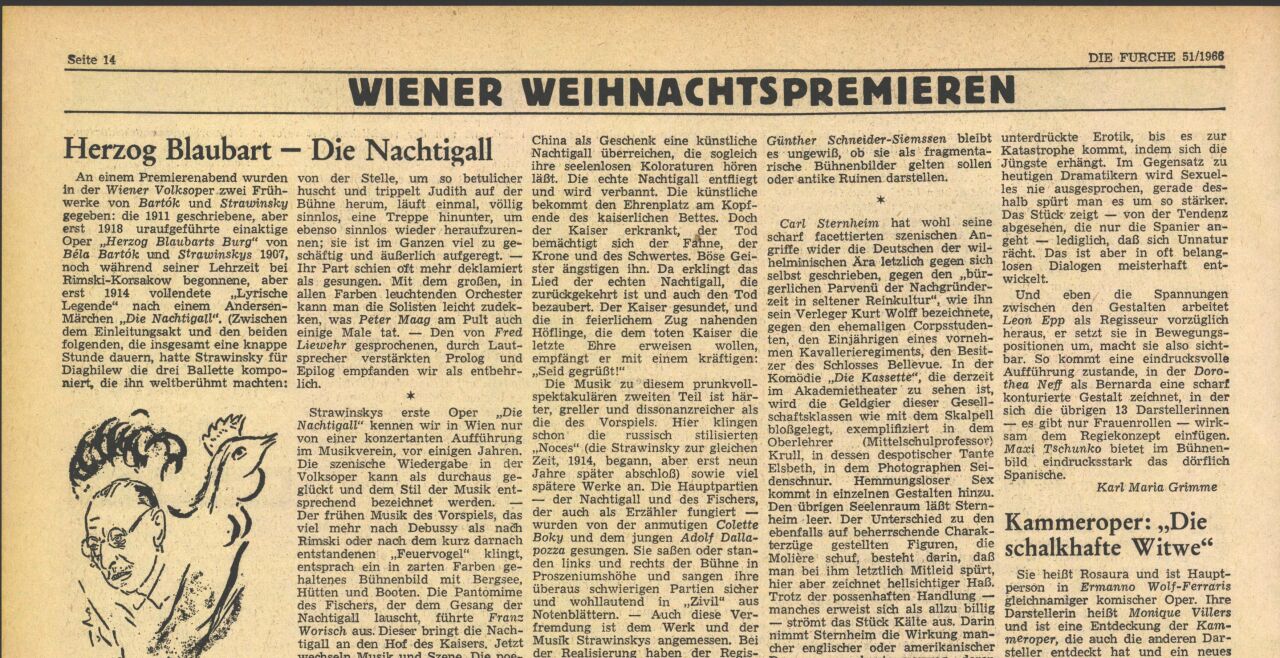
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Von Leidenschaften bedrängt
In einer Zeit, da unterdrückte Rassen um ihre Befreiung kämpfen und die Frage der Mischehen erheblich an Bedeutung gewinnt, könnte es naheliegend erscheinen, Shakespeares Tragödie „Othello“, die derzeit im Burgtheater aufgeführt wird, auf diese Fragestellungen hin zu inszenieren. Doch das wäre verfehlt. Die Rassenfrage hat in diesem Stück kaum nennenswertes Gewicht. Ja, manche Gründe sprechen dafür, daß Shakespeare mit „Othello“ einen Mauren und nicht einen Neger meinte: „Moor“ bedeutet im Englischen erst später auch „Mohr“; Othello zeigt nicht das geringste
Minderwertigkeitsgefühl; er wurde im Haus seines späteren Schwiegervaters zunächst freundlich aufgenommen. Das Thema, das diese Tragödie beherrscht, ist ein anderes: die heimtückische Vergiftung der Arglosigkeit durch Bosheit, durch jene Bosheit, die mit unheimlichem Raffinement fast nur um ihrer selbst willen betrieben wird und deren Urgründe im unerforschlichen Bereich des ewigen Widersacher? liegen.
Obwohl nun Fritz Kortner, der Regisseur der Aufführung, erklärte, daß der Rassenfrage in diesem Stück erhebliche Bedeutung zukomme, legte er seine Inszenierung keineswegs darauf an. Es drängt sich überhaupt keine besondere Auffassung vor, was die Wiedergabe kennzeichnet ist das Akzentuieren des Handlungsablaufs wie der Situationen, das Profilieren der Gestalten durch signifikante Regiedetails vorwiegend optischer Art. Mit besonderer Vorliebe steigert Kortner alles Krasse. Der betrunkene Cassio kollert über eine Treppe (wobei er sich während der zweiten Vorstellung schwer verletzte), Desdemona flieht in ihrer Todesangst vor Othello, der sie dann quer durch den Raum zum
Bett schleift. Da gab es bei der Premiere Pfeifen und einiges Zischen im Zuschauerraum.
Heinrich Schweiger stellt überzeugend den Othello als einen selbstsicher glücklichen, sanft lächelnden Menschen dar, um so heftiger bricht dann die Raserei aus. Romuald Pekny ist ein wenig intellektueller Jago. Erika Pluhar fehlt für die Rolle der Desdemona bei aller Klugheit und Anmut eine stärkere Ausstrahlung. Paula Wessely wirkt als Emilia menschlich warm, doch die Gestalt verlangt Mehrschichtigkeit. Bei manchen der Dekorationen von
Günther Schneider-Siemssen bleibt es ungewiß, ob sie als fragmentarische Bühnenbilder gelten sollen oder antike Ruinen darstellen.
Carl Sternheim hat wohl seine scharf facettierten szenischen Angriffe wider die Deutschen der wilhelminischen Ära letziiah gegen sich selbst geschrieben, gegen den „bürgerlichen Parvenü der Nachgründer- zeit in seltener Reinkultur“, wie ihn sein Verleger Kurt Wolff bezeichnete, gegen den ehemaligen Corpsstudenten, den Einjährigen eines vornehmen Kavallerieregiments, den Besitzer des Schlosses Bellevue. In der Komödie „Die Kassette“, die derzeit im Akademietheater zu sehen ist, wird die Geldgier dieser Gesellschaftsklassen wie mit dem Skalpell bloßgelegt, exemplifiziert in dem Oberlehrer (Mittelschulprofessor) Krull, in dessen despotischer Tante Elsbeth, in dem Photographen Seidenschnur. Hemmungsloser Sex kommt in einzelnen Gestalten hinzu. Den übrigen Seelenraum läßt Sternheim leer. Der Unterschied zu den ebenfalls auf beherrschende Charakterzüge gestellten Figuren, die Moliėre schuf, besteht darin, daß man bei ihm letztlich Mitleid spürt, hier aber zeichnet hellsichtiger Haß. Trotz der possenhaften Handlung — manches erweist sich als allzu billig — strömt das Stück Kälte aus. Darin nimmt Stemheim die Wirkung mancher englischer oder amerikanischer Dramen von heute vorweg, deren Charaktere aber ungleich reicher angelegt sind.
Unter der Regie von Ulrich Er- furth wird das Stück berechtigt ent- wilhelminisiert, womit allerdings das zeitlos Possenhafte stärker hervortritt; mehr ist nicht drin. Theo hingen ergibt sich als Krull dem Komödiantischen, nicht der Charakterisierung, Lotte Ledi als seine junge Frau, Sylvia Lukan als seine Tochter aus erster Ehe, Hilde Wage- ner als Erbtante, Michael Janisch als Seidenschnur, Lotte Tobisch und Otto Schmöle ergänzen in weiteren Rollen die Gesamtwirkung. Ein milieugerechtes Bühnenbild schuf Gottfried Neumann-Spallart.
Wenn sich Federico Garcia Lorca als „glühender Verehrer des Theaters der sozialen Aktion“ bekennt, so wirkt dies in unserem Kulturkreis der Wohlfahrtsstaaten veraltet. Da Lorca in der Frauentragödie „Bernarda Albas Haus“ — Wiedergabe im Volkstheater — sozialen Hochmut, bis zur Lüge übersteigertes Bedachtsein auf den guten Ruf, auf die
„Fassade“, die Ehre — seit je bevorzugtes spanisches Motiv — herausstellt, berührt uns dieser unausgesprochene, aber wohl erkennbare Angriff auf Spaniens dörfliche Lebenseinstellungen lediglich folk- loristisch informativ.
Und doch packt dieses Stück, sieht man von einigen Längen ab. Man wohnt, von uns aus gesehen, einem Experiment bei. „Frauen ohne Mann, weiter nichts“, sagt eine der Mägde der harten, unerbittlichen Bernarda Alba, die ihre fünf Töchter bei „vernagelten Fenstern und Türen“ von der Welt abschließt. Es schwelt unterdrückte Erotik, bis es zur Katastrophe kommt, indem sich die Jüngste erhängt. Im Gegensatz zu heutigen Dramatikern wird Sexuelles nie ausgesprochen, gerade deshalb spürt man es um so stärker. Das Stück zeigt — von der Tendenz abgesehen, die nur die Spanier angeht — lediglich, daß sich Unnatur rächt. Das ist aber in oft belanglosen Dialogen meisterhaft entwickelt.
Und eben die Spannungen zwischen den Gestalten arbeitet Leon Epp als Regisseur vorzüglich heraus, er setzt sie in Bewegungspositionen um, macht sie also sichtbar. So kommt eine eindrucksvolle Aufführung zustande, in der Dorothea Neff als Bernarda eine scharf konturierte Gestalt zeichnet, in der sich die übrigen 13 Darstellerinnen
— es gibt nur Frauenrollen — wirksam dem Regiekonzept einfügen. Maxi Tschunko bietet im Bühnenbild eindrucksstark das dörflich Spanische.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!