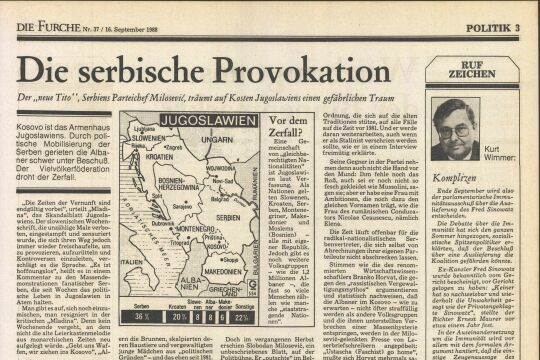"Rasch haben kriminelle Organisationen das Vakuum der nicht funktionierenden Verwaltung gefüllt und die Kontrolle über viele Kompetenzen übernommen."
Es waren keineswegs die lautesten Schüsse der vergangenen Monate, die Oliver Ivanovi ´c, den liberalen Serbenführer im Kosovo, letzte Woche unmittelbar vor seinem Parteibüro in Mitrovica niederstreckten. Die Attentäter kamen aus dem Hinterhalt und verwendeten einen Schalldämpfer, um möglichst leise zuzuschlagen. Wenig später verbrannten sie ihr Fahrzeug und flüchteten unerkannt zu Fuß.
Immer wieder kommt es in der nordkosovarischen Stadt zu Morden auf offener Straße, von denen die meisten Menschen außerhalb des Landes jedoch nur selten Notiz nehmen. Der politisch motivierte Mord an Ivanovi´c aber erregte internationale Aufregung und zeigt deutlich, wie instabil der trügerische Frieden im Kosovo ist. Wer genau hinter dem Mord steckt, ist immer noch unklar. Neben serbischen und albanischen Nationalisten profitiert auch die organisierte Kriminalität durch eine Destabilisierung des Landes.
Leben in einer geteilten Stadt
"Wir wohnen in einer geteilten Stadt, in der die Menschen fast komplett isoliert voneinander leben", erzählt Igor, ein 40-jähriger Sozialarbeiter aus Nord-Mitrovica. Die Stadt -auf Serbisch Kosovska Mitrovica, auf Albanisch Mitrovicë -wird durch den Fluss Ibar in einen fast ausschließlich von muslimischen Albanern bewohnten Süden und einen von christlichorthodoxen Serben dominierten Norden getrennt. Eine große Brücke würde die beiden Stadtteile eigentlich miteinander verbinden, stattdessen steht sie aber seit dem Ende des Kosovokrieges vor knapp 20 Jahren symbolträchtig für eine rigorose Trennung der Ethnien.
"Beide Teile sind administrativ und politisch getrennte Einheiten", schildert Igor die Situation. Fahrzeuge queren die Hauptbrücke im Stadtzentrum bis heute nicht. Wer in den anderen Teil gelangen will, nimmt eine der außerhalb gelegenen Brücken oder geht zu Fuß. "Muss man auf die andere Seite, schraubt man zuerst mal seine Kennzeichen ab, um nicht aufzufallen", lacht er verlegen. Tatsächlich führt kaum ein Auto in Mitrovica ein Nummernschild, eine ethnische Zuordnung - je nachdem, ob serbische oder kosovarische Kennzeichen verwendet werden -könnte fatale Folgen für Auto und Fahrer haben.
Die anhaltenden ethnischen Differenzen haben zu einer politischen Instabilität geführt. "Staatliche Institutionen werden da wie dort nicht ernstgenommen. Die Menschen vertrauen weder Polizei noch der Politik", analysiert Igor die Situation. Rasch haben kriminelle Organisationen das Vakuum gefüllt und die Kontrolle über viele Kompetenzen in der Stadt übernommen. Dazu zählen Bereiche der Schattenwirtschaft, aber auch der Menschen-und Drogenhandel, der im Kosovo immer mehr zum Problem wird.
Das Attentat auf Ivanovi´c kam zum denkbar unpassendsten Zeitpunkt, denn eigentlich sollten eine serbische und eine kosovarische Delegation am selben Tag in Brüssel über eine Normalisierung der Beziehungen und die Zukunft des Kosovos verhandeln. "Es sind vor allem junge Menschen, die unter den katastrophalen Zuständen leiden", empört sich Igor. Nur wenige Jugendliche haben sich mit Gleichaltrigen auf der anderen Seite ausgetauscht, selten gibt es die Möglichkeit zum Kennenlernen. Die gegenseitige Ablehnung basiert auf tragischen Erfahrungen und der scheinbar endlosen Gewaltspirale in der Stadt.
Am Ufer des Ibar sitzt der Kosovoalbaner Edin in einem der vielen Kaffeehäuser mit Blick auf den serbischen Stadtteil. "Niemals würde ich auf die andere Seite gehen", meint der 26-Jährige kopfschüttelnd. "Viel zu gefährlich", fügt er rasch hinzu. Als der Konflikt begann, waren viele Jugendliche noch gar nicht geboren. Ihre Kindheit wurde von traumatischen Ereignissen geprägt. "Ich kann mich an die Kämpfe in der Stadt erinnern", schildert Edin bruchstückhaft seine Erinnerungen. "Irgendwann sprach mein Vater davon, dass wir nach vorne blicken müssen, dass es weitergehen muss." Doch die Schrecken des Krieges holten die Familie rasch ein. "Eines Abends kam mein Vater nicht mehr nach Hause. Meine Mutter hat mir später erzählt, dass man ihn erschossen hat", sagt Edin mit trostlosem Blick.
Die gleichen Schicksale
Im serbischen Stadtteil unterscheiden sich die Erzählungen nicht von jenen im Süden. Auch hier berichten Jugendliche, wie die 20-jährige Aleksandra, schonungslos von Gewalttaten, die sie beim Erwachsenwerden begleiteten. "Mein Onkel stieg eines Morgens in sein Auto und fuhr zur nächsten Ampel. Dann kam ein Albaner, der vor dem Krieg sein Nachbar war, und schoss ihm durch die Scheibe ins Gesicht", berichtet die junge Dame über eine Tat, die sich erst Jahre nach Kriegsende ereignet hat.
"Die Wildwestmentalität in dieser Stadt hat nie aufgehört", ist sich Igor sicher. Der jüngste Mord unterstreicht diese Ansicht deutlich. Auch Oliver Ivanovi´c hat die kriminellen Zustände in Mitrovica immer wieder offen angeprangert.
Langsam spaziert Igor durch einen heruntergekommenen Stadtteil im Norden, wo immer noch viele Gebäude in Trümmern stehen. Ein alter Mann durchsucht Mülltonnen nach brauchbarem Abfall, eine Rotte streunender Hunde bellt unaufhaltsam neben einem KFOR-Jeep, in vielen Fenstern sind Einschusslöcher zu erkennen. Die Szene wirkt bedrückend. Man kann sich nur schwer vorstellen, wie es sein muss, in diesem Umfeld aufzuwachsen. Für positive Gedanken und Optimismus scheint kein Platz in dieser Perspektivenlosigkeit. Langsam zieht Igor an seiner Zigarette und hält für einen kurzen Moment inne, bevor er seiner Verzweiflung Luft macht: "Ich verstehe nicht, dass wir nicht nur unser eigenes Leben, sondern auch das unserer Kinder durch Hass vergeuden".
Alkohol, Drogen, Depressionen. Diese Probleme kennt Igor bei Jugendlichen im Norden nur zu gut. "Wir versuchen etwas Abwechslung in den tristen Alltag zu bringen", gemeint sind Fotoworkshops, Filmabende und Musikveranstaltungen. Um das isolierte Leben der jungen Menschen aufzubrechen, weiß Igor, bedarf es aber eines Austauschs zwischen den albanischen und serbischen Jugendlichen. "Nur so haben wir die Möglichkeit einer gemeinsamen Zukunft", ist sich der Sozialarbeiter sicher.
Projekte gegen den Hass
Als größte Erfolgsgeschichte gilt die "Mitrovica Rock School". Seit knapp zwei Jahrzehnten bringt das von der NGO "Musicians Without Borders" gegründete Projekt junge Musiker aus beiden Teilen der Stadt zusammen und versucht damit, vor allem auch in den Köpfen anderer Teenager Barrieren aufzubrechen.
"Es geht darum, jungen Menschen zu zeigen, dass Hass überwunden werden kann", ist sich Igor sicher. Schon beinahe eine Berühmtheit ist die Band "Proximity Mine", die aus serbischen und albanischen Musikern besteht und neben zahlreichen Städten am Balkan auch in Wien gastierte. Es geht den Musikern und den Veranstaltern aber nicht darum, eine politische Botschaft zu transportieren. "Wir wollen vielmehr aufzeigen, dass serbische und albanische Jugendliche nicht so unterschiedlich sind und gemeinsam Großartiges leisten können", sagt Igor mit freudigen Augen. Was noch fehlt, ist ein Konzert der Gruppe in Mitrovica selbst. Das war aus Sicherheitsgründen bislang nicht möglich, zu groß waren die Anfeindungen und Drohungen im Vorfeld.
"Irgendwann werden wir auch dieses Ziel erreichen", ist sich Igor sicher und beendet den Spaziergang vor seinem Jugendheim, in dem schon sehnsüchtig mehrere Teenager auf das Programm des heutigen Abends warten. "Manchmal geht es einen Schritt zurück, und dann geht es wieder zwei nach vorne", lächelt Igor etwas verlegen und verschwindet hinter einer beschädigten Glastüre.
Der Optimismus des Mannes scheint trotz aller Tristesse grenzenlos. Es bleibt nur zu hoffen, dass der Mord an Oliver Ivanovi´c seine Bemühungen nicht um allzu viele Schritte zurückgeworfen hat.