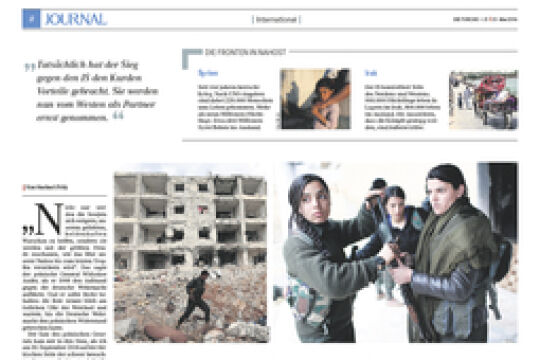Vertrieben und vergessen: Aufgerieben im Krieg zwischen türkischer Armee und PKK ist die kurdische Landbevölkerung vor zehn Jahren in die Städte geflüchtet. Dort hausen sie in den Slums und hoffen, dass die Europäische Union ihre Rückkehr durchsetzen kann.
Weil wir von unseren Dörfern vertrieben wurden, fristen wir ein elendes Dasein in Hoffnungslosigkeit. Wir sind hungrig, unbekleidet, heimatlos und allen Eigentums beraubt. Weil unsere Dörfer entvölkert wurden und die Menschen in die Städte drängten, können wir keine Arbeit finden. All unsere Versuche, unser Eigentum in den Dörfern zu schützen und unser früheres Leben wieder aufzunehmen, scheiterten. Wir haben unzählige Male an die Behörden appelliert - ohne Erfolg." Diese verzweifelte Botschaft richtete ein Kurde, der aus Angst vor Schikanen durch die türkischen Behörden seinen Namen lieber verschweigt, an internationale Menschenrechstorganisationen.
Fünf Jahre nach Ende der von der "Kurdischen Arbeiterpartei" PKK geführten Rebellion ist das Leid der wahren Opfer dieses Krieges ungelindert. Hunderttausende kurdische Dorfbewohner verloren in den 90er Jahren ihr gesamtes Hab und Gut und hausen unter elenden Bedingungen in den Slums türkischer Städte. Hilfe bleibt ihnen verwehrt, weil der türkische Staat diese Katastrophe ignoriert. Nun macht die Europäische Union die Rückkehr der Vertriebenen zu einer zentralen Forderung in ihren für Oktober geplanten Fortschrittsbericht für die Türkei. "Ich glaube, man sollte den Wunsch der Menschen, in ihre Dörfer zurückzukehren entschieden unterstützen", stellt EU-Kommissar Günter Verheugen fest. Und er pocht auf einen konkreten Plan zur Rückführung.
Unbemerkte Vertreibungen
"Kein anderes Menschenrechtsproblem der Türkei" betrifft laut Human Rights Watch (HRW) so viele türkische Bürger direkt. Doch die internationale Öffentlichkeit weiß wenig darüber. Im Gegensatz zu den Vertreibungen in Bosnien, habe im türkischen Kurdengebiet "niemand die Zwangsmigration beobachtet und dokumentiert", erinnert Necdet Ipekyüz von der Ärztegemeinschaft in Diyarbakir, einer Stadt im Südosten der Türkei nahe der Grenze zu Syrien. "Presse und Fernsehen wurden der Zutritt verwehrt."
Politik der verbrannten Erde
Vor einem Jahrzehnt, als in Südostanatolien ein heftiger Krieg um die Anerkennung der Rechte des kurdischen Volkes tobte, suchte die türkische Armee Zuflucht zur Strategie der "verbrannten Erde", um den kurdischen Guerillas den Boden zu entziehen. Verzweifelte Appelle drangen damals in die Welt: "Die Soldaten kamen und vernichteten unsere Vorräte. Wir besaßen vier Tonnen Weizen, Wälder und Weideflächen rund um das Dorf, und mehr als 20 Gebäude. Alles wurde niedergebrannt. Als sie uns aus dem Dorf jagten, töteten sie alle Tiere." So schilderte Mehmet M. in einer an den Regionalgouverneur gerichteten Petition das Schicksal seiner Familie und seines Heimatdorfes in der Provinz Siirt.
Während des 15-jährigen Krieges wurden zwischen eineinhalb und drei Millionen Kurden vertrieben, rund 3.000 Dörfer zerstört, Felder und Weiden vermint, Wälder niedergebrannt. Nur jene Dörfer blieben verschont, deren Bewohner sich als "Dorfschützer" in den Kampf des Staates einspannen ließen. Die Sicherheitskräfte, so HRW, "gingen in illegaler Weise und völlig willkürlich gegen die Dorfbewohner vor". Ein großer Teil der Vertriebenen verlor alles: den Besitz, die Existenz, aber auch die soziale Umwelt. Sie suchten in nahen Städten oder im Westen der Türkei Zuflucht, oft in feuchten Kellern, in Baracken. Rund fünf Prozent der Vertriebenen hausen heute noch in Zelten.
Würde und Arbeit verloren
Im Gegensatz zu der in Entwicklungsländern üblichen Landflucht, geht es hier aber um Menschen, die nicht in den Städten leben wollten. Wiewohl viele auch daheim arm waren, besaßen sie doch genug zum Überleben. Sie waren stolz, dass sie mit Hilfe ihrer Tiere das Nötigste selbst produzieren konnten. In den Slums der Städte verloren sie nun ihre Würde. Sie haben nichts anderes gelernt als Feldarbeit. "Was können wir hier in den Städten schon tun", fragt ein Mann aus Cinar in der Region Diyarbakir. "Wir sind Betonstraßen nicht gewohnt." Um nicht verhungern zu müssen, schicken viele ihre Kinder zur Arbeit: zu Baustellen, in Kleidergeschäfte, zum Schuhputzen. In die Schule gehen nur wenige.
Geächtet und verhöhnt
Die elenden Lebensbedingungen, zusammengepfercht in feuchten Behausungen oft mit einem Dutzend und mehr Mitbewohnern und die Mangelernährung fördern Krankheiten. Doch medizinische Hilfe ist für diese Menschen unerreichbar und unbezahlbar. Zudem fühlen sich viele von ihnen ausgestoßen und von den Türken in ihrer neuen Umgebung geächtet. Oft werden sie verhöhnt, wenn sie des Türkischen nicht mächtig sind, und man beschimpft sie als "Verräter", verweigert ihnen Arbeit und Unterkunft.
Fast alle Vertriebenen, das ergeben Umfragen, sehnen sich nach Rückkehr. Menschenrechtsorganisationen nennen einige Faktoren, die die Rückkehr blockieren: Sie reichen von mangelnder Unterstützung durch die Regierung bis zu Gewaltakten durch die die Region kontrollierenden Gendarmen und paramilitärischen Einheiten. Oft verbieten die Behörden den Kurden die Rückkehr unter dem Vorwand, ihr Dorf liege in einem militärischem Sperrgebiet.
Behördenzorn ausgeliefert
Manchmal erhalten Vertriebene zwar eine mündliche Rückkehrgenehmigung. Wenn sie aber dann zu ihrem Dorf gelangen, werden sie von Gendarmen oder Dorfwächtern verjagt. In anderen Fällen zwingen die Behörden Kurden zur Unterschrift unter einen Text, in dem die Schuld an der Zerstörung ihres Dorfes der PKK zugeschoben wird. Wenn die Betroffenen die Unterschrift verweigern, wird ihnen die Heimkehr untersagt. Noch größere Schwierigkeiten erleben Kurden, die zu Rechtsmitteln Zuflucht suchen. Damit ziehen sie sich oft den Zorn der Behörden zu, die ihnen dann jegliche Unterstützung verweigern. Eine Gruppe von Anwälten, die sich für Vertriebene eingesetzt hat, wurde monatelang von den Behörden schikaniert, eingeschüchtert und gar vor Gericht gebracht - schließlich jedoch freigesprochen.
Am meisten, so berichten Dorfbewohner, hält sie die Angst vor den so genannten Dorfschützern von der ersehnten Rückkehr ab. Fünf Jahre nach Kriegsende haben sich diese Dorfschützer nach den Worten eines türkischen Journalisten als "neue soziale Kaste" etabliert, die ihr Unwesen treibt, und dies, obwohl schon 1995 eine Kommission des türkischen Parlaments bestätigte, dass es sich hier um eine zutiefst korrupte und destruktive Institution handle. Die parlamentarische Kommission drängt deswegen die Regierung, das System aufzulösen. Heute gibt es aber immer noch rund 90.000 Dorfwächter, die vom Staat gut bezahlt und mit Waffen ausgerüstet werden. Sie haben häufig Häuser und Besitz der Vertriebenen übernommen und weigern sich jetzt, diese zurückzugeben. Das Dorfschützer-System baut auf dem alten Stammes- und Feudal-System auf, das damit neu belebt wurde und den Bemühungen, die Türkei zu einem europareifen Staat zu entwickeln, einen schweren Rückschlag zufügt hat.
Geheimer Plan Ankaras?
Für Menschenrechtsorganisationen ist klar: Wenn die Regierung behauptet, sie hätte bereits Dörfer für Vertriebene errichtet, so handle es sich dabei um Siedlungen für Dorfschützer, die durch Attacken der PKK ihre Häuser verloren haben. Viele Kurden, die sich geweigert hatten, dem Staat als Dorfschützer zu dienen und deshalb alles verloren, sind heute überzeugt, dass Ankara einen geheimen Plan verfolgt: Ein strategisches Netz an Siedlungen soll errichtet werden, überwacht von Gendarmerieeinheiten, die in nahen Kasernen untergebracht sind. Der Rest des Landes bleibt unbewohnt.
Ende kurdischer Identität
"Wir werden nie zurückkehren können", fasst ein kurdischer Bauer die Überzeugung vieler Leidensgenossen zusammen. "Der Staat will, dass wir entwurzelt in der Masse der Türken in den Städten unsere kurdische Identität verlieren." Ankara blockiert aber nicht nur jegliche internationale Hilfe. Auch humanitäre Organisationen wurden abgewiesen und lokale Gruppen mit der Drohung eingeschüchtert, man werde sie wegen Unterstützung der PKK vor Gericht bringen. "Die türkische Regierung", klagt HRW, "versäumt ihre Sorgepflicht für interne Flüchtlinge. Es ist ihre gesetzliche Pflicht, den Opfern Entschädigung zu gewähren."
Zu diesem Zweck hat das türkische Parlament im Juli ein Gesetz erlassen. Ein wichtiger Schritt. Doch ob der Gesetzestext umgesetzt wird, bleibt fraglich. In den vergangenen Jahren haben die Behörden stets sorgsam jegliche Niederschrift über die Vertreibungen vermieden, um die Anrufung von Gerichten zu erschweren. Und offiziell streitet die um Europareife ringende Türkei die Verantwortung für dieses Unrecht bis heute nach wie vor ab.
Die Autorin ist Nahost-Korrespondentin.