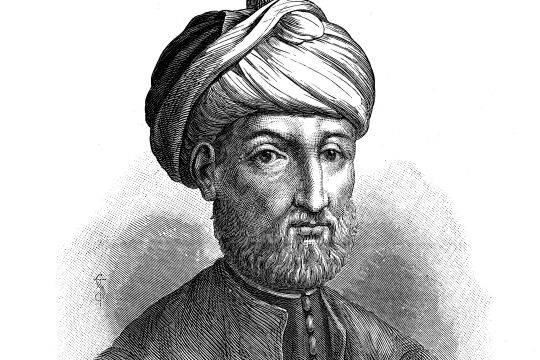Islamischer Wert Friede
Nach dem Attentat vom 2. November ist Dialog mit dem Islam dringlicher denn je. Aber religiös unterfütterte Ideologien wie Neo-Osmanentum à la Erdoğan machen ihn hierzulande noch schwieriger.
Nach dem Attentat vom 2. November ist Dialog mit dem Islam dringlicher denn je. Aber religiös unterfütterte Ideologien wie Neo-Osmanentum à la Erdoğan machen ihn hierzulande noch schwieriger.
Wechselseitiger Respekt. Keine Frage, dass in diesen traurigen Tagen zunächst nur das weiße Band der Gemeinsamkeit der großen Weltreligionen und der wechselseitige Respekt uns einen Weg der Heilung aus dem Trauma des Terrors weisen kann. Mit Kanadas Premier Justin Trudeau ergänze ich auch, dass – ich zitiere Trudeau – die Meinungsfreiheit nicht unbegrenzt ist, und wir es uns selbst schuldig sind, mit Respekt vor anderen zu handeln und zu versuchen, diejenigen, mit denen wir eine Gesellschaft und einen Planeten teilen, nicht willkürlich oder unnötig zu verletzen. Ich bin froh und dankbar über all die Zeichen der Solidarität und Gemeinsamkeit, die es in Frankreich und in Österreich nach den letzten Terroranschlägen gegeben hat.
Die best practice der heutigen christlich-jüdischen Zusammenarbeit, die durch solch prägende Gestalten wie Jules Isaac und Kardinal Bea schließlich in das 2. Vatikanische Konzil einmündete, kann auch dem Islam im 21. Jahrhundert zum Vorbild dienen.
Der Nährboden des Antisemitismus
Dabei wäre – 82 Jahre nach den Novemberpogromen 1938 – zunächst die Lehre der Vergangenheit in Europa nicht zu vergessen. Der weltweite Islam und auch der Islam in Österreich muss, wie die christlichen Kirchen nach dem Zweiten Weltkrieg, Methoden finden, um intolerante, antisemitische und autoritäre Denkmuster, die sich über die Jahrhunderte festgelegt und verfestigt haben, endlich durch eine Ökumene der „Menschen guten Willens“ (Papst Johannes XXIII.) zu überwinden. Als katholischem Christen ist mir total bewusst, dass der Antisemitismus der Nazis untrennbar mit dem katholischen und protestantischen Nährboden eines Karl Luegers und Martin Luthers verbunden war, ja, dass er sogar an einige verhängnisvolle Formulierungen im Neuen Testament zurückreicht.
Auch die erst in den 1970er Jahren überwundenen autoritär-faschistischen Regime in Spanien und Portugal und zahlreiche Militärregimes in Lateinamerika wären ohne die katholische Kirche undenkbar gewesen, ebenso die mit Hitler verbündeten Satellitenstaaten in Kroatien und in der Slowakei. Der Primas der katholischen Kirche Deutschlands, Kardinal Adolf Bertram, ließ 1945 in der Diözese Breslau noch Requien für Hitler feiern.
Die Schule von Ankara
Die Gründergeneration der türkischen Republik war sich der Lasten der Vergangenheit des Osmanischen Reichs und des Kalifats sehr wohl bewusst. Schon 1948 forderte das türkische Parlament: „Wir brauchen eine Theologie wie im Westen!“, was in der Gründung der theologischen „Schule von Ankara“ 1949 seine interessante und positive Konsequenz hatte. Der Koran, so wie bei den protestantischen und katholischen Reformtheolog(inn)en des 19. und 20. Jahrhunderts die Bibel, wird nicht mehr als zeitlose Offenbarung betrachtet, sondern als aktuelle Rede Gottes an eine bestimmte Gruppe Menschen zu einer bestimmten Zeit.
Demzufolge lässt sich die übergeschichtliche Botschaft des Koran erst durch Einordnung seines Textes in diesen historischen Kontext erschließen. Schon vor Jahren haben die großen politischen Stiftungen in Deutschland – die Ebert-Stiftung durch Jesuitenpater Christian Troll und die Adenauer-Stiftung durch den Orientalisten Andreas Jacobs – in bahnbrechenden Artikeln auf das Potenzial des „progressiven Denkens im Islam“ bezie hungsweise den „Reformislam“ hingewiesen. Die Propagandavideos, die der Wiener Attentäter Kujtim Fejzulai und so viele Dschihadisten vor und nach ihm sahen und sehen werden, haben keine theologische Basis im Islam. Ankara-Theolog(inn)en gehen so weit, dass nur etwa zehn Prozent dessen, was der Koran aussagen will, sich auch im Text finden ließe, der Rest sei vor dem Hintergrund der jeweiligen Zeit interpretationsbedürftig. Die historisch-kritische Sichtweise war schon der Schlüssel für die moderne christliche Theologie des 19. und 20. Jahrhunderts, die Mühlsteine der Relikte einer dunklen Vergangenheit hinter sich zu lassen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!


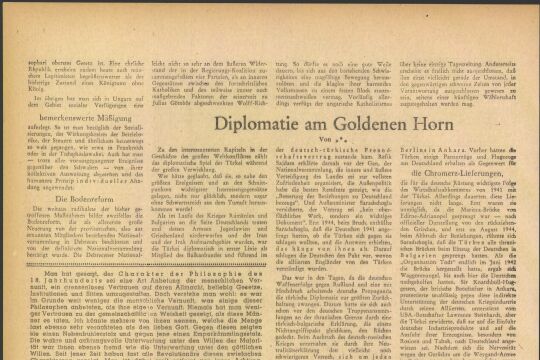
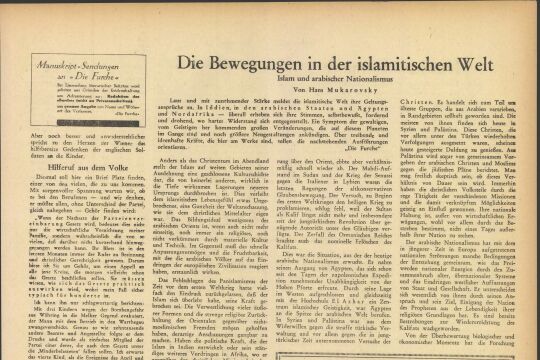
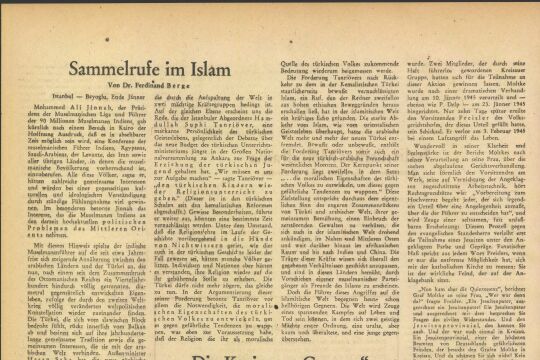
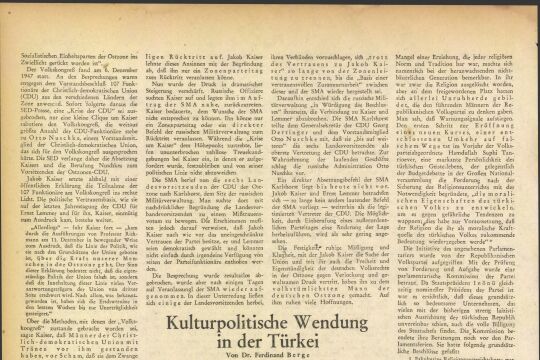
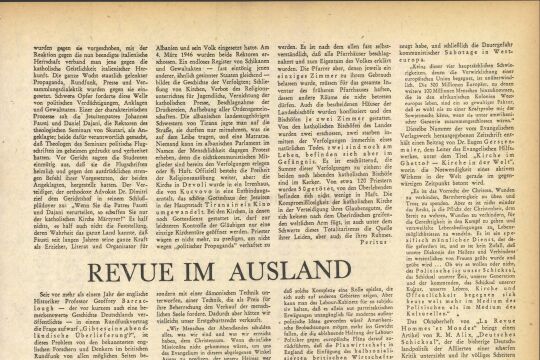
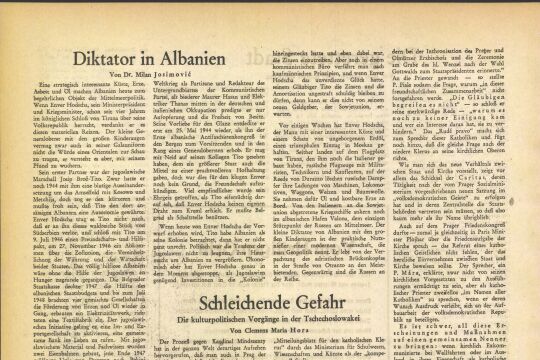
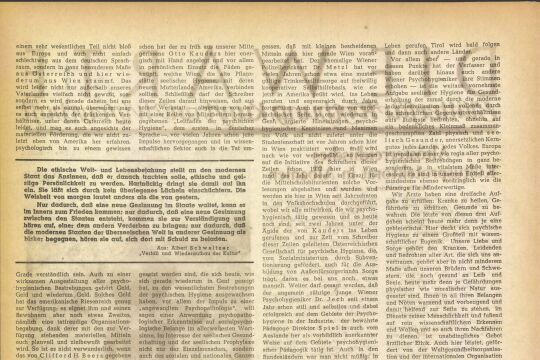
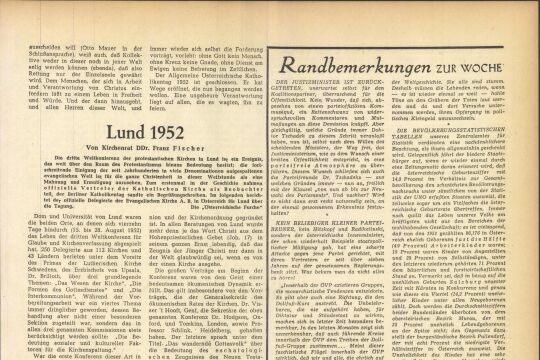

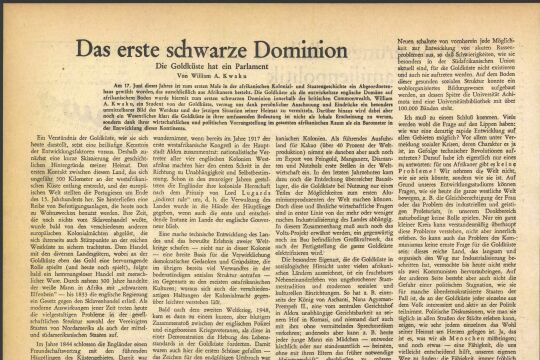
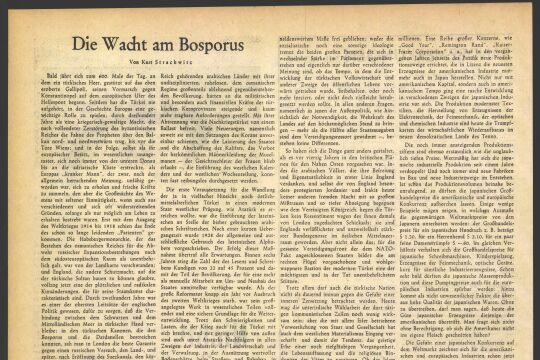
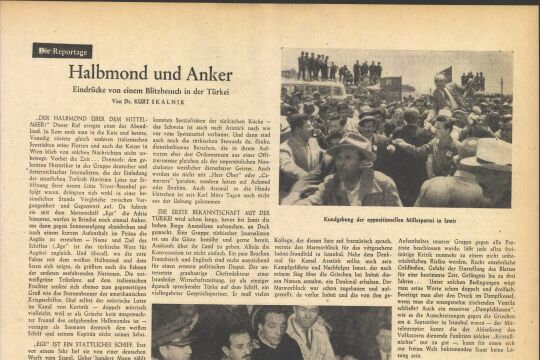

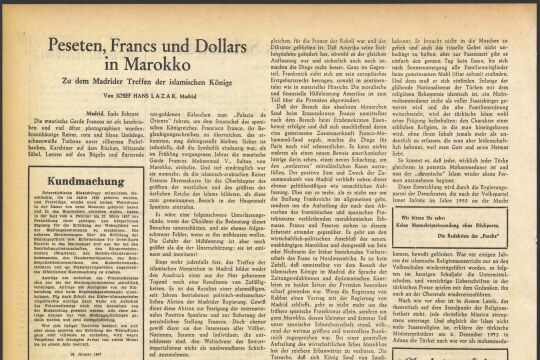
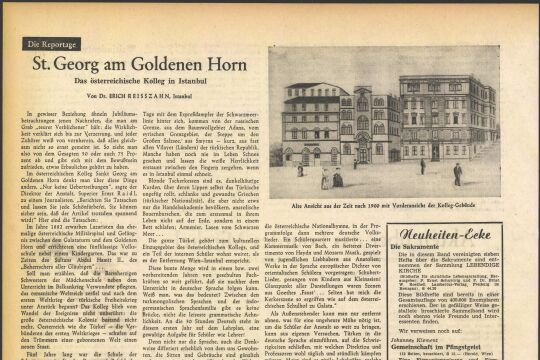

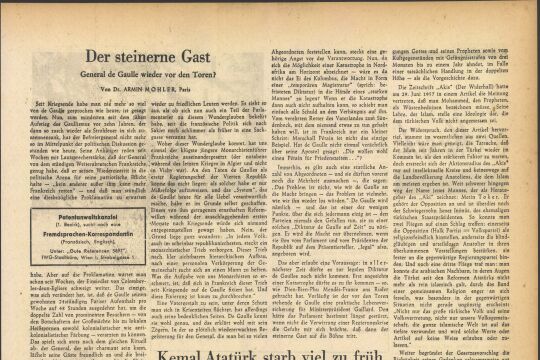
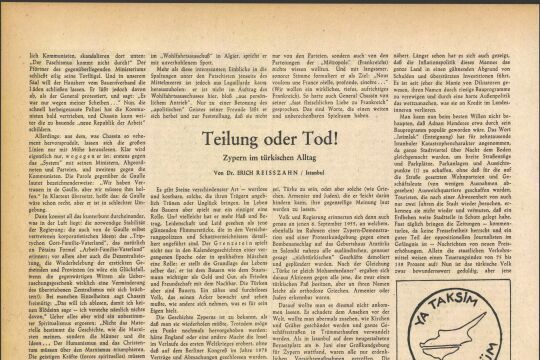
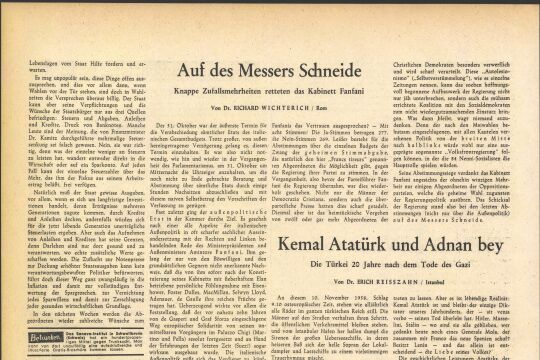

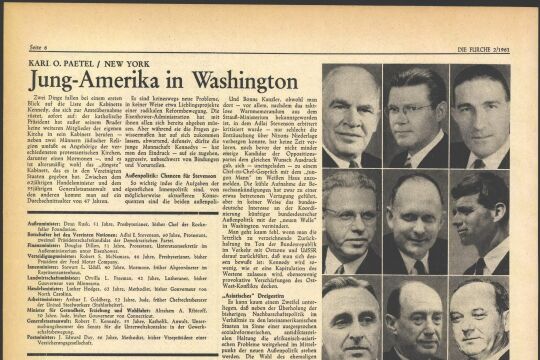
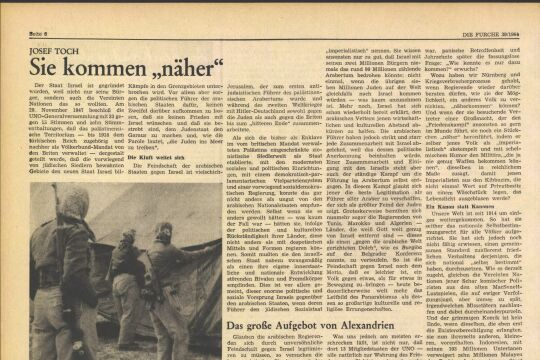
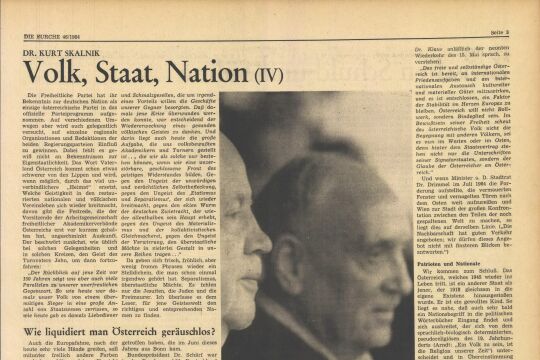
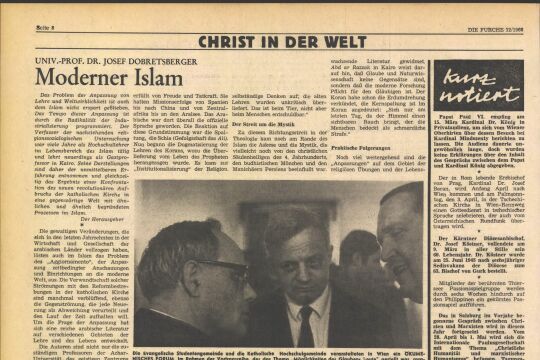
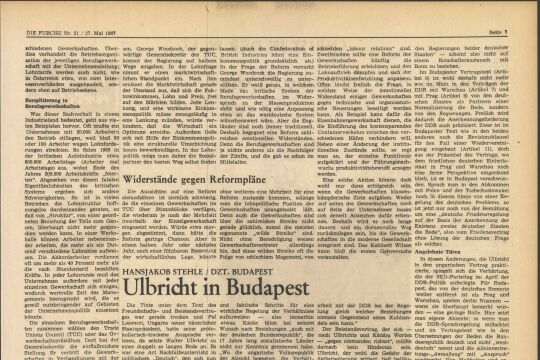

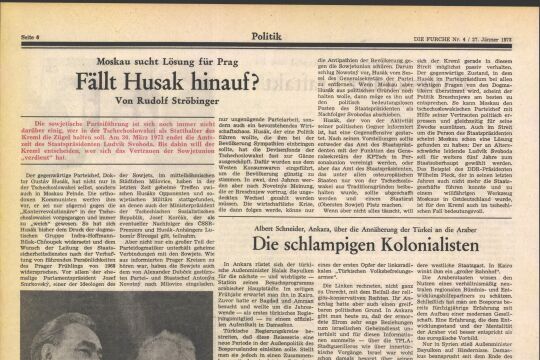
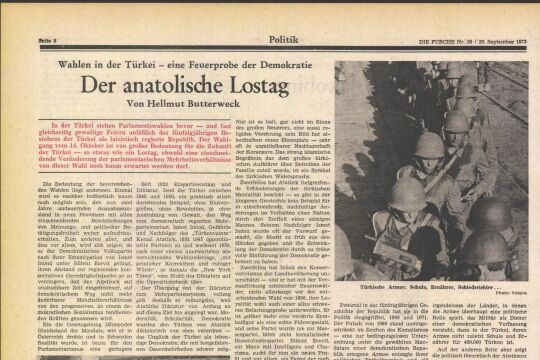
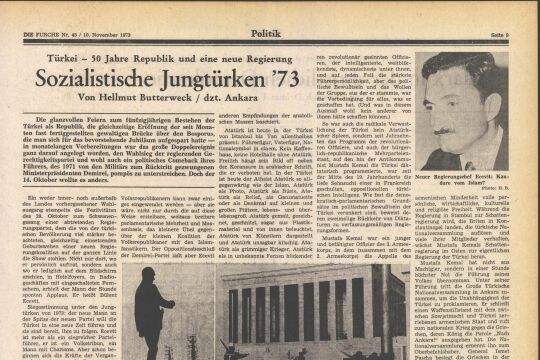
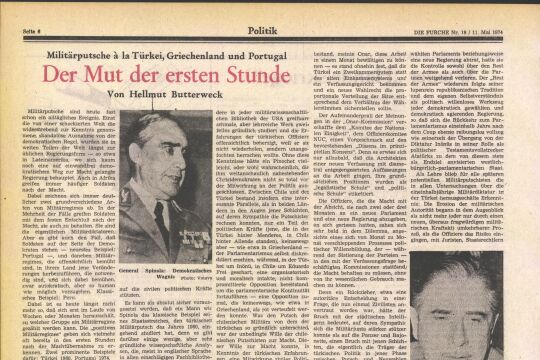
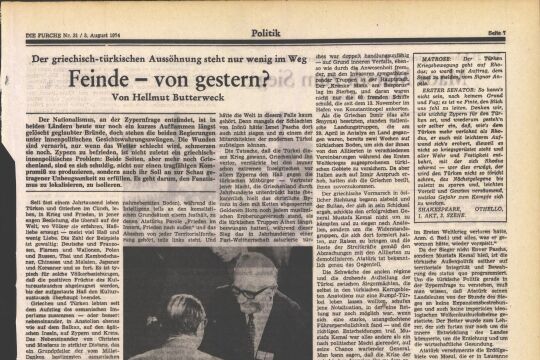
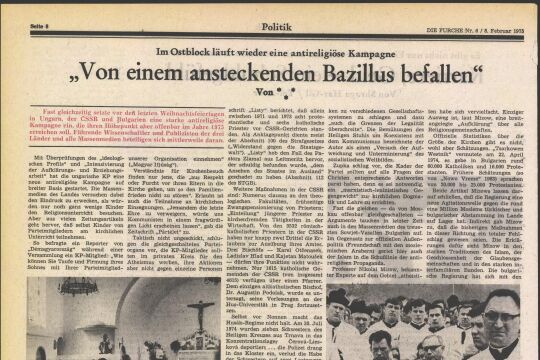
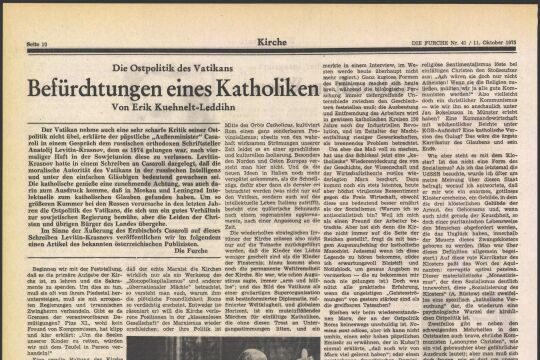
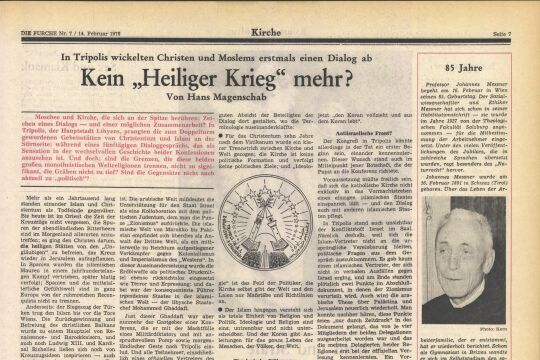



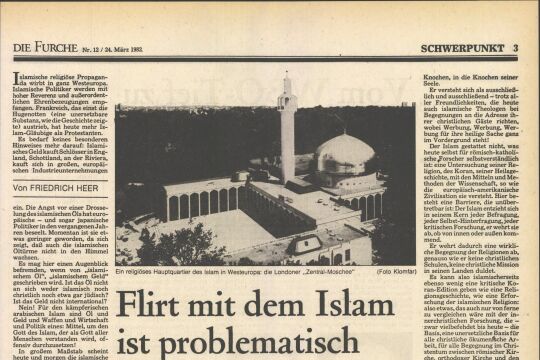

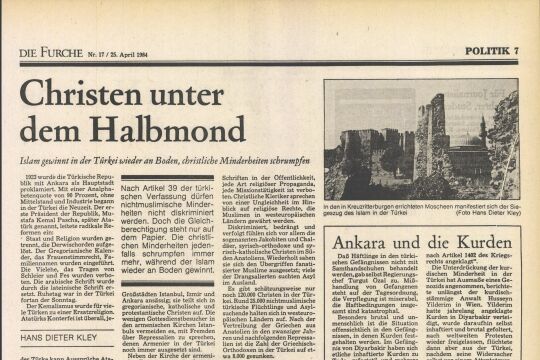

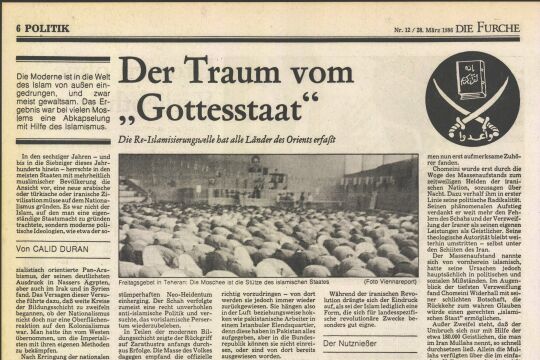
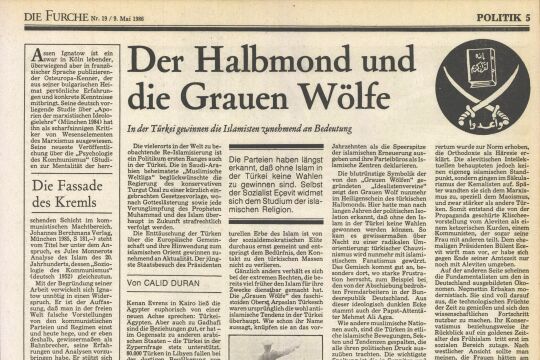

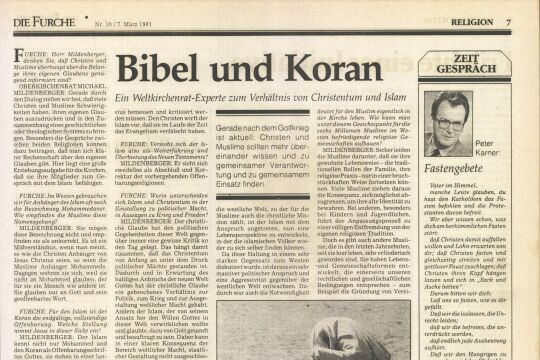
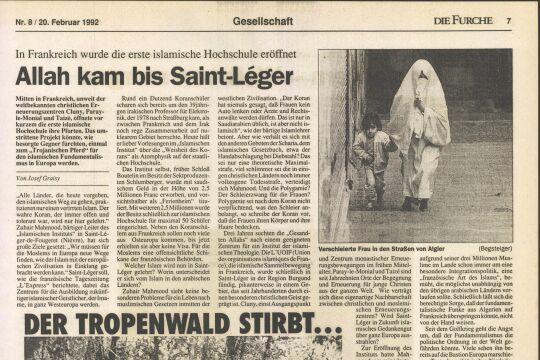
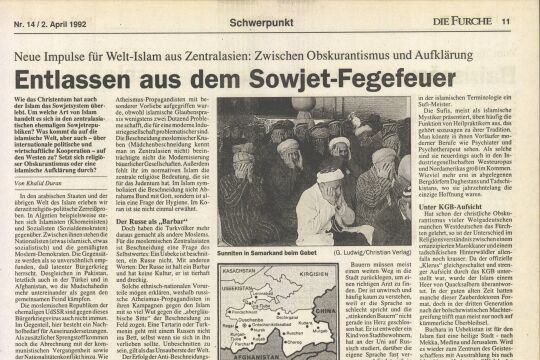
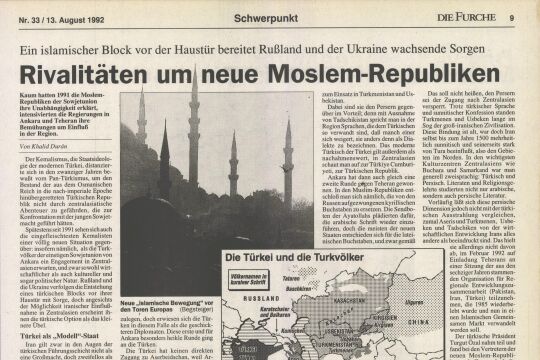
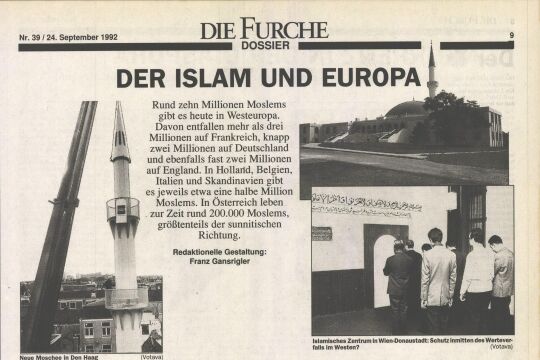
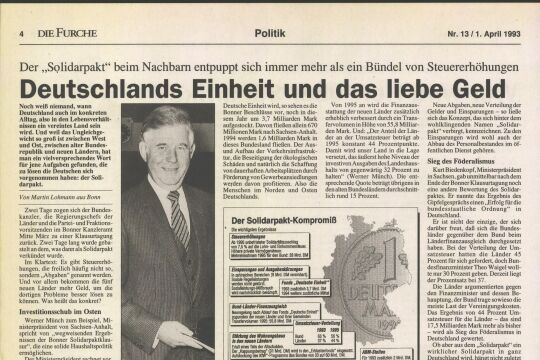

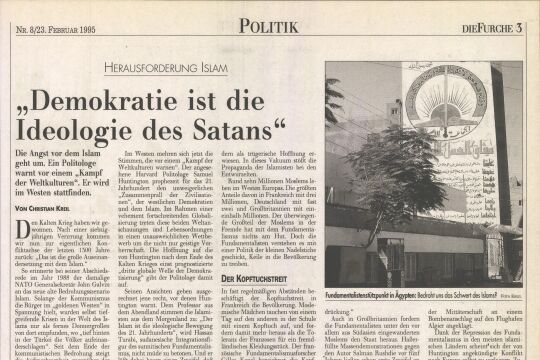
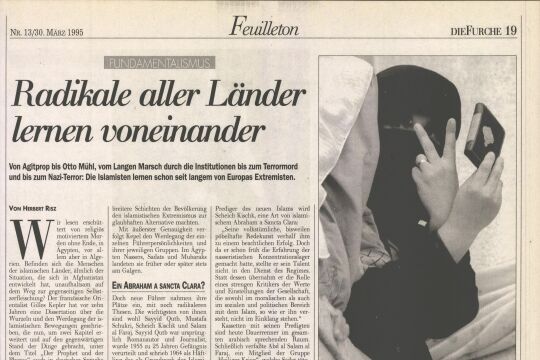
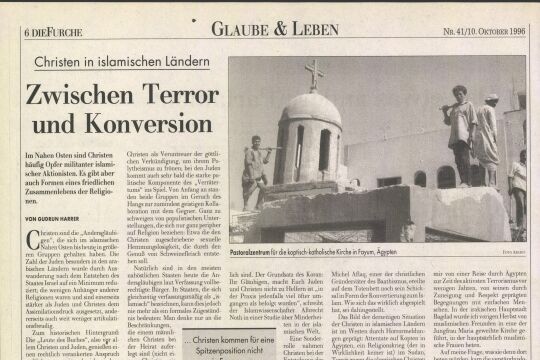
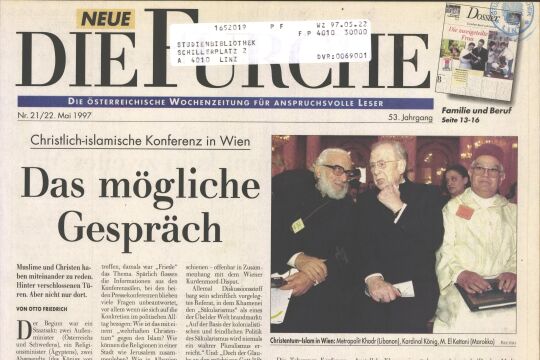






















.png)