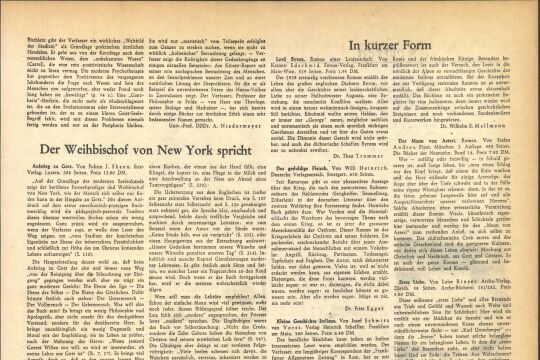"Das Zentrum" von José Saramago, ein Roman gegen die marktkonforme Erbarmungslosigkeit.
Der portugiesische Nobelpreisträger José Saramago ist ein Verteidiger des Individuums und des unangepassten Lebens, sein neuer Roman ein großer Abgesang auf die Welt des alten Handwerks, dem die Modernisierung den Boden unter den Füßen entzieht. Und dieses Handwerk war nicht nur eine Produktionsweise, sondern eine Lebensform.
"Das Zentrum" ist ein Einkaufszentrum in einer namenlosen portugiesischen Stadt. Der 65-jährige Töpfer Cipriano Algor liefert dorthin sein Tongeschirr, bis ihm eines Tages mitgeteilt wird, seine Ware werde nicht mehr benötigt; Plastik verkaufte sich besser. Und der Vertrag ist so formuliert, dass er auch die nicht verkauften Produkte zurücknehmen muss. Das erledigt er gemeinsam mit seinem Schwiegersohn Marçal. Der ist Wachmann im Zentrum und träumt von seiner Beförderung, die ihm das Recht gibt, im Zentrum zu wohnen. Bis dahin lebt er noch beim Schwiegervater.
Der Geschmack des Zentrums bestimmt den Geschmack der Menschen. Cipriano hat keine Arbeit mehr. Er ist am Ende, doch er gibt nicht auf. Den rettenden Einfall hat seine Tochter: Er könnte Nippes-Figuren herstellen und diese dem Zentrum anbieten. Aus einer alten Enzyklopädie zeichnet sie Entwürfe. Die neue Arbeit schafft für Cipriano ungeahnte Probleme, doch er kämpft, und dieser Kampf macht ihn noch einmal jung. Eine scheue Liebe zur Witwe Isaura blüht auf. Und außerdem gibt es da noch einen zugelaufenen Hund, zu dem die ganze Familie eine herzliche Beziehung entwickelt. Eine schöne, einfache Geschichte ist das, schnell nacherzählt - bis zum bitteren Scheitern: Ein Konsumententest hat ergeben, dass niemand die Nippesfiguren kaufen will; für die Probeproduktion bekommt Cipriano sein letztes Geld. So bleibt ihm keine andere Möglichkeit, als zu Tochter und Schwiegersohn ins Zentrum zu ziehen, denn der hat inzwischen seine Beförderung und Dienstwohnung erhalten.
400 Seiten braucht José Saramago für diese Geschichte, und in den meist absatzlosen Kapiteln stecken Sätze von bernhardscher Länge, die sich bisweilen zu langen Dialogen verknoten: Sätze von barocker Umständlichkeit, die das Lesetempo verlangsamen, dafür Hintergründe und Einsichten aufblitzen lassen. Ob es um die expansive Pseudosakralität des Einkaustempels, die verhaltene Subtilität menschlicher Beziehungen oder das Modellieren der Tonfiguren geht, hinter dem der religiös interessierte Atheist Saramago (sein "Evangelium nach Jesus Christus" hat sogar den Vatikan auf den Plan gerufen) Schöpfungsmythen aufblitzen lässt - immer hat dieses Erzählen eine philosophische Tiefenschärfe.
Eine Mühe ist die Lektüre bisweilen dennoch, etwa wenn es um die Details des keramischen Handwerks geht. Doch die Mühe ist auch kalkuliert: Der grelle Widerspruch zwischen der einfachen Geschichte und der verschlungenen Satzstruktur verkörpert den Kampf des Einzelnen mit den anonymen Mechanismen des Marktes oder - wie im Roman "Alle Namen" - der Bürokratie. Der Blickwinkel der Erzählung ist ganz auf diesen Einzelnen gerichtet, immer ist er im Visier der Erzählkamera, aber die endlos verschachtelten Satzstrukturen sind das Labyrinth, in dem er sich verfängt. Manchmal verheddert sich freilich auch der Autor und stattet - das ist der stärkste Einwand gegen diesen Roman - seine Figuren mit Einsichten und Wörtern aus, die ihrem Charakter und Bildungsstand nicht zukommen. Der Erzähler kann allen in Herz und Hirn schauen - bisweilen sogar dem Hund.
Mit einem grandiosen Finale katapultiert Saramago seine Figuren wieder aus der Geschichte hinaus. Bei der ständigen Expansion des Zentrums wird ein archäologischer Fund gemacht: mumifizierte Figuren, die trostlos auf einer Bank sitzen. Für Cipriano werden sie zum Symbol seines eigenen Lebenszustandes: "Ich werde nicht den Rest meines Lebens an eine Steinbank gefesselt verbringen und eine Wand anstarren." Er beschließt, das Zentrum zu verlassen und wieder hinaus zu ziehen ins Dorf, in sein Haus, zum Hund, den er zurücklassen musste, und vor allem seiner Liebe folgend: "Es gibt Momente im Leben, da muss man eine Tür schließen, damit der Himmel sich öffnet."
Die Höhle mit den Mumien, die er stundenlang bewachen muss, wird auch für den Schwiegersohn zum Wendepunkt des Lebens: "Wer sich nicht anpasst, taugt nicht, und ich hatte aufgehört, mich anzupassen", sagt er später. So ziehen sie alle wieder hinaus ins Dorf und sehen gerade noch, wie das Zentrum die Höhle vermarktet: "Baldige Eröffnung der platonischen Höhle, Exklusiverlebnis, einzigartig auf der ganzen Welt, kaufen Sie jetzt ihre Eintrittskarte." Mit diesem Plakat endet der Roman, und stärker könnte man den Kontrast zwischen der authentischen Kraft der Erinnerung und einer Kommerzstrategie, die alles zum Disneyland arrangiert, nicht ins Bild setzen.
Saramago ist ein zu guter Erzähler, um seinen Roman in der Idylle versacken zu lassen, und er ist kein Konservativer, der glaubt, man könne aus den Trends gegenwärtigen Lebens einfach aussteigen und zurück zu Handwerk und unmittelbarem Leben. So wird nicht die erneuerte Dorfidylle gefeiert, sondern alle brechen zu einer Reise auf, von der wir nicht wissen, wohin sie führt. Alle, das sind Cipriano und Isaura, die mit aller Magie ihrer Liebe auf ihn gewartet hat, sein Schwiegersohn Marçal, der im Zentrum gekündigt hat, und Marta, die von ihm schwanger ist; die Erwartung des Kindes hat die abgelebte und erstarrte Ehe wieder neu und glücklich gemacht. Saramago glaubt an den Gegenzauber der Liebe, aber er weiß auch, dass er die Zwänge der Modernisierung nicht außer Kraft setzen kann. Doch die Liebe macht fähig, klar und genau zu sehen - ein Metaphernfeld, das Saramago zumindest seit der "Stadt der Blinden" gestaltet.
José Saramago, der Landarbeitersohn, der schon als Kind mit seinen Eltern nach Lissabon ziehen und später wegen Geldmangel die Schule abbrechen musste, hat eigene Erfahrungen verarbeitet und ein literarisches Schlüsselwerk über den Transformationsprozess von der Handwerks- zur Industrie- und Dienstleitungsgesellschaft geschrieben, die sich in Südeuropa später vollzogen hat als in unseren breiten und die Menschen, die noch in ihren Traditionen verwurzelt sind. mitten in die moderne "Risikogesellschaft" katapultiert hat - aus dem Nachbarschaftsgefüge des Dorfes in die anonyme Gleichgültigkeit der City. Diese Geschichte erzählt Saramago sozusagen in Schwarz-weiß-Bildern. Er kommt ohne die Schilderung von Farben und Gerüchen aus, aber er hat einen genauen Blick für Strukturen: für den Übergang vom Land zur Stadt, für den Weg von der Peripherie zum Zentrum mit seinen Grenzen und Schwellen, für die Herrschaftsarchitektur des Zentrums und das Verhalten, das sie erzeugt. Gerade deswegen votiert dieses Hohelied auf den einzelnen, diese oft ironische Demaskierung der lächelnden, erfolgsorientierten Erbarmungslosigkeit nicht für die Rückkehr zu früheren Gesellschaftsformen, bezieht aber aus der Erinnerung sein Wissen, worauf es ankommt. Der Abschluss der "pessimistischen Trilogie" von José Saramago ist eine irritierende, ganz und gar unideologische Zivilisationskritik, ein Plädoyer gegen die Wegwerflogik, die auch den Menschen entsorgt, wenn er sich nicht marktkonform verhält; und ein unzeitgemäßes Buch der Hoffnung und Nähe, die einen langen Atem hat. "Man sollte vielleicht als Erläuterung für die Unbedarften hinzufügen, dass, je höher in Gefühlsdingen der Anteil an hochtrabenden Worten ist, umso geringer auch der Anteil an Wahrheit ist." An diese Maxime hält sich auch der Roman selbst, dem gerade in seiner Trockenheit eindringliche Szenen gelingen. Wer ihn liest, wird nicht nur einen neuen Blick für die im Schatten sitzenden alten Männer in südeuropäischen Ländern gewinnen, sondern auch auf die wesentlichen Triebfedern des eigenen Lebens, auf Liebe und Arbeit.
Das Zentrum
Roman. Von José Saramago
Deutsch von Marianne Gareis.
Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg 2002, 396 Seiten, geb. e 23,60
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!