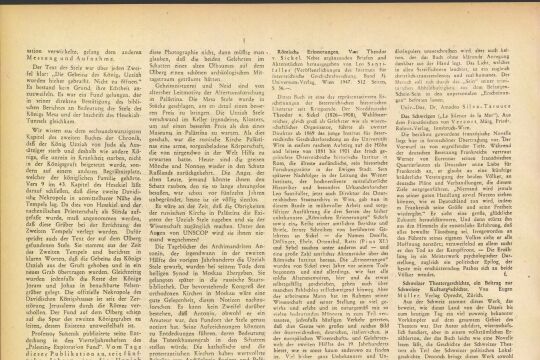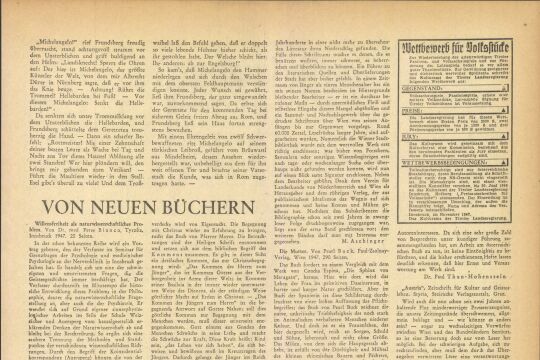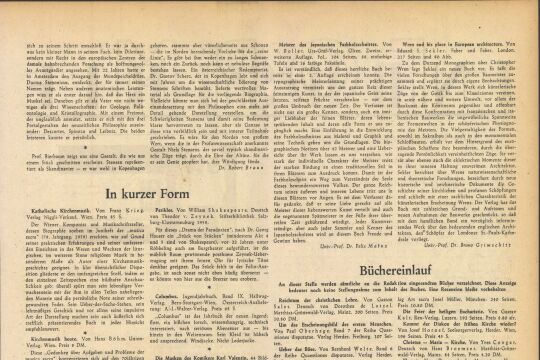Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die Buddenbrooks — wienerisch
Die Ortliebschen Frauen. Roman von Franz N a b 1. Verlag Kremayr & Scheriau, Wien 1953. 590 Seiten.
Preis 68 S
Der Vergleich von Franz Nabl mit Thomas Mann drängt sich, ungeachtet des Rangunterschiedes, schon rein äußerlich, gleichsam akustisch auf. Beiden gemeinsam ist die gepflegte, scheinbar einfache, in Wahrheit höchst kunstvolle Sprache, mit ihrer irgendwie altväterlich forcierten, ironisch zwinkernden Syntax. Ohne Schnörkel, Arabesken oder erregte Wortneubildungen gelingt gerade ihren allerdings sehr bedacht gesetzten Verben und Adjektiven, manchmal, Gewichtigstes im Einfachsten, Bedeutungsvollstes im Harmlosesten auszusagen. Noch näher aber rückt Nabl zu Mann als Meister des Familienromans, als Ahnherr der österreichischen Seitenlinie der Buddenbrooks. Während aber Nabls „Oedhof“ zwischen Mann (bzw. Gals-worthys Forsyte Saga) und Anzengruber steht, stehen die „Ortliebschen Frauen“ zwischen Mann und Strindberg.
Die Nachzeichnung dieser literarischen Parallelen soll das Originale, die zutiefst österreichische Färbung und Orchestrierung Nabischer Gestalten nicht herabsetzen. Aber sie erklärt vielleicht manches Schwankende und Unentschiedene in Wesen und Werk des hochgeachteten Siebzigjährigen, das ihn bisher die Palme des höchsten Ruhmes zu ergreifen gehindert hat.
Ueber dem Schicksal der „Ortliebschen Frauen“, das seine kleine, aber heftig pendelnde Amplitude zwischen einem etwas verblichenen Wien und einer „nahen Provinzstadt“ ausschwingt, liegen die Schatten eines psychologisch sehr schwer faßbaren, abwegigen, beinahe unnatürlichen Empfindens. Josefine, die Hauptgestalt, die Teufelin, entpuppt sich in ihren messerscharfen Gesprächen und krausen Handlungen als Drahtzieherin einer kleinbürgerlichen Tragödie von antiker Wucht. Langsam, bedacht, Zug um Zug reißt sie nach dem Tod des Vaters die Fäden der Familienherrschaft an sich, die willensschwache, kränkliche Mutter und die gutmütige Schwester, vor allem aber den verkrüppelten Bruder, das Ziel ihrer schwelenden. Blasen werfenden Affenliebe, mit diabolischen Mitteln tyrannisierend. Das ist stellenweise mit beklemmender Meisterschaft geschildert, bis an die Grenze des Erträglichen, dort etwa, wo der androgyne
Trieb des Mädchens an die Wurzel geführt wird: die eigentümliche Liebe zum Bruder. Folgerichtig reißt sie beinahe alles um sich herum ins Verderben, und es ist wie ein Atemholen für den Leser, daß wenigstens Bruder und Schwester der provinziellen Sensation der Katastrophe entrinnen und in die ersehnte, ereignis- und erregungslose stille Kleinbürgerlichkeit zurückgleiten.
„Die Ortliebschen Frauen“ ist ein bedeutendes Werk der heimischen Literatur. Vielleicht ginge seine Wirkung noch tiefer, wenn seine Gestalten nicht nur einen zeitlichen psychologischen Grenzfall, sondern auch den Ausdruck einer bestimmten österreichischen Epoche darstellten. Hierfür aber fehlt beinahe jeder Hinweis in dem Buch, und damit jene „vierte Dimension“, die Familienromane dieser Art als Zeitdokument besonders wertvoll und dauerhaft zu machen pflegen.
Dr. Roman H e r 1 e
•
Herold des Abendreiches. Ein Versbuch von Georg Wagner. Verlag Stiasny, Graz-Wien-München. 136 Seiten.
Ueber Gedichte zu sprechen, ist immer schwer, sie sprechen selber oder sie sprechen nicht, sie suchen ihren Weg zum Herzen des Lesers, manchmal finden sie ihn, manchmal nicht. Sie haben mehr noch als andere Bücher ihr Schicksal und dieses durch die Besprechung eines Gedichtbuches horoskopartig vorauszubestimmen, ist immer ein eitles Unterfangen. Nicht ein Urteil über den Wert der Gedichte — dieses spricht immer erst die Zeit —, sondern nur einen Hinweis auf sie zu geben, kann der Sinn und die Aufgabe des Berichts sein.
Die Gedichte Georg Wagners wachsen aus einem gläubigen Herzen auf und darum sind sie frei von der nihilistischen Zweifelsucht unserer Zeit, sie geben in der Finsternis unserer Tage manchen Lichtblick. Es sind Worte eines guten Oesterreichers und darum haben sie zugleich europäische Weite. Sie tauchen hinunter in die Schatztruhe der österreichischen Vergangenheit und heben manches vergessene Kleinod daraus ins
Licht. Am stärksten wirkt Georg Wagner, wenn er seiner barocken Schweiflust die Zügel schießen läßt und ein wenig wild und ungestüm durch die Fluren seines Vaterlandes und dessen Geschichte reitet. Er wäre keine dichterische Natur, wenn ihm nicht auch zarte, leise Lieder glückten, die das Weben der Natur einfangen, vor allem die Natur des Tirolerlandes blinkt und leuchtet manchmal rein wie ein Tautropfen in seinen Versen auf.
Die Häupter noch weiß, die Lenden schon grün, Der Himmel leuchtet in Farben kühn. Es schwellen die dürren Reiser.
Die Wälder stehn schwarz im feurigen Blau, Die Luft geht würzig, feucht und lau — Du horchst und atmest leiser.
Freilich sollte der Dichter bedenken, daß für ihn das Wort gilt, zu bilden und nicht zu reden, und so drängt sich oft bei Georg Wagner das Lehrhafte vor das Bildhafte, ein Zug, der einer reinen Wirkung des Gedichts im Wege steht. Alles Tendenzhafte, und mag es auch die beste Tendenz sein, zerstört das Dichterische, in diesem Sinne wäre bei Georg Wagner weniger oft mehr. Univ.-Prof. Dr. Eduard Lachmann *
Amor Dei. Ein Spinoza-Roman. Von E. G. K o 1-benheyer. Stocker-Verlag, Graz 1952. 350 Seiten.
In der Reihe der „Ausgaben letzter Hand“ liegt jener Roman vor, mit dem Kolbenheyers große Darstellungen des Lebens geschichtlicher Persönlichkeiten begannen. Wien hat zu „Amor Dei“ eine besondere Beziehung. Hier, zwei Jahre nach seiner Promovierung, hat Kolbenheyer, nach Vorarbeiten, die bis 1904 reichten und auch nach Holland führten, die erste Fassung des Romans 1906/07 abgeschlossen. Die vorliegende Ausgabe ist, im ganzen gesehen, ein unveränderter Abdruck; immerhin fallen auf: verschärfter stilistischer Schliff und verknappter Ausdruck — vorteil-
haft der neue Schluß. Mehr noch als früher tritt inniges Bestreben hervor, unretho tischet, unlyrischer, mehr vom Stoffe her als von der Gestalt zu wirken. Wenn man bedenkt, daß Baruch Spinoza, der Mann zwischen den Konfessionen, ein ganzes Zeitalter beeinflußte; wenn man bedenkt, daß er von hinnen ging, ehe der Frieden von Nymwegen geschlossen und gerade, als der. Kapuziner Peter Martin von Cochem sein mystisch hergeleitetes Leben Jesu erscheinen ließ; es Rem-brandts Zeit war, Gärung und Vorbereitung, Untergang und Geburt: so wird der Roman auch heute, ein halbes Jahrhundert nach seinem Erscheinen, zeitgemäß durch seine innen bedingte Ueberzeitlichkeit. Wohl hat sich Spinoza als „Modus“ nicht von den Beziehungen zur Außenwelt frei machen können, aber durch den Amor dei intellectualis ist er ungetrübter Seelenheiterkeit teilhaftig geworden, so dunkel' auch die Fahnen des Schicksals um die Amstel wehten.
Hanns Salaschek
*
Wiedersehen mit Meran. Roman von Otto F. Beer. Oesterreichische Verlagsanstalt, Innsbruck. 314 Seiten.
Der Wert dieses Buches liegt in einer echten Grazie, mit der Beer schwierigste Zeit- und Seelenprobleme seiner Generation (Jahrgang 1910) mit reicher Nuancierung zu behandeln weiß. Nach einer kunstvoll verschlungenen Episodengestaltung überrascht der etwas unorganische tragische Schluß. Dies fällt jedoch wie ein gewollt herbeigeführtes Finale nach bravourösem Konzertieren minder ins Gewicht. Mögen noch manche Anklänge zur deutschsprachigen Meisterschule des psychologischen Romans bei Beer unüberhörbar mitschwingen (seine jüngerhafte Nähe zu Schnitzler, Wassermann, Thomas Mann), so schöpft er dennoch bereits viel aus eigener Substanz und tiefenpsychologischer Erfahrung, die sogar zur Zweitlektüre anregt, ohne daß sich das besondere Aroma einer feinen Wiener Geistigkeit verlöre. Somit bleibt das „Wiedersehen in Meran“ von anziehender Einprägsamkeit und darf als Bereicherung der österreichischen Nachkriegsliteratur angesehen werden.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!