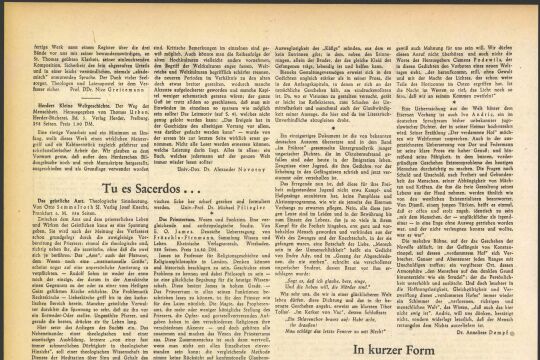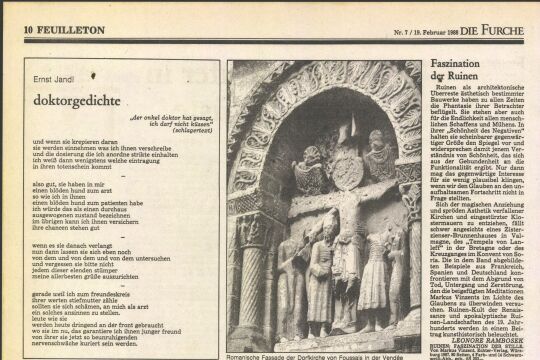Vertragen sich Literatur und Politik?
Die Leiterin des Innsbrucker Literaturhauses am InN, Anna Rottensteiner, geht der Frage nach, inwieweit Literatur politisch sein kann, auch und gerade wenn erhobene Zeigefinger unerwünscht sind.
Die Frage nach dem Verhältnis von Politik und Literatur wird gerade in Zeiten wie diesen gestellt, in denen von Abwendung von der Politik, Politikverdrossenheit und Apolitisierung die Rede ist. In einer Zeit, die alle Individuen, Mitglieder einer globalisierten Polis, als Umbruchs- und Krisenzeit erleben. Aber weckt nicht gerade dieses Gerede, das oft auch den Anschein von Herbeireden hat, das Bedürfnis nach "Re-Politisierung", nach Politisierung von Diskursen?
Die meisten Schriftsteller verwehren sich dagegen, ihre Werke oder die Literatur und die Künste überhaupt mit Politik in Zusammenhang zu bringen, aus Angst vor Vereinnahmung, vor Zuschneidung der Freiheit der Kunst; es gibt genügend Beispiele dafür, dass dies geschehen kann und geschehen ist. Anders herum gefragt: Hat die Literatur nicht auch die Freiheit, eben weil sie sich aus der Freiheit des Wortes heraus definiert, politisch zu sein, politisch gelesen zu werden? Beschneidet sie sich nicht selbst, wenn sie sich diesem entzieht?
Moralischer Imperativ?
Es kann keine Forderung an die Literatur geben, politisch zu sein. Gerade für die Generation jener Schreibenden, die als Folgegeneration durch die 68er Jahre geprägt sind, sind Didaktik, Zeigefinger und die Aufforderung, das "richtige" Leben im falschen darzustellen, mittlerweile Schreckgespenster. Kein moralischer Imperativ ist gefragt, sondern - ja, was? In Momenten definitorischer Verunsicherung erscheint es mitunter wohltuend, auf die ursprüngliche Bedeutung von Worten zurückzugreifen. Bei Wikipedia findet man zu Politik Folgendes: "Der Begriff Politik wird aus dem griechischen Begriff Polis für Stadt oder Gemeinschaft abgeleitet … Hauptsächlich wird mit diesem Begriff die Gestaltung der Ordnung in der Welt bezeichnet."
Es ist allgemein und einfach, aber wohltuend: Literatur und ihre Produzenten sind eingebettet in die Polis, die Gemeinschaft. Ob Anwältin, Friseur oder Schriftsteller: Jeder ist Teil davon. Und jeder hat seine ganz spezifischen Fähigkeiten und Möglichkeiten, an der Polis zu partizipieren, an der "Gestaltung der Ordnung in der Welt". Nicht besser oder nicht schlechter als der andere. Aber eben auf seine Art. Schriftsteller haben ihre Fähigkeiten und Möglichkeiten. Und sie übergeben die Literatur durch ihre Veröffentlichung der Polis: als ein Angebot und ein Geschenk.
Nehmen wir also das Geschenk an und lesen. Lukas Bärfuss zum Beispiel, seinen Roman "Hundert Tage", und Johannes Gelichs "Der afrikanische Freund". Beides Bücher, in denen politisch korrektes Verhalten reflektiert wird. In Bärfuss' Roman ist es der Ich-Erzähler David Hohl, der als junger, naiver Schweizer Entwicklungshelfer nach Ruanda kommt und dort das Blutbad in den hundert Tagen zwischen April und Mitte Juli 1994, in seinem Haus verschanzt, miterlebt, als die Hutu über die Tutsi herfielen und kaum ein Tutsi am Leben blieb.
Mindestens 500.000, wenn nicht doppelt so viele Menschenleben waren am Ende zu beklagen. Hatte Hohl vor Antritt seiner Reise brav die Autoren Senghor, Césaire und Conrad gelesen, um als wissender Europäer sich dem "fremden" Afrika zu nähern, so scheitert er an der Realität dieses Kontinents, versagt als "Vertreter" westlicher, korrekter, tugendhafter Entwicklungshilfe, wird zum Mithelfer wider besseres Können, an der "Symbiose zwischen unserer Tugend und ihrem Verbrechen". Auf welcher Seite man auch steht: Man ist Zwängen ausgesetzt, die nicht der eigenen Beeinflussung unterliegen.
Einklang mit Schöpfung
In einer zentralen Stelle fährt der Ich-Erzähler, "in der letzten großen Regenzeit vor den Morden" einem "Aufruf zur Normalität" folgend, nach Ruhengeri, in die Bergregenwälder, das Territorium der Gorillas. Diese Gegenwelt, die ihn an die Ursprünge des Mensch-Seins zurückführt, lässt ihn für im wahrsten Sinne des Wortes einen Augenblick lang erahnen, was es heißen könnte, in Einklang mit der Schöpfung zu leben, lässt ihn daran zweifeln, "dass es eine gute Idee der Evolution gewesen war, uns von den Bäumen herunterzuholen, und dass wir besser geblieben wären, was wir gewesen waren, wenn wir dafür diese Ruhe, Gelassenheit, diese Versenkung in den Moment hätten zurückgewinnen können."
Keine Zweifel hingegen hegt der Protagonist in Johannes Gelichs Roman "Der afrikanische Freund". Zwischen Albert Camus und The Cure angesiedelt, stattet der Autor seinen Protagonisten mit einer Haltung existenzieller Gleichgültigkeit aus: "Mein Schicksal hatte sich ohne mein Zutun vollzogen, es spielte überhaupt keine Rolle, was ich dachte und ob ich anwesend oder abwesend gewesen war. Man hätte mich genauso gut aus dieser Geschichte entfernen und an meine Stelle irgendjemand anderen setzen können. Markieren. Ausschneiden. Einfügen. Ich bereute nichts ..."
Up to date
In der Salzburger Upper-Class zur Zeit der Festspiele, bei einem Bankett unter Schulfreunden mit reichlich Alkohol, (Fr)esszeremonien und Mädchen, entwickelt sich ein morbides Kammerstück, das zuerst zur Verletzung und letztendlich zur Tötung eines afrikanischen Eindringlings führt. Das Buch endet mit der Aufführung des "Jedermann", der die Freunde beiwohnen, und mit der Abreise des Protagonisten. Das Fehlen moralischen Verantwortungsbewusstseins, das mit Camus' Darstellung der völligen Emotionslosigkeit von Meursault, dem Protagonisten in "Der Fremde", einen Höhepunkt erreicht, katapultiert Gelich in die Gegenwart. Sein Protagonist fühlt sich nicht fremd in der Welt, ist kein Außenseiter, sondern vollends in die Wohlstandsgesellschaft integriert und up to date, so dass sich beim Lesen das beklemmende Gefühl einschleicht, auch diese Haltung sei up to date.
Beide Romane, so unterschiedlich sie auch in Handlung und Figurenzeichnung sein mögen, reflektieren auf ihre Weise, was es heißt, eine Komplizenschaft mit der Macht einzugehen, eine unreflektierte und undurchschaute Komplizenschaft, die das Leben der anderen in die Waagschale wirft, um von der eigenen Bequemlichkeit, den eingespielten Abläufen, großen oder kleinen, geschichtlichen oder individuellen, keinen Abstrich machen zu müssen.
Überwachter Mensch
Anders Ulrich Peltzers Roman "Teil der Lösung". Er durchspielt die unterschiedlichsten Facetten der Überwachungsgesellschaft und reflektiert die Frage nach den Möglichkeiten des Widerstands in eben dieser Gesellschaft, in denen jede Bewegung von einem Kameraauge mitgefilmt wird. Der Roman, der gegenwärtiger nicht sein könnte, spielt in der Stadt Berlin, die als heimliche Protagonistin in unzähligen Facetten ihrer Existenz dargestellt wird. Ihr als "menschliche" Hauptprotagonisten zur Seite gestellt sind der Germanist Christian Eich, Mittdreißiger, Vertreter des akademischen Prekariats, der sich mit Gelegenheitsarbeiten über Wasser hält, und Nele Friedrich, Mitte zwanzig, hoch intelligent, im NGO-Widerstand engagiert. An ihnen, wie an weiteren Figuren des mit filmischer Schnitttechnik arbeitenden Romans, werden die Möglichkeiten gegenwärtiger Existenz durchgespielt, wird der dünne Boden politischen Engagements ausgeleuchtet. Und: In seiner Intelligenz und Intellektualität bringt der Roman die Wärme und Leidenschaft der Liebesgeschichte, die sich nach einem störrischen Beginn zwischen Nele und Christian entwickelt, umso stärker zum Funkeln.
Auch Sherko Fatahs Roman "Das dunkle Schiff" spielt, im zweiten Teil des Buchs, in Berlin. Der Autor rollt die Geschichte des Irakers Kerim quasi als Anti-Entwicklungsroman auf. Nach der Ermordung seines Vaters durch Schergen Saddam Husseins flieht der junge Mann in die Berge, wo er von islamischen Gotteskriegern gefangen genommen wird. Zuerst schließt er sich ihnen an, flieht dann aber als blinder Passagier auf einem Schiff nach Europa. Bei einem Onkel in Berlin findet er Unterschlupf. Er erhält schließlich Asyl, erfährt die erste Liebe, um dann von seiner Vergangenheit unwiederbringlich eingeholt zu werden.
Kerim könnte man als den Fremden des 21. Jahrhunderts lesen, seine Fremdheit ist nicht selbst gewählt, sondern fremdbestimmt. Der erzählerische große Bogen versperrt sich expliziten Erklärungsversuchen; die erzählerischen Zusammenhänge lassen Fragen und Erkenntnisse im Kopf der Leserin entstehen.
Diese Romane, so unterschiedlich sie auch sind, sind vor allem in einem politisch: Sie sprechen literarisch von Haltungen, prekären Verhältnissen, reflektieren die Begrenzung und Verunmöglichung von Handlungsspielräumen. Sie sprechen vom Scheitern und Versagen, von Macht und Ohnmacht, wobei sie nie ganz auf leuchtende Spots vergessen, die in der Darstellung des dunklen Herzens unserer Gegenwart umso heller leuchten. Es geht in ihnen um Gegenwart, um ein Gewärtigsein, ein waches und wahrnehmendes Anwesendsein in der jeweiligen Gegenwart. Um Orientierung und Orientierungslosigkeit. Kein erhobener Zeigefinger weit und breit, der dem Leser sagen würde, wo es lang gehen kann, im Gegenteil - die Autoren setzen mündige Leser voraus.
Keine Allwissenheit
Auch die Protagonisten erscheinen mündig, durch eine Erzählhaltung, die den Bewusstseinsströmen der Figuren folgt, aus denen heraus sich die Logik, der Inhalt und die Bewegung des Buches erschließen. Kein allwissender Erzähler hat die große Erzählung im Griff, die über das im Buch Geschilderte hinausgeht.
Es versteht sich dabei von selbst, dass die Protagonisten durchwegs ambivalent angelegt sind, bisweilen sogar unsympathisch. Hier ist, über die Thematik hinaus, Literatur politisch: im Durchbrechen von gewohntem Leseverhalten. Keine "identifikatorische" Lektüre wird angeboten, kein genüssliches Sich-Zurücklehnen, sondern ein Stören und Verstören, das den am Unterhaltungswert orientierten Markt durchbricht.