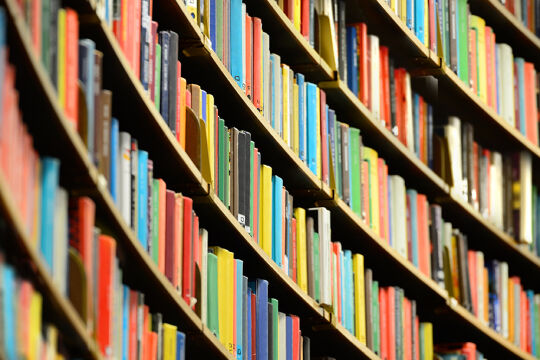Der Mensch „ist nur da ganz Mensch, wo er spielt“, wusste schon Friedrich Schiller – und in der Literatur der Postmoderne avancierte das Spiel zum zentralen Gestaltungsmerkmal.
Wieder einmal hatte Schiller recht. Es ist schon erstaunlich, dass Friedrich Schiller stets als Juniorpartner Johann Wolfgang Goethes galt, während Letzterer damit beschäftigt war, Urpflanzen nachzuforschen, falsche Farbtheorien aufzustellen und dem Neptunismus anzuhängen, der davon ausging, dass die Erde im Kern voller Wasser war. Der unzeitgemäß moderne Schiller formulierte in seiner Jenaer Antrittsvorlesung den Konstruktionscharakter von historischer Wahrnehmung und stellte am Ende von „Wallensteins Lager“ bündig fest, dass das Leben ernst, aber die Kunst heiter ist. Und in seinem langen Essay „Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen“ heißt es: „Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.“ Damit hat Schiller fast eineinhalb Jahrhunderte vor dem Erscheinen von Johan Huizingas Buch über den „Homo ludens“ ein wichtiges Prinzip von Kunst und Literatur ausgemacht, das in der sogenannten Postmoderne zum zentralen Gestaltungsmerkmal avancieren sollte.
Spiel mit dem Sinn
Mit dem vor wenigen Jahren verstorbenen Robert Gernhardt, einem Spieletheoretiker und -praktiker par excellence, kann man dieses Merkmal auf die Formel bringen: „Theke – Antitheke – Syntheke.“ Dass eine solche Formel auf den ersten Blick nicht viel Sinn macht, ist ja gerade der Punkt oder der Sinn des Spiels mit dem Sinn. Schon in ihrem frühen Klassiker der postmodernen Literatur „Die Wahrheit über Arnold Hau“ von 1966 spielen Gernhardt und seine Kollegen von der berühmt-berüchtigten Satire-Zeitschrift „Pardon“, F. K. Waechter und F. W. Bernstein, mit allem, was die Literaturgeschichte zu bieten hat und ihr heilig ist. Damit ist die Literatur wieder einmal bedeutend schneller als die Theorie. Erst Jean-François Lyotard stellt 1979 in „Das postmoderne Wissen“ das Ende der „großen Erzählungen“ fest und rückt den Begriff des Spiels ins Zentrum. Es kann keine allgemein verbindlichen Überzeugungen und Sinnstiftungsmodelle geben. Sinn wird mithilfe von Regeln erzeugt, die man auch als Spielregeln bezeichnen kann. Wie bei Brett- und Kartenspielen werden aus bestimmten Gründen Regeln festgelegt, die bei anderen Zielen und Interessen auch ganz anders aussehen könnten. Regeln sind zugleich konventionsgebunden und veränderbar.
Das Spiel setzt voraus, dass es keine metaphysischen Gründe und Zwänge gibt, sondern alles Ergebnis von Wahlmöglichkeiten ist. Freilich ist es historisch erklärbar und spezifischen Machtverhältnissen geschuldet, dass in Europa die Bibel und nicht der Koran die Gesellschaft geprägt hat und dass im 19. Jahrhundert Berlin und nicht Wien Hauptstadt eines neuen deutschen Kaiserreichs geworden ist. Doch hätte die Entwicklung, bei veränderten gesellschaftlich-kulturellen „Spielregeln“, auch anders aussehen können.
Spiel mit Erwartungen
Dem Leben liegen, so könnte man es vielleicht formulieren, ernste Spielregeln zugrunde, während Kunst und Literatur frei in der Wahl ihrer eigenen Regeln sind. Harry Potter kann im Roman auf einem Besen fliegen und Quidditch spielen, in der Realität könnte er es nicht. Gerade durch solche Abweichungen kommentieren literarische Texte aber die Realität und machen deren Konstruktionscharakter durchsichtig. Diese Wechselwirkung und damit die Parallele von Leben und Literatur, beides auf seine Weise Spiel zu sein, ist in der Literatur des 20. Jahrhunderts zunehmend thematisiert worden. Etwa bei Samuel Beckett, der in „Warten auf Godot“ von 1952 seine Figur Estragon ins Publikum blicken und sagen lässt: „Heitere Aussichten!“ Schon Bertolt Brecht hat mit Illusionsdurchbrechungen gearbeitet, sie sind das zentrale Gestaltungsprinzip seines epischen Theaters. Und Peter Handke hat in seiner „Publikumsbeschimpfung“ von 1966 das Verfahren noch perfektioniert – hier regiert der metafiktionale Bruch auf Kosten der Handlung. Man sollte aber nicht meinen, dies alles habe es in der Literatur vor 1900 noch nicht gegeben – die Tendenz, das Spiel mit Versatzstücken der Realität als solches zu markieren, hat sich nur verstärkt. Ludwig Tieck mit seinen Theaterstücken (etwa in „Der gestiefelte Kater“ von 1797) oder E.T.A. Hoffmann mit seinen Romanen und Märchen (etwa im „Kater Murr“ von 1819/21) sind Beispiele für das Spielen mit Realitätsebenen und Lesererwartungen.
Spiel mit Tabubrüchen
Die Inszenierung des Lebens in der Literatur als ernstes Spiel ist ein globales Phänomen. Seit der zweiten Hälfte der 1980er Jahre wird ein US-amerikanischer Autor zum Trendsetter. In seinem Erstling „Unter Null“ von 1985 schildert Bret Easton Ellis das Lebensgefühl seiner Generation, die von der Möglichkeit, selbst Spielregeln für ihr eigenes Leben aufzustellen, überfordert ist und in „American Psycho“ von 1991 stellt er auf geniale Weise die Frage, was Fiktion ist und was, innerhalb der Fiktion, dann Realität sein kann. Ellis schockiert durch Tabubrüche – die Jugendlichen in „Unter Null“ kompensieren die innere Leere durch Drogenkonsum und Sex. Patrick Bateman, der Protagonist von „American Psycho“, schildert detailliert, wie er Menschen auf bestialische Weise ermordet, wobei offen bleibt, ob die Taten nur in seiner Vorstellung geschehen. „American Psycho“ war wegen seiner brutalen Szenen viele Jahre in Deutschland als jugendgefährdend verboten. Und dennoch ist es ein wichtiges Buch, weil es die Frage stellt, was Wirklichkeit sein oder werden kann, und dabei auf provozierendste Weise den rücksichtslosen Narzissmus in den neoliberalen Gesellschaften zur Schau stellt. Gute Romane altern nicht: Bateman, der Wallstreet-Yuppie, trieb schon zwei Jahrzehnte vor dem letzten großen Börsencrash sein literarisches Unwesen.
Böse Spiele
Natürlich gibt es für solche Tabubrüche berühmte Vorläufer, auch im eigenen Land, den USA – man denke an J. D. Salingers „Der Fänger im Roggen“, Paul Austers New-York-Trilogie oder den Autor der Metafiktionalität schlechthin und Angehörigen unterschiedlicher Kulturen, Vladimir Nabokov. Dessen Roman „Lolita“ von 1955 inszeniert ein komplexes Spiel mit Realitäts- und Wahrnehmungsebenen: Wieweit kann man Humbert Humbert glauben, der sich selbst als „wahnsinnig“ bezeichnet und eine Zwölfjährige verführt haben will? Schon der angebliche Herausgeber Dr. phil. John Ray Jun. ist nichts als eine Finte von Nabokov, dem Meister der Masken.
Die Beispiele aus der Weltliteratur ließen sich fast beliebig vermehren. Die Literatur ist in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch und durch konstruktivistisch geworden, will sagen: Literatur führt spielerisch vor, dass Wahrnehmung von den eigenen Spielregeln jedes Individuums abhängt, nach denen es sein Leben gestaltet. Dass aus dem Spiel blutiger Ernst werden kann, zeigt uns Tag für Tag ein Blick in die Medien.
Den Spielecharakter betonen jüngere AutorInnen der deutschsprachigen Literatur bereits dadurch, dass sie ihn in den Titel heben. „Spielende“ heißt 1983 ein Aufsehen erregender Gedichtband der aufstrebenden Autorin Ulla Hahn, hier wird Ernst und Heiterkeit des Spiels auf einen einzigen, doppeldeutigen Begriff gebracht. Juli Zeh schildert in ihrem 2004 erschienen Roman „Spieltrieb“, wie zwei halbwüchsige Schüler ein böses Spiel mit einem ihrer Lehrer inszenieren, es verändert das Leben aller Beteiligten.
Auch dieser Roman ist so angelegt, dass man von dem Verhalten der Figuren auf die Lebenseinstellung ihrer Generation schließen kann. Und diese Lebenseinstellung ist durch Orientierungslosigkeit und Werteverlust gekennzeichnet. Der junge Zyniker Alev hat das Werk eines Spieltheoretikers gelesen und treibt seine Freundin Ada in ein Verhältnis mit dem Sportlehrer Smutek, um ganz praktisch auszuprobieren, ob die Theorie stimmt. Wenn es keine verbindlichen Spielregeln mehr gibt, wer sagt dann, welche besser und welche schlechter sind? Andererseits ist, das muss vor allem Alev am eigenen Leib erfahren, das Leben dann doch zu ernst, um mit ihm jedes Spiel spielen zu können.
Das zeigt auch Ulrike Draesners 2005 erschienener Roman „Spiele“, der sowohl von den Olympischen Spielen 1972 in München als auch von den Folgen eines Kinderspiels handelt, die das weitere Leben der Hauptfiguren Katja und Max überschatten.
Die Gegenwartsliteratur führt auf solche Weise vor, dass gerade die „riskanten Freiheiten“ (Ulrich Beck) des heutigen Lebens die Gefahr bergen, beliebige Spielregeln zu wählen, die dem eigenen Leben und dem eigenen Text keinen Sinn mehr geben und die deshalb fast unausweichlich zum Scheitern führen.
Mit jedem Tag neu
Dabei hat man sich wieder auf Traditionen besonnen, vor allem die des Erzählens. Man denke an zahlreich anzutreffende, sprachlich keine Rätsel aufgebende, linear und chronologisch durcherzählte Geschichten wie die – sich angesichts der heutigen Orientierungslosigkeit häufenden – Pubertätsromane, besonders erfolgreich waren Benjamin Leberts „Crazy“ (1999) und Charlotte Roches „Feuchtgebiete“ (2008), oder an Erfolgstitel wie Daniel Kehlmanns „Die Vermessung der Welt“ von 2005. Wenn Jörg Neuenfeld im selben Jahr in einer Studie gemeint hat: „Alles ist Spiel“, dann stimmt das so nicht ganz: Gerade weil alles Spiel ist, darf man das Spielen nicht auf die leichte Schulter nehmen.
Literatur und Leben bleiben, mit Felicitas Hoppes Roman „Johanna“ von 2006 gesprochen, der seine Spielregeln deutlich ausstellt, „nichts als ein altes Gesellschaftsspiel, ein Rätsel“. Und doch ist es ein immer wieder verändertes oder veränderbares Spiel, das wir mit jedem Tag und mit jedem Text neu beginnen.
Stefan Neuhaus, geb. 1965 in Wimbern/Westfalen, Universitätsprofessor am Institut für Germanistik Innsbruck. Zahlreiche Publikationen, zuletzt u.a. „Märchen“ (2005), „Literaturvermittlung“ (2009).
Spiele
Roman von Ulrike Draesner btb 2007. 491 S., kart., e 9,80
Spieltrieb
Roman von Juli Zeh btb 2006. 565 S., kart., e 10,30