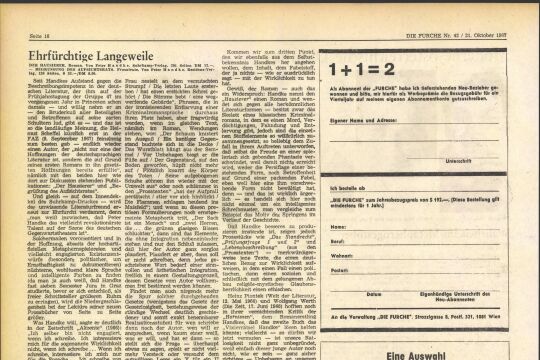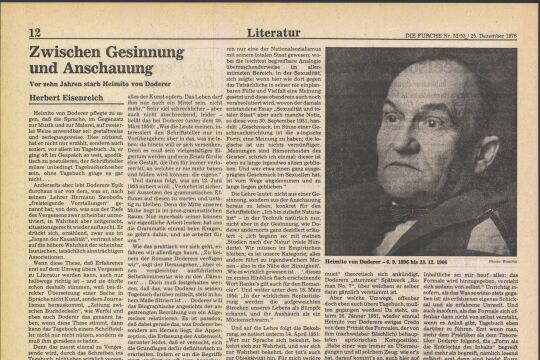Sinn und Unsinn des Endes in der heutigen Literatur. von klaus kastberger
Es steht außer Frage und lässt sich in jeder individuellen Lektüre mühelos nachvollziehen, dass der Akt der Sinngebung am Ende von Büchern eine besondere Zuspitzung erfährt. Auf den letzten Seiten verdichten sich unsere Erwartungen nach einem Zusammenhang, und in den letzten Sätzen spitzt sich die Frage zu, ob uns das Werk am Ende doch noch als ein Ganzes erscheint.
Am Ende der Lektüre spielen sich kleine Dramen ab: Die Ambivalenz des Aufhörens, Nicht-Aufhören-Könnens oder Aufhören-Müssens strahlen auf den Text und seine Inhalte zurück. Die Art und Weise, in der ein Stück Literatur endet, lässt sich dabei selbst als eine Aussage über das Enden verstehen. Dieser Aussage kommt eine besondere Relevanz in Texten zu, die sich auch thematisch mit dem Ende beschäftigen, so wie dies österreichische Autorinnen und Autoren in ihren säkularisierten Apokalypsen von Karl Kraus über Ödön von Horváth und Hans Lebert bis hin zu Elfriede Jelinek häufig tun. Zwischen dem Ende des Textes und dem, was der Text über das Ende aussagt, kommt es zu Interferenzen, Widersprüchen und/ oder Übereinstimmungen. Hier bieten sich Einstiegsmöglichkeiten für eine Lektüre, die nach der internen Struktur und den produktionsästhetischen Voraussetzungen der Texte fragt. Schließlich wollen wir wissen, wie Schriftsteller ans Ende ihrer Bücher gekommen sind. Ob sie den Schluss von Beginn an planten oder erst im Verlaufe ihrer Arbeit entwickelten. Oder ob sie einfach nur aufhörten, weil es anders nicht weiterging.
Jedes Ende ist künstlich
Spätestens in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert laufen die teleologischen Restkonzepte aus. Statt des telos, das im Ende die Erfüllung eines Zieles sah, bleibt das eschaton, ein bloßes Aufhören der Zeit. Mit dem Ende war früher alles viel einfacher. Es erschien ein hilfreicher Engel auf der Erde und rollte das Firmament wie eine Schriftrolle auf. In dieser letzten Schrift gewannen die letzten Dinge einen letzten Sinn, nämlich denjenigen, Gott zu loben. In heutigen Büchern rollt sich ein Ende nach dem anderen auf, es kommt aber trotz dieser zahllosen Enden kaum etwas zu einem wirklichen Schluss. Das Ende ist nicht mehr als eine feste Struktur von außen vorgegeben, es muss aus der Logik des Einzelwerks heraus produziert werden, und dieses Produziertsein haftet dann auch einem jeden literarischen Ende an.
Paul Valéry hat die wichtige Beobachtung gemacht, dass ein Werk zu vollenden nichts anderes bedeutet, als es von allem zu befreien, was von seiner Herstellung zeugt oder an sie erinnern könnte. Modernen Autoren ist eine solche Loslösung des Werkes vom Schaffungsakt nicht mehr vergönnt. Am Ende ihrer Bücher ragen die Hilfskonstruktionen der Arbeit aus den Werken heraus, und selbst dann, wenn diese Linien am Ende kunstvoll verknüpft sind (wie beispielsweise in den großen Romanen von Heimito von Doderer), merkt man ihnen an, dass sie nicht alleine zueinander fanden, sondern miteinander verknüpft werden mussten.
Buch zu, Leben geht weiter
Joseph Conrad, in dessen Romanen die Erfahrung sich verselbständigte und über alle Enden hinaus zu wuchern begann, machte anhand von Henry James die Beobachtung, dass in dessen Bücher ein - wie er meinte - menschliches Grundbedürfnis nicht erfüllt werde, nämlich den Leser am Ende in einem beruhigten Zustand zu hinterlassen. Bücher enden fortan so, wie eine Episode im Leben endet, das Leben aber und die Produktion, die ihr schlagendes Bild in den endlosen Förderbändern der Fabriken findet, geht weiter. "There ist nothing to show at end", sagt Conrad und in seinem Buch "The Nigger of the Narcissus" liefert er selbst einen entsprechenden Schlusssatz: "The dark knot of men driftet in sunshine." Nachdem der tote Körper von James Wait über die Schiffsplanke geworfen wurde, geht das Leben der anderen weiter, ganz so als wäre überhaupt nichts geschehen. Dass die Welt sich nicht mehr um das individuelle Schicksal derjenigen kümmert, von denen in den Büchern berichtet wird, ist der Stoff, aus dem die Enden des 20. Jahrhunderts sind. Man denke nur an den letzten Satz von Kafkas "Urteil": "In diesem Augenblick ging über die Brücke ein geradezu unendlicher Verkehr." Auch Ilse Aichinger bedient sich exakt dieses Musters. Nachdem das Mädchen Ellen von einer explodierenden Granate in Stücke gerissen wurde, schließt "Die größere Hoffnung" mit dem Satz: "Über den umkämpften Brücken stand der Morgenstern."
Den Leser beruhigen
Interessant sind die Gedanken, die sich der Erzähler der "Blechtrommel" am Ende des Buches macht. Er weiß nicht so recht, ob er Oskars Geschichte mit dem Bild einer in der Metrostation Maison Blanche steil aufsteigenden Rolltreppe beschließen soll, und entscheidet sich dann (und zwar deshalb, weil ihm die Rolltreppe zuviel Lärm macht) doch dafür, den dreißigsten Geburtstag des Helden zum Schlusspunkt zu nehmen. Der Unterschied zwischen diesen beiden Enden umspannt die ganze Theorie des Romans.
Friedrich Blanckenburg hat sich in seiner 1774 erschienenen Grundlegung mit der Frage auseinandergesetzt, bis zu welchem Ende der Romandichter seine Charaktere zu führen habe, wenn der Leser "beruhigt seyn soll." Da es dem bürgerlichen Roman nicht um den äußeren Lebenslauf, sondern um die innere Entwicklung des Subjekts geht, sollte sein Ende das Subjekt auf dem Gipfelpunkt seiner Entwicklung zeigen. Der weitere Verlauf der Lebensgeschichte, den man nur noch als einen "Abstieg" zum Tod sah, blieb systematisch ausgespart.
Walter Benjamin hat die Aufmerksamkeit auf die Paradoxien der bürgerlichen Romantheorie gelenkt: Um ein Ganzes zu gestalten, sieht sich der Schriftsteller gezwungen, im Leben des Helden einen gewaltsamen Schnitt zu setzen. Im 20. Jahrhundert fangen diese Schnitte zu bluten an. Friederike Mayröcker beispielsweise führt in der Serie ihrer großen Prosabücher das Ende eines jedes einzelnen Textes gedanklich mit dem Ende ihres Lebens eng. Auch bei Samuel Beckett will die Stimme des Autors, gerade weil von ihr nur noch eine Schwundstufe geblieben ist, nicht freiwillig verstummen. Die Entscheidung über das letzte Wort liegt nicht beim Autor, sondern bei demjenigen, der über das Leben des Autors zu befinden hat. Robert Gernhardt stellt diese ernste Sache mit den Mitteln der neuen deutschen Spaßkultur dar: "Ach, noch in der letzten Stunde/werde ich verbindlich sein./ Klopft der Tod an meine Türe/rufe ich geschwind: Herein!//[...] Ja, die Uhr ist abgelaufen/Wollen Sie die jetzt zurück/Gibt's die nirgendwo zu kaufen?/Ein so ausgefall'nes Stück.//Findet man nicht alle Tage,/Womit ich nur sagen will/- ach! Ich soll hier nichts mehr sagen?/Geht in Ordnung! Bin schon//"
Stilles, sinnloses Ende
Das Ende ist willkürlich, sinnlos und still und macht sich heute in dieser Form nicht nur in humorigen Gedichten, sondern tendenziell am Ende vieler Romane breit. Die Avantgarde, die ihre Schreibweise vom Körper ableitet und die ihr Schreiben auf den eigenen Körper hin definiert, hat dafür ein besonderes Sensorium entwickelt. In Richard Brautigans Roman "Forellenfischen in America" gesteht der Erzähler, dass er immer schon ein Buch schreiben wollte, das mit dem Wort "Mayonnaise" aufhört. Am Ende bekommt der Leser, was er verdient: Ein abschließendes Mayonnaise-Kapitel, das mit jenem Ding endet, das jetzt keiner mehr braucht: "PS: Entschuldigt bitte, aber ich habe vergessen, Euch das Glas zu geben. Das Glas mit Mayonnaise." Konrad Bayer geht in seinem "sechsten sinn" einen Schritt weiter. Der Schluss des Buches formt die Willkür des Endes zu einer Allegorie des Lesens um, die in ihrer puren Faktizität heute mehr zählt als alles andere, was man sich am Ende denken mag: "machen Sie das buch zu!, sagte dobyhal."
Der Autor war im Wintersemester 2002/03 Research Fellow am Internationalen Forschungszentrum Kulturwissenschaften in Wien. Der Text ist die stark gekürzte Fassung seines Vortrages am IFK vom 16. Juni.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!