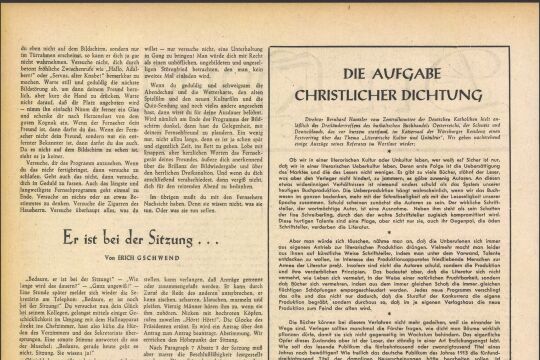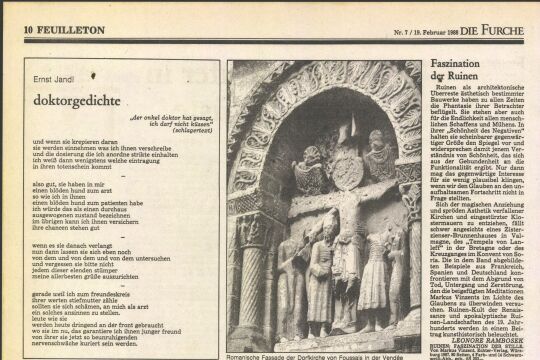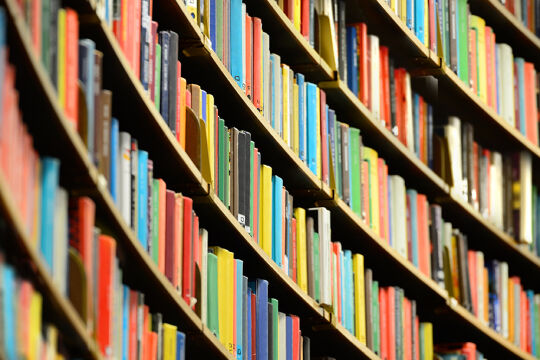Der Blick der Literatur auf eine ökonomisierte Welt.
Heinrich Schmidinger spricht in seiner Einladung zu den diesjährigen Salzburger Hochschulwochen, die nach den "Chancen des Christlichen in einer ökonomisierten Welt" fragen, von der Erfahrung einer Welt, in der sich "bereits auf struktureller Basis Spielregeln durchgesetzt [haben], die jeder, der darin mitmacht, einhalten muss, ob er will oder nicht". Literatur entsteht in und aus einer solchen Wirklichkeit, ist in ihren konkreten Produktionsbedingungen von ihr ebenso geprägt wie in ihrer inhaltlichen und formalen Gestaltung. Literarische Texte sind zwar kein Spiegel der Welt, sie sind aber - und das macht sie gerade so interessant - Versionen der Wirklichkeit. Welche Versionen der Wirklichkeit setzt nun eine gegenwärtige Literatur, die ökonomisierte Welt und ihre Spielregeln wahrnehmend, dieser entgegen?
Das gegenwärtige Spektrum geschaffener literarischer Welten ist breit. Man findet etwa literarische Gegenwelten, die so tun, als ob es die täglich erfahrene Welt nicht gäbe, man findet welche, die - das soziale und politische Umfeld ausklammernd - dem einzelnen vorgaukeln: "Du kannst alles, wenn du nur willst". Aber es finden sich auch Welten in der Literaturlandschaft, die Bezug nehmen auf die Erfahrung einer ökonomisierten Welt. Davon seien zwei - völlig unterschiedliche - Beispiele kurz vorgestellt.
Ein Buch, ein Faustschlag
Die Spielregeln sind hart, das Thema ist nicht gemütlich, und wenig gemütlich ist auch die Lektüre von Ernst-Wilhelm Händlers Roman "Wenn wir sterben", ein Buch wie ein Faustschlag im Kafka'schen Sinn, ein Buch, das beißt und sticht.
Das beginnt schon auf den ersten Seiten. Da zeigt sich: das Lesen dieses Textes ist alles andere als einfach. Die vielen Stile, die vielen Perspektiven verwirren, verstören. Es dauert, bis sich ein Bild formt, so etwas wie eine Geschichte, eine Chronologie und eine Ahnung von dem Ungeheuerlichen, das hier vorgeht. Das aber sehr bekannt vorkommt, gerade in seiner Undurchschaubarkeit. Da scheint einiges aus der Bahn zu geraten, allem voran die Vertrauensbasis dreier Frauen, alle Managerinnen, die ohne viele Worte gemeinsam eine Firma leiteten. Bisher.
Blut, nein Geld geleckt
Stine hat Blut, nein Geld geleckt. Sie wird Vorstandssprecherin und verleitet Charlotte, die Inhaberin der Firma Voigtländer, zu einer riskanten Investition. Es kommt, wie Stine es plante, zu Verlusten. Charlotte versinkt in chronischer Müdigkeit und damit im Abseits. Auch Bär, die dritte im einstigen Bunde, eine kreative Unternehmensplanerin, wird von Stine abserviert. Doch selbst die vermeintliche Siegerin geht am Ende vor die Hunde: sie wird bei einem Joint Venture von Milla, der lachenden vierten, "geschluckt".
So einfach wie hier in wenigen Sätzen versucht wird, die Story bzw. wenigstens Teile davon nachzuerzählen, ist nichts in diesem Roman. Händler fusionierte. Er usurpierte die Stile von Autorenkollegen und bastelte sie zu einem Bild vielstimmiger Wirklichkeit. Einverleibt, geschluckt, neu geformt. Kein individueller Autor mehr zu erkennen, kein Subjekt.
Händler träufelt keine Moralinsäure in sein Werk und vergiftet es dadurch auch nicht. Dafür beobachtet er bis ins Detail Prozesse der Wirtschaft ebenso wie der Psyche. Schaudernd liest der Leser von der Spitzenmanagerin Milla, die aus der Haut gefahren ist und sich in zwei Ichs gespalten hat, von der Entscheidung Stines, böse zu sein, vom Zerbröseln einer Idealvorstellung von Teamarbeit ohne feste Regeln in ein Ringen um Macht, bei dem Freundschaften selbstredend auf der Strecke bleiben. Schaudern liest der Leser von Personen, die nichts anderes als ihre Funktionen sind (und deshalb auch jederzeit austauschbar). "was ist der mensch? ein haufen fleisch, in geld eingewickelt? das controlling sprach zu sich selbst."
Nicht nur Leben sieht heute anders aus, erzählt dieser Roman, auch Sterben hat sich geändert. "Natürlich stirbt man als moderner Eroberer nicht mehr an Giftpfeilen oder an der Malaria, und man erfriert auch nicht mehr. Man fällt ganz einfach für das öffentliche Leben aus. Die Sache war eine Fehlinvestition, man verkauft die Praxis und verdingt sich bei einem Kollegen als angestellter Arzt oder Rechtsanwalt. Die Firma geht pleite, man findet eine Stelle als Hilfsbuchhalter. In einer anderen Stadt natürlich. So stirbt man zeitgemäß."
Am Ende sind die Frauen ihre Jobs, für die sie gelebt haben, los. Vielleicht beginnt dann das Leben? Ist das Untergehen in der Wirtschaft letztlich ein Gewinn? Ein Alptraum oder ein Wahrtraum - die Frage, die sich Stine schließlich stellen muss, bleibt auch für den Leser quälend offen.
Offen endet auch José Saramagos Roman "Das Zentrum". Der portugiesische Schriftsteller beweist mit diesem Werk einerseits seine grandiose Erzählbegabung - mit ironisch-liebevollem Erzähleratem haucht er seinen Figuren Leben ein - andererseits seine Wachheit gegenüber der Gegenwart.
Wer im Wissen darum, dass Saramago 1969 der kommunistischen Partei Portugals beigetreten ist, meint, bei seinem Roman handle es sich um ein kommunistisches Manifest, irrt und verkennt Saramagos literarisches Können völlig. Keine politische Botschaft hat Saramago zu verkünden, sondern eine literarische Welt zu erbauen, die in und von ihrer Form lebt, mit dazugehöriger Vielschichtigkeit und Inanspruchnahme des Lesers, auf die sich der Literaturnobelpreisträger besonders versteht. Die Leser bangen von der ersten bis zur letzten Seite mit dem 64-jährigen Töpfer Cipriano, dem "das Zentrum" seine Tonprodukte nicht mehr abnehmen will, der sich aber mit seiner Tochter um einen neuen Auftrag bemüht. Tagelang, wochenlang formen sie kleine Figuren. Seine Arbeit ist Mythos, Sinnbild göttlichen ebenso wie menschlichen Schaffens, eine Arbeit der Hände, bei der Sinnlichkeit, Gefühl, Freude eine Rolle spielen. Die Leser bangen mit ihm, seitenlang - und wissen doch, wie es ausgehen wird.
Kein Sowohl-als-auch
Saramagos Roman ist wie eine Parabel. Das Zentrum der Zivilisation umfasst alle Merkmale einer modernen Antiutopie. Es erscheint als Sinnbild einer für keinen mehr durchschaubaren, unheimlichen, anonymen und offensichtlich trotzdem verlockenden Macht. Verspricht Wohlstand. Geld. Sinnvernichtung. Im Umgang mit dem Zentrum scheint es nur die Alternative zu geben: drinnen oder nicht drinnen. Sowohl-als-auch-Arrangements gibt es nicht. Am Ende steht die Abkehr vom Zentrum und - weil es kein Zurück geben kann - der Aufbruch in eine höchst ungewisse Zukunft, das Verlassen der heimatlichen Wurzeln. Aber immerhin der Aufbruch einer Familie und nicht eines einzelnen.
Wozu nun diese Romane? Was fängt der zivilisierte Großstadteuropäer mit dem poetischen Stilpuzzle eines Wirtschaftsromans, was mit den Erfahrungen und Gedanken eines fiktiven Töpfers an?
Der Schriftsteller Uwe Johnson meinte einmal, Romane taugten dazu, "diese Version der Wirklichkeit zu vergleichen mit jener, die Sie unterhalten und pflegen. Vielleicht passt der andere, der unterschiedliche Blick in die Ihre hinein." Darum geht es letztlich beim Lesen. Literatur ist "eine Welt, gegen die Welt zu halten". Nicht mehr, aber vor allem nicht weniger!
Furche-Redakteurin Brigitte Schwens-Harrant leitet im Rahmen der Salzburger Hochschulwochen am 6. und 7. 8. 2004 das Seminar "(Gegen-)Welt Literatur".
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!