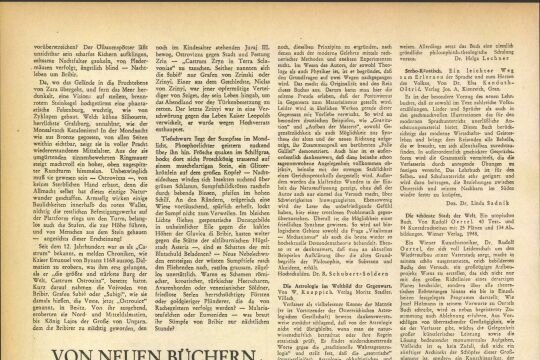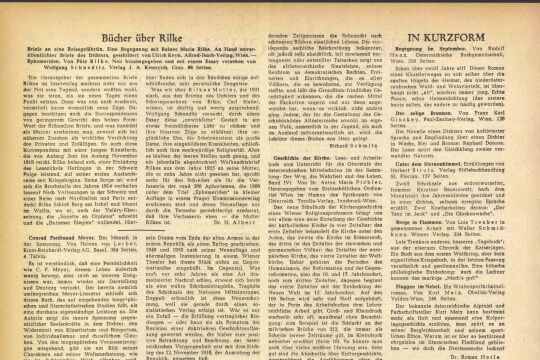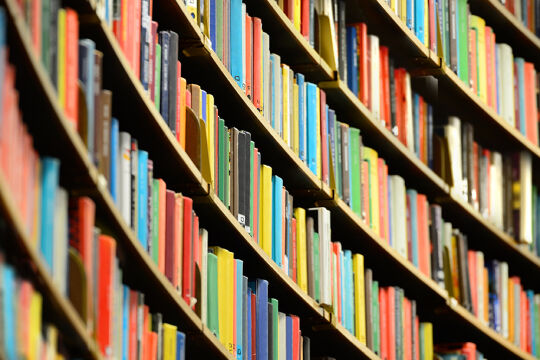Identitäten sind brüchig, sie sind Patchwork – Orientierungsverlust und Identitätssuche sind die Themen der neueren Literatur.
„Und frei erklär ich alle meine Knechte“: Das waren noch Zeiten, als Friedrich Schiller 1804 seinen „Wilhelm Tell“ mit einer sozialen Utopie enden lassen konnte. Aber Schiller wusste, dass er nicht ein Ziel markierte, sondern die Karte für einen Weg entwarf. Schon seine Figuren sind vielfach gebrochen und fast alle scheitern, von Karl Moor über Wallenstein bis zu Maria Stuart. Wer überlebt, ist isoliert (etwa Philipp II. im „Don Carlos“ oder Elisabeth I. in „Maria Stuart“) oder legt, wie Tell, seine Armbrust zur Seite. Mit ihr hat er den Reichsvogt erschossen – eine schwere Hypothek für einen so geradlinigen Charakter.
Das 19. Jahrhundert ist ein Jahrhundert der Desillusionierungen. Die Demokratisierungsbestrebungen haben kaum Erfolg und die konservativen Kräfte behalten die Oberhand. Charles Darwin entdeckt mit den Grundlagen der Entstehung der Arten die Abhängigkeit des Menschen von der Natur und Sigmund Freud zeigt auf, dass das Ich nicht mehr Herr im eigenen Haus ist. Die letzten Hoffnungen der Literaten auf ein neues Menschenbild sterben im Kugelhagel des Ersten Weltkriegs. Die Faschisten schaffen es, die totalitären Tendenzen des 19. Jahrhunderts erfolgreich nutzbar zu machen, und sie ersticken alle Versuche im Keim, den Freiheitsbegriff nun endlich einmal ernst zu nehmen. Doch auch damit ist es 1945 vorbei.
Eines aber bleibt: Die Literatur, zumindest die ernst zu nehmende, begleitet alle Veränderungen kritisch und sät selbst in der größten negativen Utopie den Samen der Hoffnung, denn was wäre das Negative anderes als die Aufforderung, es gar nicht erst so weit kommen zu lassen. Auf die Frage, wo in seinen Texten das Positive bliebe, antwortet Erich Kästner in einem Gedicht: „Ja, weiß der Teufel, wo das bleibt!“ Das soll aber keine Absage, sondern eine Ansage sein – endlich einmal nachzudenken, was man selbst dazu tun kann, dass es Positives gibt, worüber es sich lohnt, Texte zu schreiben. Kästner hat das ja auch getan, vor allem in seinen Kinderbüchern.
Gewissheiten gibt es nicht
Wenn man Identität begreift als „Echtheit einer Person oder Sache; völlige Übereinstimmung mit dem, was sie ist oder als was sie bezeichnet wird“ (so das Duden-Universalwörterbuch), dann muss man sagen, dass es wohl keine Identität mehr gibt, denn welcher intelligente Mensch könnte noch von sich behaupten, mit sich selbst übereinzustimmen? In den Sozialwissenschaften spricht man daher von Patchwork-Identitäten. Endgültige Gewissheiten gibt es nicht, jede Erkenntnis ist subjektiv und niemand kann aus seiner (oder ihrer) Haut heraus. Wir basteln uns also unsere Identitäten aus den Bausteinen, die wir vorfinden, und das wird zunehmend schwieriger. Ulrich Beck hat dafür den Begriff der „Risikogesellschaft“ geprägt und Jean-François Lyotard hat festgestellt: „Das Selbst ist wenig, aber es ist nicht isoliert, es ist in einem Gefüge von Relationen gefangen, das noch nie so komplex und beweglich war.“
Die Literatur wusste das schon lange, vielleicht schon immer. Mit der Figur des Don Quijote, den Cervantes am Anfang des 17. Jahrhunderts Windmühlen angreifen ließ, beginnt nicht nur der moderne Roman, sondern auch die Identitätskrise in der Literatur. Angesichts von globalen Bedrohungen, prekären Arbeitsverhältnissen, aufgebrochenen Familienstrukturen und Migrationsbewegungen, kurz: auf gestiegene Einsamkeit und Wurzellosigkeit reagiert die neueste Literatur allerdings durch immer stärkere Betonung der Brüche im Subjekt. Wie kann man eine Passung von innerer und äußerer Welt unter solchen Umständen noch herstellen?
Der Orientierungsverlust lässt sich historisch perspektivieren, wie dies Ruth Klüger in ihrem autobiografischen Buch „weiter leben“ von 1992 getan hat. In Wien als Tochter eines jüdischen Frauenarztes geboren, wurde sie als Kind mit ihrer Mutter ins KZ Theresienstadt deportiert. Und der 1944 in Bayern geborene, nach England emigrierte W. /G. Sebald zeichnet in seinem besten Roman „Austerlitz“ von 2001 exemplarisch das Schicksal eines Menschen, der während der NS-Zeit durch einen Kindertransport nach England kam und dadurch Familie und Heimat für immer verlor. Auch wenn Jacques Austerlitz ein scheinbar normales Leben führt/– das Trauma bleibt bestehen: „die Vernunft kam nicht an gegen das seit jeher unterdrückte und jetzt gewaltsam hervorbrechende Gefühl des Verstoßen- und Ausgelöschtseins“.
Vom Scheitern geprägt
Doch auch die Texte sehr junger Autoren sind geprägt vom Scheitern am Versuch, eine einigermaßen stabile Identität zu gewinnen. Bahnbrechend war Bret Easton Ellis’ erster Roman „Unter Null“ von 1985, in dem die mit sich selbst allein gelassenen jungen Leute verzweifelt und vergeblich versuchen, ihrem Leben durch Konsum, Sex und Drogen einen Sinn zu geben, ohne – und das ist der Unterschied zu 1968 – damit noch eine positive Utopie verbinden zu können. Christian Krachts einflussreicher Roman „Faserland“ von 1995 ist die deutsche Variante – ein junger Ich-Erzähler reist von Sylt bis zum Zürichsee, wie seine reichen Freunde schlägt er die Zeit auf Partys tot. Zahlreiche weitere Texte jüngerer Autorinnen und Autoren thematisieren in der Folge einen ähnlichen Orientierungsverlust, auch wenn sie in Stil und Inhalt ganz unterschiedlich sind, man denke nur an aufsehenerregende Debüts wie Zoë Jennys „Das Blütenstaubzimmer“ und Alexa Hennig von Langes „Relax“, beide von 1997, Judith Hermanns „Sommerhaus, später“ von 1998 oder Benjamin Leberts „Crazy“ von 1999.
Glücklos auf der Suche
Eigentlich ist die Identitätssuche ein übergreifendes, die ganze neuere Literatur einigendes Thema. Der 1940 geborene Uwe Timm hatte schon vor Beginn der neueren Popliteratur in seinem Roman „Kopfjäger“ von 1991 das durch Orientierungsverlust gestiegene Markenbewusstsein kritisch hinterfragt. Seine Romane haben – von „Heißer Sommer“ (1974) bis „Halbschatten“ (2008) – Figuren mit unterschiedlichen Biografien. Ganz gleich, ob sie in Deutsch-Südwestafrika am Anfang des 20. Jahrhunderts („Morenga“, 1978), in der Studentenbewegung von 1968, in der NS-Zeit oder in der Gegenwart spielen: Alle Figuren sind mehr oder weniger glücklos auf der Suche nach sich selbst. Ein so weit verallgemeinerter Befund ließe sich auch auf so unterschiedliche Autorinnen und Autoren wie Thomas Bernhard, Elfriede Jelinek oder Martin Walser anwenden.
„Kein Ort. Nirgends“ also für das umherirrende Ich? – um den Titel von Christa Wolfs 1979 veröffentlichter und immer noch betroffen machender Erzählung über ein fiktives Treffen Heinrich von Kleists mit Karoline von Günderode zu zitieren. Raoul Schrott lässt seinen monumentalen Roman „Tristan da Cunha oder Die Hälfte der Erde“ von 2003 nicht zufällig auf einer Insel am Ende der Welt spielen. Angesichts der flüchtigen Identitäten gibt es nur noch hybride Räume oder solche des Übergangs. Das bestätigt die neueste Literatur, etwa Daniel Kehlmanns „Ruhm. Ein Roman in neun Geschichten“, in dem Figuren verschwinden, entweder weil das Erzählen über sie abgebrochen wird oder weil sie, wie die Schriftstellerin Maria Rubinstein, in einem Raum, durch den sie sich bewegen, verloren gehen. Interessanterweise hat gerade die Geschichte „Rosalie geht sterben“ ein positives, wenn auch offenes Ende.
Verloren im Raum
So weit möchte Juli Zeh in „Schilf“ von 2007 nicht gehen. Die Titelfigur, ein Kommissar, stirbt zum Schluss an einem Tumor, doch hat der Ermittler es geschafft, einen Fall von Mord und Entführung aufzuklären und zwei Freunde, von denen einer der Mörder ist, miteinander zu versöhnen. Eine Familie ist zerstört, zwei Menschen sind tot, und dennoch scheint es so etwas wie Hoffnung zu geben. Nur auf was? Darauf kann Literatur keine direkte Antwort formulieren, sie würde sonst dem Kitsch verfallen. Es sei denn, man geht vor wie Wolf Haas, der in „Das Wetter vor 15 Jahren“ von 2006 ein klassisches Happy-End zu erzählen vermag, allerdings nur, weil er es mehrfach ironisch bricht.
Dabei scheint es sogar möglich, wie es die Figuren der Autorin Felicitas Hoppe tun, dem Orientierungsverlust etwas abzugewinnen. Man darf nur nicht ständig fragen, was denn der Sinn von alldem sein soll, was man erlebt und was einen umgibt. Die Protagonistin von Hoppes Roman „Johanna“ von 2006 schafft es zwar (noch) nicht, ihre Promotion zu einem guten Ende zu bringen, aber ihrem Freund namens Peitsche kommt sie ein wenig näher: „Und morgen, falls es das Wetter erlaubt, werden wir uns duzen“, so lautet der letzte Satz des Romans. Das ist, gerade in einer Zeit, in der nur noch auf die Krise Verlass ist, schon mal etwas.
Stefan Neuhaus, geb. 1965 in Wimbern/Westfalen, Universitätsprofessor am Institut für Germanistik der Universität Innsbruck. Zahlreiche Publikationen, zuletzt u. a.: „Märchen“ (2005), „Literaturvermittlung“ (erscheint im September 2009), Herausgeber von „Felicitas Hoppe im Kontext der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur“ (2008).
Honoré Daumier: „Don Quijote und Sancho Pansa“ (1865–70)
Johanna
Roman von Felicitas Hoppe
S. Fischer 2006. 176 S., geb., € 18,50
ISBN: 3-10-032450-1