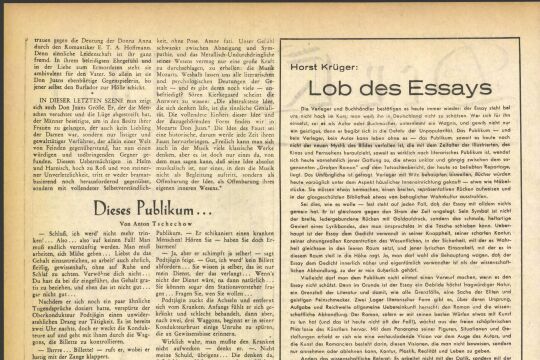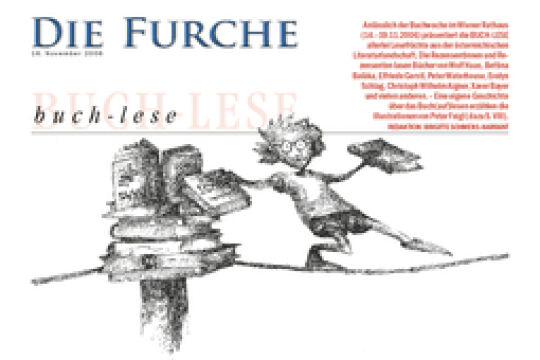Die Gegenaufklärung zieht sanft und charmant durchs Land. Sie geht nicht in die Offensive, schlägt den Gegner nicht kurz und klein, sie sieht ihrem Gegner nicht einmal ins Auge. Die Gegenaufklärung von heute ist eine ideologiefreie Zone. Sie kann deshalb auf einen Widerpart verzichten, weil sie sich selbst genug ist. Sie ist eine Frage der Haltung, des Stils, der Form, Inhalte stehen nicht im Mittelpunkt.
Jene Literaten, die sich dieser Gegenaufklärung verschrieben haben, streben kraft ihrer eigenen Bücher an, komplexe Verhältnisse auf neue, einfache und deshalb auf den ersten Blick so einleuchtende Sachverhalte zu reduzieren. Ihr Prinzip ist die Gemütlichkeit bei gleichzeitiger Beteuerung, dass die Welt furchtbar kalt und ungemütlich geworden ist. Da ziehen wir uns doch gleich warm an, vertrauen auf einen Erzähler von echtem Schrot und Korn und lassen uns von ihm erzählen, wie es so zugeht in der Welt draußen.
Rettung in Sprachkraft
Die Welt ist nämlich groß, Rettung lauert nicht überall, aber in der Sprachkraft eines fantasiebegabten Schriftstellers. Wir befinden uns – um ein berühmtes Beispiel herauszugreifen – im Reich des strahlenden jungen Gottes der österreichischen Literatur, wir folgen gemessenen Schrittes den Vorgaben des Daniel Kehlmann. Ihm gelingt alles. Er hat es zum Liebling des deutschen und österreichischen Feuilletons gebracht, wird geschätzt als klug reflektierender Gesprächspartner und ist mit seinen Büchern in den modernen Deutschunterricht vorgedrungen. Erfreulich ist, dass jemand nicht erst tot sein muss, um als Literat ernst genommen zu werden. Aber ist rundum erfreulich, was Kehlmanns Literatur auszeichnet?
Literatur muss nicht der Aufklärung verpflichtet sein, schon gar nicht muss sie den Leser zum Kumpanen einer edlen Gesinnung machen. Allzu viele schlechte Bücher sind solch hehren Absichten schon entwachsen. Literatur ist ein ästhetisches Phänomen, ihre Wirkung erzielt sie über die Form. Was ein Text leistet, entscheidet nicht die Wahl des Stoffes, sondern die Beherrschung der literarischen Mittel. Kehlmann, so gewandt er sich auch zu inszenieren vermag, ist kein Schriftsteller von origineller eigenständiger Kraft. In Gesprächen mit Kehlmann fällt auffallend oft der Begriff Avantgarde. Manchmal setzt er sich scharf davon ab, dann wieder sieht er sich in deren Traditionen.
In einem Gespräch mit Ulrich Weinzierl gesteht er, dass er seinen Roman „Ruhm“ als „ein experimentelles Buch“ auffasst und als „Rückgriff auf die Avantgarde“ – und zwar auf die amerikanische. Und dann verweist er noch auf Leo Perutz. Tatsächlich besteht der Roman aus neun Geschichten, die unabhängig voneinander gelesen werden können. Die Figuren tauchen in anderen Erzählungen auch auf, sodass die Hauptfigur der einen Geschichte zur Nebenfigur einer anderen wird. Diese Struktur entspricht Perutz Roman „Nachts unter der steinernen Brücke“. Aber was hat das alles mit Avantgarde zu tun?
Ein anderes Mal traf Walter Grond auf Kehlmann, um lange auf ihn einzureden. Dabei stellte er die denkwürdige Beobachtung an, dass beide, Grond wie Kehlmann, „die Aufklärung als Mitzweck von Literatur nicht ganz aufgeben“. Das hätte man gerne etwas genauer ausgeführt gesehen, denn mit der Aufklärung bei Kehlmann ist es nicht weit her. Und das ist ein Problem der Darstellung.
Behaglichkeit statt Kritik
Wo Kehlmann hintritt, stellt sich umgehend die Aura einer umfassenden Behaglichkeit ein. Dieser das Gefühl so anheimelnd umschmeichelnde, die gesamte Existenz umhüllende Raum des Wohlseins ist der Tod der Aufklärung. Diese hat sich Kritik und Reflexion als die bohrenden Instanzen geschaffen, um Unruhe zu stiften im großen Einerlei der Gleichgültigkeit.
Romanen ist die wunderbare Fähigkeit eingeschrieben, Denken im Erzählen aufgehen zu lassen. Welche Welt tut sich auf, wenn wir Kehlmanns hoch gerühmten Roman „Die Vermessung der Welt“ lesen? Zwei Aufklärer stehen im Mittelpunkt, der Mathematiker Gauß und der Forschungsreisende Humboldt. Der eine kommt kaum jemals aus seiner Heimatstadt heraus, der andere verwirklicht sich im Unterwegssein. Die beiden Intellektuellen – ein Gegensatzpaar. Um das anschaulich ins Bild zu rücken, nimmt der Leser in sich jeweils abwechselnden Kapiteln an deren Unternehmungen teil. Zwei Aufklärer, zwei Wege der Welterforschung, zwei Figuren, über die sich heute herzhaft lachen lässt. Die Geistesgrößen erweisen sich als so mediokre Gestalten wie wir. Das gelingt Kehlmann deshalb so gut, weil er sich – wie im klassischen historischen Roman üblich – Figuren und deren Gedanken kurzerhand aneignet. Das treibt den beiden, die durchaus rätselhaft in ihrem spröden Dasein porträtiert werden könnten, jeden Hauch von Fremdheit aus.
Also, das ist schon sehr verrückt, wie sich dieser Humboldt im fernen Brasilien aufführt, aber irgendwie witzig. Und das ist wirklich schräg, wie sich Gauß in das Schneckenhaus seiner Wissenschaft zurückzieht, aber irgendwie monomanisch. Irritierend wirken beide nie, sind seltsame Vögel mehr als schwierige Charaktere, vor denen man auf der Hut sein sollte. Gauß und Humboldt lernen wir als weltfremde Gestalten kenne, verbohrte und verbiesterte Eigenbrötler. Solche Abziehbilder von Weltenforschern hatte der Volksmund schon immer heiter unter der Rubrik „verrückter Professor“ abgelegt. Die Aufklärung, ein Fall für Sonderlinge, ein Fehlversuch der deutschen Geschichte. Ein Roman vom Schlage eines Daniel Kehlmann lässt Denken nicht im Erzählen aufgehen, weil er lieber behauptet, was der Fall ist.
Aufsehen erregte Daniel Kehlmann im Sommer mit seiner Eröffnungsrede zu den Salzburger Festspielen. Diese wurde als Angriff auf das Regietheater aufgefasst, der Verfasser bezog dafür reichlich Prügel. Bemerkenswert am Text ist, wie Kehlmann unvermutet ideologisch zu argumentieren beginnt: „In einer Welt, in der niemand mehr Marx liest und kontroverse Diskussionen sich eigentlich nur noch um Sport drehen, ist das Regietheater zur letzten verbliebenen Schrumpfform linker Ideologie degeneriert.“ So einfach ist das: Links ist, was Kehlmann und all den anderen, die nicht mehr ins Theater gehen, nicht gefällt.
Emotion schlägt Vernunft
Das Regietheater, was immer man von ihm halten mag, ist ohne das Erbe der Aufklärung nicht vorstellbar. Es nimmt sich die Freiheit, in Texte einzugreifen, weil es vorsätzlich eingreifen will in das Denken und Fühlen der Menschen. Aber Kehlmanns eigentlicher Beweggrund für seine Attacke ist ein emotionaler. Er sieht seinen Vater, den Regisseur Michael Kehlmann, als Opfer des Regietheaters, dem er pauschal ein „Bündnis zwischen Kitsch und Avantgarde“ unterstellt. Emotion schlägt Vernunft, dieses rhetorische Muster entspricht dem Denken der Gegenaufklärung. Kehlmann dient hier als Beispiel. Von anderen wäre noch zu sprechen, von Thomas Glavinic, von Raoul Schrott vielleicht, aber Kehlmann ist die Symbolfigur einer neuen Literatur der Unbekümmertheit.
Es gibt sie aber, jene widerborstig quertreibenden Literaten, die Romane schreiben, in denen sich Geschichtsbewusstsein trifft mit dem unbedingten Willen zu einer einzigartigen, unverwechselbaren Form. Norbert Gstreins und Thomas Stangls Bücher wirken wie jene von Andrea Winkler als Gegengift zur Schmeichelware der Gegenaufklärer. Ihre Literatur stößt den Leser vor den Kopf, weil sie sich der Einfühlsamkeit widersetzen.
Diese Autoren machen sich fremde Identitäten nicht zu eigen, indem sie so tun, als wüssten sie, wie diese denken und fühlen. Sie bauen lauter Barrieren um eine Figur, auf dass man nicht vorschnell Schlüsse zieht und sich ein möglicherweise falsches Bild macht.
Was können wir wissen vom anderen, fragen sich Stangl wie Kehlmann. Stangl fürchtet, dass der andere ewig ein Fremdkörper bleiben muss. Was wir von ihm wissen, sind Fragmente, aus denen ein Ganzes zu erschließen vermessen wäre. Kehlmann sieht gerade den Mangel an Wissen als seine Chance. Das bietet ihm die Gelegenheit, sich einen Charakter zu erfinden, der viel vom Verfasser, aber wenig vom Porträtierten erzählt.
Kein Dingfestmachen
In Thomas Stangls jüngstem Roman „Was kommt“ wird die Zeit selbst zum Problem, Geschichte ist die zentrale Kategorie seines Denkens. Für Stangl ist Geschichte kein unendlicher Fundus, aus dem sich zu bedienen für einen Erzähler eine bequeme Angelegenheit sein könnte. Er schafft eine gedehnte, bleierne Zeit, die lastend und schwer über den Menschen hängt.
Zwei Personen treten aus dem Dunkel der Zeit hervor, Emilia Degen, die sich im Jahr 1937 durch das austrofaschistische Wien schlägt, und Andreas, der gegen Ende der siebziger Jahre mit antisemitischen Ausfällen unangenehm auffällt. Das ergäbe ein starkes Setting für einen Roman, der das pralle Leben ausstellt. Doch Stangl nimmt sich zurück, wenn er erzählt, betreibt er Flucht vor dem Dingfestmachen alles Vagen. Figuren werden Schimären, mehr als deren Alltagswirklichkeit faszinieren Stangl deren schwer fassbaren Träume, Fantasien, Ausfallbewegungen aus dem Regelsystem der Gesellschaft.
Während Kehlmann zaubert und jongliert und fremde Wirklichkeiten wie aus dem Nichts wunderschön und staunenswert erstehen lässt, schreibt bei Stangl stets der Zweifel mit, der große Bruder der Aufklärung. Ein Aufklärer vom Schlage Stangls weiß nicht alles besser, er schafft Bilder und Szenen, die sich überlagern und mehr Andeutung sind denn die nackte Wahrheit.
Was kommt
Roman von Thomas Stangl Droschl 2009 183 S., geb., e 19,60
Hanna und ich
Von Andrea Winkler Droschl 2008 133 Seiten kart., e 16,50
Die englischen Jahre
Von Norbert Gstrein Deutscher Taschenbuch Verlag 2008 388 S., kart., e 10,20