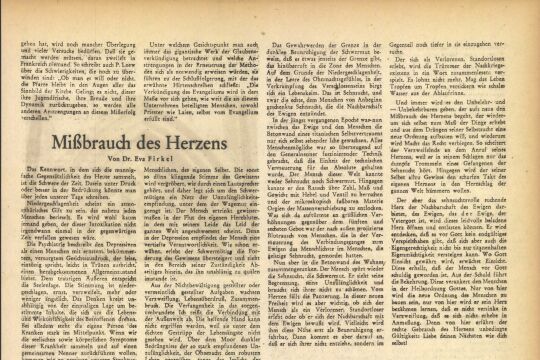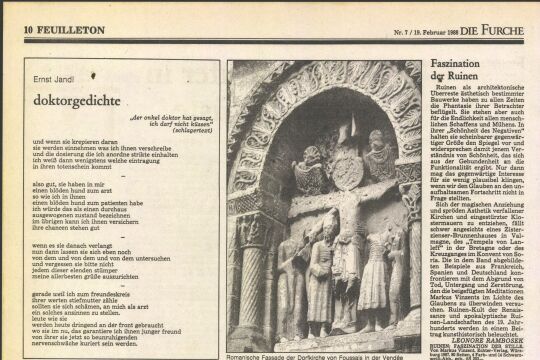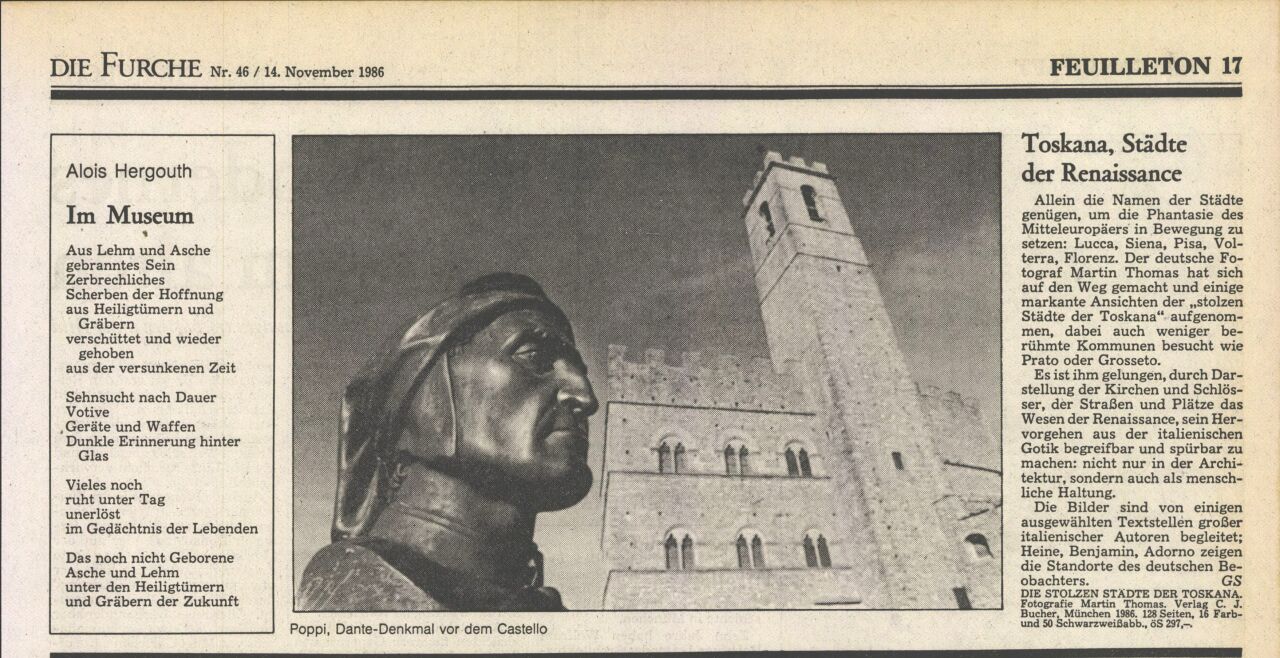
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Schillerndes Bild der Zeit
Zu „Werken der Einsamkeit“ müssen die Handlungen des gegen den Strom schwimmenden 'Einzelmenschen in einer Zeit geraten, in der Gruppenegoismen, als öffentliche Meinung getarnt, die Herrschaft angetreten haben. Der Lebensraum des nur seinem Gewissen, seinem Daimonion gehorchenden Ausnahmemenschen wird von den Mahlwerken der Macht hoffnungslos zerrieben. Was immer Wichtiges, für die Geseilschaft Bedeutsames er schaffen mag, er bleibt Außenseiter, ein scheckiger Farbtupfen, der im grau getönten Untergrund verrinnt.
Auf solchen kurzen Nenner könnte man György Sebestyens neuesten Roman bringen, wenn man Auskunft über die Aussage des nahezu fünfhundert Seiten umfassenden Werkes geben sollte. Da aber das Essayistische in einem guten Roman sich immer in den Schicksalen der auftretenden und handelnden Figuren sowie im Gefüge seines Geschehens verliert, wird man in Sebestyens breit angelegtem, an Proust gemahnendem Werk vergeblich nach derart lapidaren Resümees Ausschau halten.
Der Autor versteht es vielmehr, das in der Reflexion Erarbeitete durch die eigentümliche Optik des erzählenden Subjekts ironisch wieder zurückzunehmen: Zurückzunehmen wie das imaginäre Bild, das ein Fernrohr liefert, durch das man vom Objektiv her die Wirklichkeit anvisiert.
Denn der Erzähler des Romangeschehens ist Wissenschafter, genauer: Archäologe, und als solchem eignet ihm der unbestechliche Blick ebenso wie eine gewisse Umständlichkeit im Dar- und Auslegen des Geschauten. Seine Reflexionsketten über die Gesellschaft oder das zwischenmenschliche Gefüge sind wohlbegründet, aber das erlebte Leben ist um einige Schritte weiter, ist kräftiger und reicher: Eine Differenz — man möchte sie eine ontologische nennen—die der Autor als tragendes Element einer großen Komposition einsetzt, ein Grundmotiv, das sich zu einer spezifischen Schwermut verdichtet, die das ganze Werk wie ein Cantus firmus durchzieht.
Es ist die Schwermut eines, der um das Aufblühen, das Wachsen und Verwelken allen menschlichen Tuns weiß, der die Vergeblichkeit, die Vergänglichkeit auch der Werke unserer Einsamkeit kennt. Wie könnte man all das besser sichtbar und für den Leser nachvollziehbar machen, als durch das Leben eines, der von Berufs wegen dazu verhalten ist, den Schutt all des Vergangenen zu durchsieben und zu durchsich-ten?
Schon in der Jugend hat er mit seinem Freund Anselm, der Hauptgestalt des Romans, die Kreidesteinbrüche der Umgebung nach Resten prähistorischen Lebens durchsucht und in Anselm eine Neugier nach Namenlosem geweckt. Es ist ein Spürsinn in ihm aufgebrochen, der — ähnlich dem faustischen Drang — sich auf die Schöpfung als Ganzes richtet und der schließlich notwendig in die Frage münden muß: „Warum ist alles so, wie es ist?“ Die alte Frage also nach dem Ursprung des Bösen, lösbar nur in einem Glaubensverständnis, dem rationalen Zugriff unzugänglich.
Es ist die Geschichte zweier Vereinzelter, die durch ein feines Gespinst der Empfindungen einander in Freundschaft verbunden sind. Tiefer noch als die Gewöhnung verbindet den Erzähler mit Anselm so etwas wie ein Gefühl der Schuld; denn er hat den Halbwüchsigen einst auf den Weg der Gesellschaftskritik gewiesen und glaubt nun, an dessen Isolation ein gerüttelt Maß an Verantwortung mitzutragen. Aber auch das erweist sich letzten Endes als Mißverständnis oder entgleitet zumindest in den Bereich des Zweideutigen; denn woran Anselms Freundschaft sich emporrankt, das hat seine Wurzeln in anderen, tieferen Schichten.
Vor allem aber hat es seinen Ausgang von mit starker Emotionalität besetzten Eindrük-ken genommen und nicht von rational eVwägbaren Argumenten. Wie denn überhaupt die Rationalität in diesem atmosphärisch sehr dichten, ganz auf das Einfangen von Stimmungen und Sprachlich kaum ausdrückbaren Spannungsgefällen hin komponierten Roman als Funktion des die Macht ausübenden politischen Apparates decouvriert wird. Daß bei solcher Offensive der Gefühle und Empfindungsschichten die Erotik nicht zu kurz kommen darf, leuchtet ein.
Die Tante des Erzählers und die Mutter Anselms bilden die eine erotische Klammer zwischen den Freunden; die andere ist Verena, die im Leben der beiden eine entscheidende Stelle einnimmt. Mit ihrem irisierenden, unerhört ambivalenten Charakter verkörpert sie den Typus der Großen Mutter, der Ernährerin und Zerstörerin des Mannes — wie Isis, Ischtar, Astarte und Artemis Jägerin und Gejagte in einem: Ein Archetypus, der aus prähistorischen Zeiten in unser Zeitalter des Verstandes, der rationalen Ausrichtung des Lebens urtümlich hereinragt, wie jede Muttergottheit Lebensspenderin und Todesbegleiterin zugleich.
All das ist weit davon entfernt, im Ornamentalen zu verharren, ist keineswegs gelehrter Aufputz für ein an sonst eindimensionales Geschehen. Was Sebestyen vielmehr damit demonstriert, gehört mit zur eigentlichen Botschaft dieses überaus straff konstruierteh, durchorganisierten, reiche Welterfahrung fassenden Romans: daß auch die Menschen des funktionsbewußten technischen Zeitalters von denselben Triebkräften bewegt und erschüttert werden wie die früherer Epochen. Daraus resultiert aber auch ihre Gefährdung. Trotz enormer Steigerung ihrer Fertigkeiten vermögen sie es nicht, den seelischen Untergrund mit den rationalen Funktionen abzustimmen. Die wenigen Außenseiter allerdings, die es vermögen, die müssen scheitern.
Ein großer Roman, farbig und analytisch zugleich, ein Werk, das den Geist wie den Ungeist unserer Zeit ebenso hautnah spürbar macht wie die Trauer um die Zerbrechlichkeit und um das Versagen der zwischenmenschlichen — und das heißt: auch der erotischen und politischen — Dimensionen in unserer Zivilisation.
Der Autor ist Leiter der ORF-Hauptabteilung „Kulturelles Wort“.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!