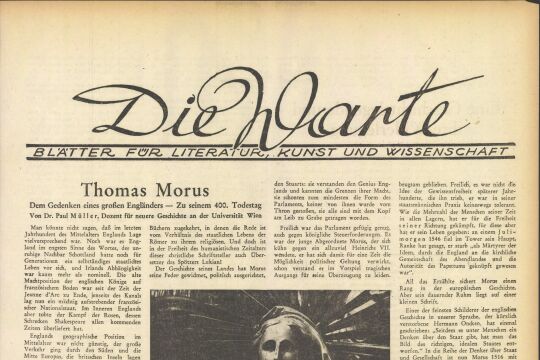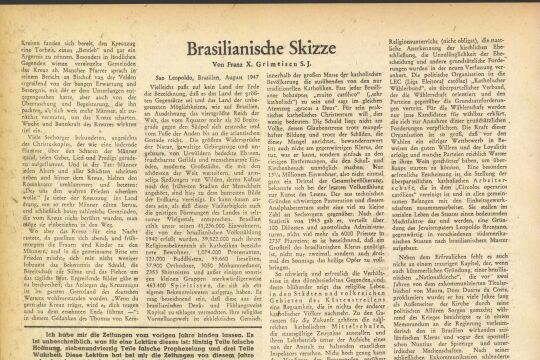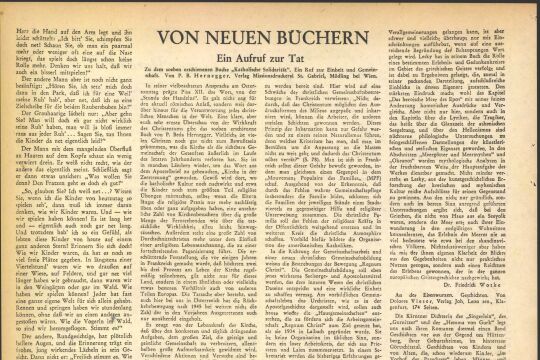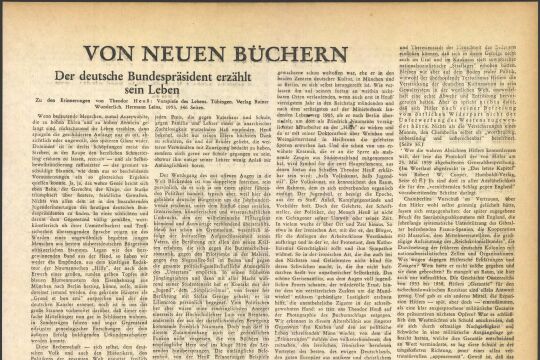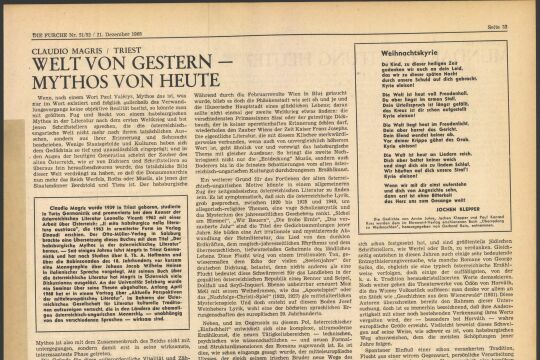Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Der Gemeinplatz
Die Bezeichnung eines Gedankens als gemeinplätzig wird heute als durchaus abträglich empfunden. Gegenüber einem Schriftsteller ist sogar ein schwerer Vorwurf, was in der gesellschaftlichen Unterhaltung nur eine Art von Geringschätzung ausdrückt. Das war nicht immer so.
Die Geschichte des Begriffs Gemeinplatz spiegelt im kleinen die Besonderheit der abendländischen Kulturentwicklung seit der Spätantike wieder. Sie zeigt ferner, daß die Angst vor dem Gemeinplatz erst in einer Zeit auftauchen konnte, die dem individuell Gesagten, das nicht unbedingt bedeutend zu sein brauchte, dem Inhalt den Vorzug vor der Form gab. Die wechselnde Beurteilung des Gemeinplatzes ist ein nicht uninteressanter Beitrag zu der sich so oft wiederholenden Um- und Abwertung gewisser Worte, die jeweils mit Änderungen im Aufbau der Gesellschaft konform gehen.
Der Gemeinplatz war ursprünglich ein Element des gesprochenen, dann auch des geschriebenen Stils, als an diesen andere, zum Teil höhere Anforderungen gestellt wurden als heute. In der antiken Rhetorik, die nicht allein eine Anleitung zur Redekunst, sondern eine allgemeine Stilkunde war, bildete der sogenannte Gemeinplatz ein beliebtes literarisches und stilistisches Mittel. Er hatte seinen festen Platz im Bildungssystem der artes liberales, die bereits Seneca als die des freien (und natürlich besitzenden) Mannes würdigen Wissenschaften definiert und die um 400 Martianus Capeila in der für das Mittelalter verbindlichen Gestalt formuliert hatte. Die artes wirkten übrigens auch auf das Bildungssystem der Neuzeit ein, noch Leibniz trug sich mit dem Plane einer Übersetzung des Martianus Capeila für den Gebrauch des französischen Thronfolgers, des Dauphin. Wenn heute von unseren Gymnasiasten für den deutschen Aufsatz eine Disposition mit Einleitung, Überleitung, Hauptteil und Schluß verlangt wird, ist das ein letzter Rest spätantiker Rhetorik.
Zu dieser gehörten als feststehender Teil die Topen. Darunter wurden gedankliche Bildungen, variable Wendungen verstanden. Ein beliebter, häufig verwendeter Topos war zum Beispiel der Ausdruck der eigenen Unzulänglichkeit gegenüber dem Stoffe. Solche Bescheidenheitsformeln als Bestandteile der antiken Rhetorik begegnen uns im Mittelalter in der Welt des Klerus, wo ein neugewählter Abt oder Bischof sich des neuen Amtes „unwürdig“ zu fühlen hatte. Derartige Beteuerungen wollen nicht ernst genommen sein, selbst wenn sie es gelegentlich waren, sie entsprachen einer gesellschaftlichen und zugleich literarischen Konvention. Unsere Phrase „meine Wenigkeit“ hat gleichfalls ihren antiken Vorfahren in der „parvitas mea“ des Valerius Maximus in seiner Widmung an Tiberius.
Die aus der Spätantike über das Mittelalter der Neuzeit zugeleiteten Topen erklären sich aus einem starken Bedürfnis nach Stilisierung. Die Rhetorik als Stillehre half durch gedanklich festgelegte Topen dem angehenden Rhetor-Redner, allgemein gesagt dem Stilisten. Die griechische Rhetorik, die als Kunst der schönen Rede nach den Perserkriegen in Attika ausgebildet wurde, kannte koinoi topoi, die lateinische übersetzte loci com-munes. Noch im Deutsch des 18. Jahrhunderts hießen die loci communes in wörtlicher Übertragung „Gemeinörter“. Unter dem Einfluß der den literarischen, durch Regeln ungehemmten Individualismus verkündenden englischen Literatur übernahm die deutsche Sprache gegen Ende des 18. Jahrhunderts aus dem englischen common place = Gemeinplatz.
Wohl erst seit damals hat das Wort seine üble Bedeutung, als in der neuen literarischen Mode der lateinisch-romanische Stilbegrift, wie ihn die französische Literatur vertrat, zurückgedrängt wurde zugunsten eines Regeln und Grenzen verneinenden Ausdruckswillens.
In seiner anfänglichen Bedeutung war also der locus communis, der „Gemeinort“, ein Bestandteil der schulmäßig erlernbaren Stilistik, die der litteratus, der Gebildete, ebenso zu beherrschen hatte wie der Schriftsteller. Das er-sdieint in der Zeit vom 4. bis zum 18. Jahrhundert um so bedeutungsvoller, da die europäische Bildung einen ausgesprochenen Zug zum Literarischen und zur lateinischen Tradition hatte. Als Bildungsfaktor mußten die bildenden Künste, die artes mechanicae, wie die Alten sagten, hinter den artes liberales zurücktreten. Erst die bildenden Künstler der italienischen Frührenaissance erkämpften sich die Gleichberechtigung mit den Literaten.
Die antike und in ihrem Gefolge die mittelalterliche Rhetorik boten auch fertige Muster für Reden und Dichtungen zu allen möglichen Anlässen, wie Tod, Geburt, Hochzeit oder sonstige Feste, und gaben Beispiele für alle Arien von Briefen. Zur Totenrede gehörte es, auf die Notwendigkeit des Sterbens hinzuweisen, das niemandem, auch nicht den Helden der Mythologie, erspart geblieben sei, oder Sentenzen zu zitieren („wen die Götter lieben, lassen sie jung sterben“) usw. Überbleibsel der antiken Topik der Totenrede mit ihren loci communes, ihren „Gemeinplätzen, finden sich noch in unseren Beileidsschreiben. Hier liegt eine ungebrochene Entwicklungslinie von der Spätantike bis' zur Gegenwart vor.
Noch im 17. und frühen 18. Jahrhundert nahm man an den für unseren Geschmack konventionellen, durdi die Rhetorik vermittelten Wendungen und Anspielungen, den „Gemeinplätzen“, keinen Anstoß, im Gegenteil, sie gehörten zum guten Ton. Die zu ihrer Zeit berühmten Grabreden Bossuets verdankten ihre Beliebtheit am Hofe Ludwigs XIV. nicht zuletzt den an die literarische Tradition gebundenen Phrasen, den Gemeinplätzen.
Das Mittelalter hatte in den artes dictandi (Stillehren) seinen Behelf für den Unterricht in der Stilkunde gehabt. Beispiele und Zitate waren für den Gebrauch bereitgestellt. Die entarteten Nachfahren dieser mittelalterlichen artes dictandi sind die Briefsteller des 19. Jahrhunderts. In ihnen suchte der Halb- oder Ungebildete die Modelle für den ihm versagten Ausdruck. Die als „schön“ empfundene fremde, unpersönliche Form wurde zum Extrem und dadurch zur Karikatur, weil die inhaltliche Entsprechung zur gewählten Form fehlte. Der gesuchte „gute“ Stil war nun nicht mehr Privileg von Gebildeten und Besitzenden, sondern wurde allgemein begehrt. Interessanterweise trat dieser Prozeß der Umsetzung der alten Stilkunst in literarische Scheidemünze ein, als Adel und Großbürgertum, die bisher führenden weltlichen Kulturträger, sich von dem Ideal der rhetorischen, formgebundenen Bildung langsam zu lösen begannen. Die alte Gesellschaft der „Gebildeten“, die in ihrem äußeren Leben selbst mannigfachen konventionellen Bindungen unterworfen war, brauchte zu ihrer genußreichen literarischen Selbst-bespiegelung die Regel und die Konvention. Die Formgebundenheit der gesellschaftlichen Ordnung wiederholte sich in der Formgebundenheit der rhetorisch ausgerichteten Literatur.
Deren Ziel war die Erziehung eines harmonisierten, gerundeten Idealtyps, der allein schon durch seine Bildung die notwendige ethische Haltung gewinnen sollte. Die Neigung zum ungestörten Genuß der Kulturgüter in reiner, durch keine äußeren Notwendigkeiten getrübter Kontemplation sprach schon Quintiii an im 1. Jahrhundert mit den Worten aus: „Der Genuß der Literatur ist erst dann ganz rein, wenn sie, von jeder Tätigkeit gelöst, sich der Kontemplation ihrer selbst erfreuen darf.“ Platen äußerte in poetischer Form einen ähnlichen Gedanken in seinem Gedicht „Tristan“: „Wer die Schönheit angeschaut mit Augen... wird zu keinem Dienst auf Erden taugen.“
Diese Haltung wurde mit der Umwandlung der Gesellschaft durch die Industrialisierung seit dem späteren 18. Jahrhundert unmöglich. Neue Forderungen ergingen an den einzelnen, das Ethos des ruhigen Kulturgenusses wurde abgelöst durch ein neues, sachliches Arbeitsethos. Die seit dem 18. Jahrhundert einsetzende Umwandlung der Gesellschaftsordnung, die von einer weitgehenden Geschmacksänderung begleitet war, ist vielleicht die stärkste in der bisherigen Geschichte des Abendlandes gewesen. Die alte Gesellschaft hatte seit der Antike an den Zauber der schön geformten, erlernbaren Regeln unterworfenen Sprache geglaubt und dafür manchen konventionellen Zug, auch den „Gemeinplatz“, angenommen oder ihn sogar gewünscht. Die Regeln der Rhetorik, zu denen auch der Gemeinplatz im alten Sinne zu zählen ist, waren möglich, solange Bildung als genußreich empfundene Erfüllung des Daseins angesehen wurde, das Ordnungsdenken der Gesellschaft auf das Schrifttum übertragen wurde. Der neuen Gesellschaft seit dem 19. Jahrhundert war der Inhalt wichtiger als die Form. Reine Formalisten bilden in der Literatur eine Ausnahme.
Der Gemeinplatz, der locus communis als Stilmittel, ist heute überlebt, entwertet. An seine Stelle ist der inhaltliche Gemeinplatz getreten, der als Schlagwort durch Politik, Kino und Radio vermittelten Formel vielleicht noch weniger geistige Bewegungsfreiheit und Variationsmöglichkeit läßt als der seinerzeitige Gemeinort (locus communis) dem in den Regeln der Rhetorik gebildeten Stilisten.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!