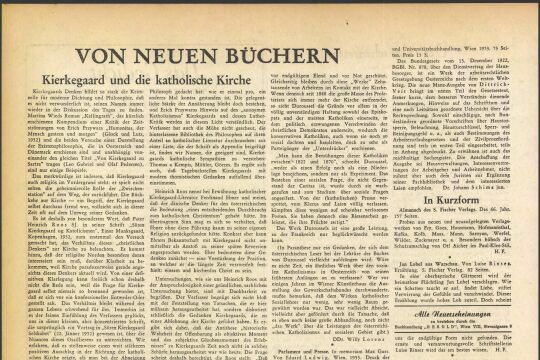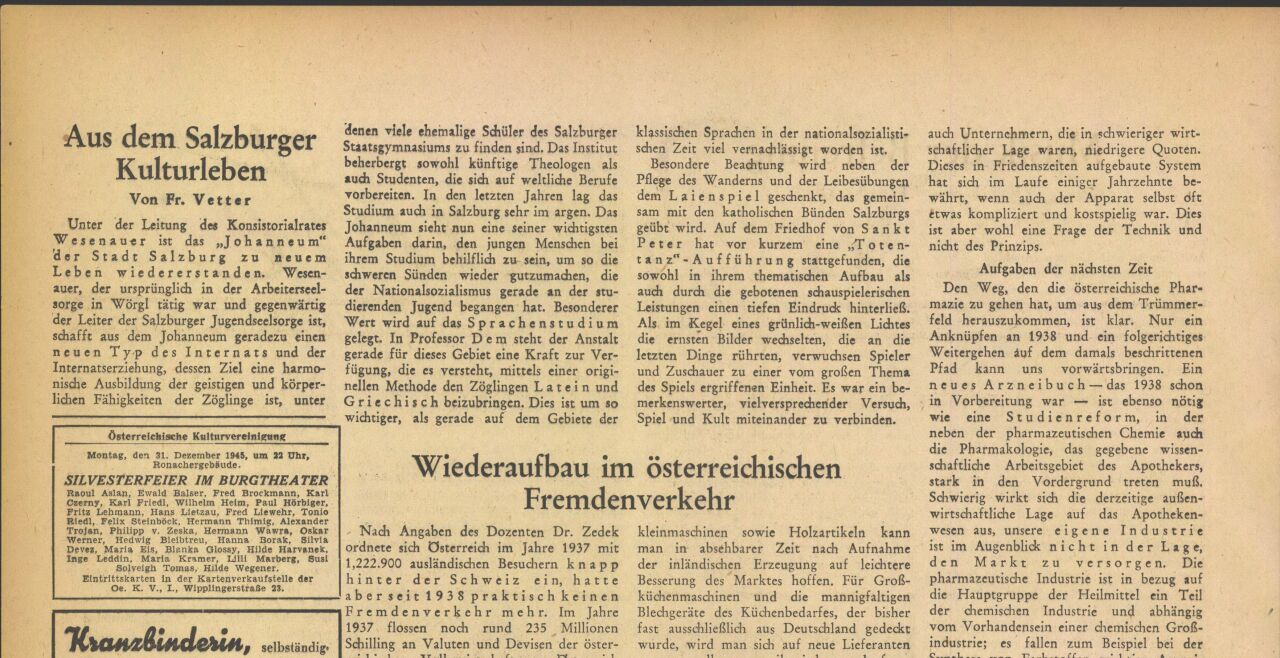
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die Zukunft unseres Heilmittelwesens
Von einem Jahrzehnt fand in Wien eine internationale Tagung der angestellten Apotheker statt, zu der Delegierte fast aller Kulturvölker erschienen. In ihren Referaten nahmen die Vertreter der verschiedenen Staaten zu den Problemen der Apotheken in wissensdiaftlicher, sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht Stellung. Sie lernten bei uns die österreichische Pharmazie kennen und schrieben mit Worten hoher Anerkennung über den hohen sozialen und wissenschaftlichen Stand unseres Apothekerwesens. Einer der ausländischen Teilnehmer faßte seine Eindrücke über die österreichische Pharmazie in dem Satz zusammen: „Austria docet“, „Österreich lehrt.“
Das kleine Österreich, Mittler und Schöpfer von Wissen und Kultur, zeigte der Welt, wie man es machen soll. Das haben damals die Fremden anerkannt. Und wenn wir heute darangehen müssen, nach einem der größten Zusammenbrüche der Geschichte die Bausteine der geistigen Macht wieder zusammenzusetzen, der unsere Heimat ihr Ansehen in der ganzen Welt verdankt, ist dies Grund genug, sich auch mit den Ursachen zu befassen, die der hohe Stand unserer Pharmazie hatte.
Das österreichische Arzneimittelgesetz sah im wesentlichen vor, daß nur durch das Volksgesundheitsamt registriete Fertigpräparate in den Handel kommen durften, die ihre Registernummer erst nach Feststellung der medizinischen Zweckmäßigkeit, Preiswürdigkeit und Neuheit des Mittels bekamen. Außerdem wurden von Hersteller und Betrieb die notwendigen wissenschaftlichen und hygienischen Voraussetzungen zur Fabrikation gefordert. Ein derartiges Gesetz fehlte im Deutschen Reich. Wie wertvoll es aber war, zeigt die Tatsache, daß an den seinerzeitigen verdienten Referenten Sektionsrat Dr. Zeckert ausländische Industrielle mit der Bitte herantraten, aus Propagandagründen ihren Fabrikaten österreichische Registernummrn zu geben, wenn auch mit der Einschränkung, daß in Österreich selbst das Mittel nicht gehandelt werden dürfte. —
verlangte die zur Führung einer Apotheke notwendigen wissenschaftlichen und moralischen Voraussetzungen und schützte so die Interessen der Kranken wesentlich besser, als wenn die Arzneimittelversorgung durch Beamte irgendeines Verteilungsapparates, etwa der Krankenkassen, wäre vorgenommen worden. In den letzten Monaten ist nun bei uns das Problem der Konzessionen in Fachkreisen heftig erörtert worden, besonders deshalb, weil über das Schicksal der arisierten Apotheken noch keine Entscheidung getroffen worden ist. Doch der Weg ist klar: Rückgabe der Betriebe an ihre früheren Eigentümer, bezw. deren Erben, soweit sie die gesetzlichen Voraussetzungen für die Führung einer Apotheke mitbringen und der ursprüngliche Betrieb nicht durch die Kriegsereignisse zerstört wurde und faktisch heute unter dem alten Namen eine neue Apotheke besteht. In diesem Falle sollte eine Barentschädigung aus den Mitteln eines Kriegsschädenfonds gezahlt werden. Wenn eine Rückgabe nicht in Frage kommt, da dem früheren Besitzer oder seinen Erben die Voraussetzungen zur persönlichen Führung fehlen, müßte sie zum amtlichen Schätzpreis zugunsten des Anspruchsberechtigten verkauft werden, wobei aus Gründen der Sauberkeit ein Verkaut an die derzeitigen öffentlichen Verwalter in keiner Form stattfinden dürfte.
Der dritte Pfeiler, auf dem schließlich Österreichs Pharmazie ruht, ist die vorbildliche soziale Gesinnung, die Tat geworden ist. Der angestellte Apotheker wird zum Beispiel nach seinen Dienstjahren durch die pharmazeutischen Standesanstalten bezahlt, an welche die Apothekenbesitzer eine stets gleichbleibende Quote einzahlen. Die Standesanstalten zahlten Nichtbeschäftigten Gehälter weiter und verrechneten auch Unternehmern, die in schwieriger wirtschaftlicher Lage waren, niedrigere Quoten. Dieses in Friedenszeiten aufgebaute System hat sich im Laufe einiger Jahrzehnte bewährt, wenn auch der Apparat selbst oft etwas kompliziert und kostspielig war. Dies ist aber wohl eine Frage der Technik und nicht des Prinzips.
Aufgaben der nächsten Zeit Den Weg, den die österreichische Pharmazie zu gehen hat, um aus dem Trümmerfeld herauszukommen, ist klar. Nur ein Anknüpfen an 1938 und ein folgerichtiges Weitergehen auf dem damals beschrittenen Pfad kann uns vorwärtsbringen. Ein neues Arzneibuch — das 1938 schon in Vorbereitung war — ist ebenso nötig wie eine Studienreform, in der neben der pharmazeutischen Chemie auch die Pharmakologie, das gegebene wissenschaftliche Arbeitsgebiet des Apothekers, stark in den Vordergrund treten muß. Schwierig wirkt sich die derzeitige außenwirtschaftliche Lage auf das Apothekenwesen aus, unsere eigene Industrie ist im Augenblick nicht in der Lage, den Markt zu versorgen. Die pharmazeutische Industrie ist in bezug auf die Hauptgruppe der Heilmittel ein Teil der chemischen Industrie und abhängig vom Vorhandensein einer chemischen Großindustrie; es fallen zum Beispiel bei der Synthese von Farbstoffen wichtige Arzneimittel oder deren Vorstufen zur Herstellung an. Daß die Kleinheit des Inlandsmarktes die Entstehung einer solchen Industrie nicht ausschließt, zeigt die Schweiz, die über außerordentlich moderne und leistungsfähige Unternehmen verfügt und nach dem Ausfall der deutschen Lieferungen wohl unser hauptsächlicher Lieferant werden wird, zumindest bis zu dem Tag, wo wir uns selbst werden versorgen können. Ansätze dazu sind zweifellos da. Die Firmen Kwizda, Fux, Kubiak, um nur einige zu nennen, arbeiten schon wieder und es ist zu erwarten, daß nach Sicherung der notwendigen Rohstoffe und Halbfabrikate auch der heute bestehende schwere Arzneimittelmangel — dem man auch durch staatliche Bewirtschaftung nidit recht beikommen kann — zum größten Teil aus eigener Kraft wird behoben werden können.
Es sollen die ausländischen Delegierten, wenn es einmal wieder zu einem internationalen Kongreß in Österreich kommt, feststellen können, daß wir auf unserem guten Wege weitergeschritten sind, und es wie vor 1938 heißt: Austria docet!
Zu den führenden österreichischen Organen, die durch ihr Niveau über die Grenzen unseres Landes hinaus den Ruf der österreichischen Publizistik vor 1938 begründeten, gehörte der „österreichische Volkswirt“. Seine letzte Herausgeberin, Frau Maria L. Klausberge r, war eine unentwegte Warnerin vor der Gefahr des Nationalsozialismus, und das Reichspropagandaministerium wußte sehr wohl, warum es noch 1938, bald nach der Annexion Österreichs, den „Volkswirt“ einstellen ließ.
Nun ist auch dieses Blatt wiedererstanden. Die Herausgeberin, die, wie es im Vorwort des soeben erschienenen Dezember-Sonderheftes gesagt wird, keine Stunde den Glauben aufgegeben habe, daß nach dem Ende des „Dritten Reiches“ der „Volkswirt“ wieder erscheinen wird, hat diese Stunde nicht mehr erleben dürfen. An ihrer Stelle gibt nunmehr ihre Adoptivtochter Dr. Margarethe Klausbcrger-Fuchs die Zeitschrift heraus.
Die Namen der ständigen Mitarbeiter bürgen für die Leistung des Blattes auch in seiner neuen Phase. Dr. Peter Kraulands „Preislenkung im Wirtschaftsaufbau“ und Dr. Waldemar Swobodas „Aufsatz über die Neuordnung unseres Geldwesens“ führen in die aktuellsten Finanzprobleme unseres Staatswesen ein Der brennenden Frage der Ernährung ist Rolf Grünwalds Beitrag gewidmet, der zusammenfassend die Feststellung bringt, daß im Oktober 1945 — und dies dürfte auch heute, an der Jahreswende, nicht viel anders sein — der Verbrauch eines Großteils der Wiener Bevölkerung noch um rund 54 Prozent niedriger als in der Vorkriegszeit gewesen ist.
Dem „Volkswirt“ kommt im neuen Österreich eine bedeutende Aufgabe zu: auf dem Gebiete der Volkswirtsdiaft zu klarem, illusionslosem Denken der Öffentlichkeit mitzuwirken.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!