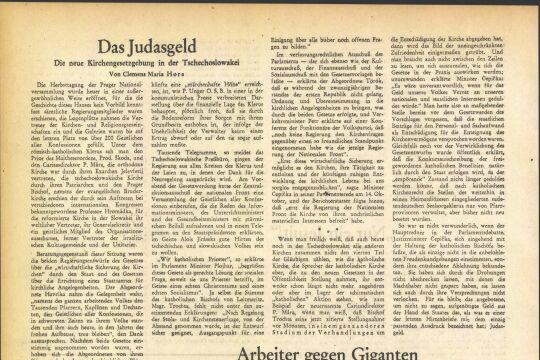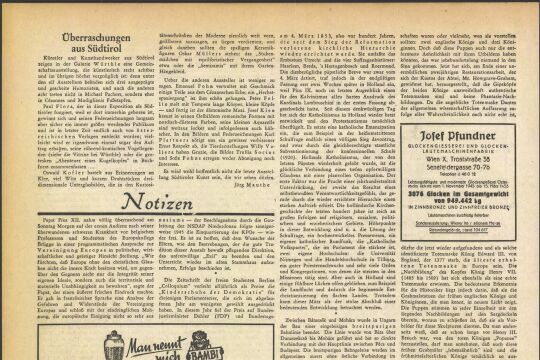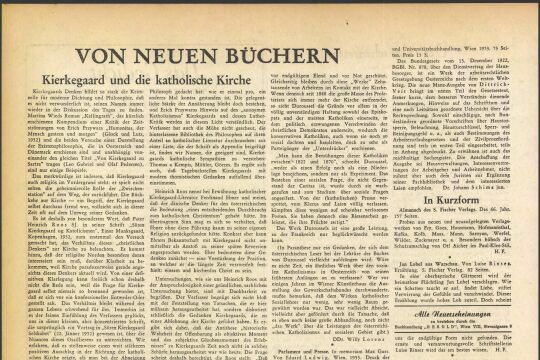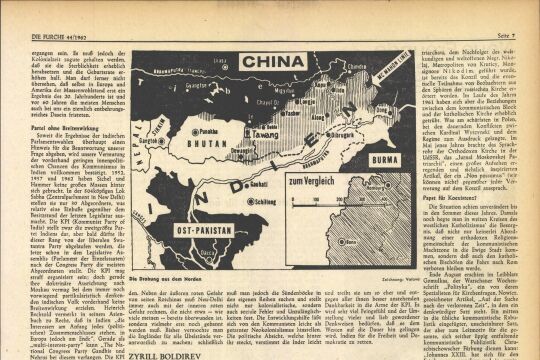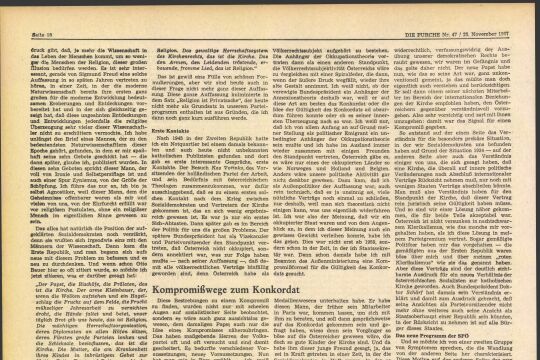Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Randhemerkungen zur woche
Die Nachrichten des polnischen Pressedienstes, daß der polnische Episkopat ein „Konkordat“ mit dem Staate eingegangen sei und allerlei Details, die sich um diese Meldung rankten, so, daß der Abschluß ohne Teilnahme des Kardinals Fürsterzbischof Sapieha und gegen dessen Willen erfolgt sei, haben ein wirres und korrekturbedürftiges Bild des wirklichen Vorganges ergeben. Die Tatsachen, die jetzt über Rom feststellbar sind, konkretisieren sich in folgendem: Ein „Konkordat“ ist nicht abgeschlossen worden, wohl aber ein Abkommen, das für wichtige Teilgebiete eine Regelung herstellt und jedenfalls das erste vertragliche Abkommen weitreichender Art darstellt, das in einem kommu' nistischen Staate zustande gekommen ist. In der hierüber erfolgten gemeinsamen Erklärung des polnischen Episkopats vom 22. April heißt es wörtlich: „Am 14. April haben drei Bischöfe im Namen des ganzen polnischen Episkopats ein Dokument unterzeichnet, das einige Probleme des Lebens und der Tätigkeit der katholischen Kirche im wiedererstandenen polnischen Staat regelt. Die katholische Kirche, durch jahrhundertealte Bande des Zusammenlebens, der moralischen und religiösen Arbeit, der historischen und kulturellen Verdienste dem Leben der Nation und des Staates verbunden, wird nie darauf verzichten, das Schicksal des Volkes zu teilen. Der Versuch einer Trennung von Kirche und Staat wäre für beide Teile ein großer Schaden. Schon seit langer Zeit fanden Besprechungen zur Beseitigung der entstandenen Schwierigkeiten statt. Um die Mitte des vergangenen Jahres entsandte der polnische Episkopat drei Vertreter in eine sogenannte gemischte Kommission, die aus Mitgliedern der Regierung und des Bischofskollegiums besteht, und die Aufgabe hat, alle gemeinsamen Fragen zu beraten. Die Arbeiten der Kommission waren infolge der zahlreichen Schwierigkeiten, die durch die Verschiedenartigkeiten der Ansichten entstanden, nicht leicht. Die Anforderungen des gegenwärtigen Lebens führten jedoch dazu, daß wenigstens die wichtigsten Fragen geregelt werden konnten. Wenn nicht alle Probleme eine Lösung fanden, war das teilweise auch dadurch bedingt, daß es sich nicht um ein Konkordat handelt. Viele der offengebliebenen Fragen fallen ausscliließlich in die Kompetenz des Hl. Stuhles. Die getroffenen Vereinbarungen sind in drei Dokumenten enthalten.“ Als die toichtigsten Ergebnisse werden von den Bischöfen bezeichnet: „die Tatsache, daß der Staat den Religionsunterricht in den öffentlichen Schulen, die religiösen Übungen der Jugend, die Rechte der noch verbliebenen katholischen Schulen und die Seelsorge im Heer, in den Krankenhäusern und in den Gefängnissen gewährleistet. Der katholischen Universität Lublin wurde die Weiterführung des Lehrbetriebes gestattet. Die Kirche hat das Recht, ihre eigene Caritasarbelt, den Katechismusunterricht und die Herausgabe von katholischen Zeltschriften und Büchern fortzusetzen. Die Theologiestudenten in den Seminarien erhalten die Erlaubnis, ihre Studien unbehindert fortzuführen. Ordenshäuser und kirchliche Anstnlten dürfen weiterhin frei arbeiten. Das Recht auf die notwendigen materiellen Mittel zum eigenen Unterhalt wird ihnen ausdrücklich zugesichert.
Eine Selbstverständlichkeit bildete“ — so fahren die Bischöfe fort — „die ausdrückliche Anerkennung, daß der Papst die höchste Autorität der Kirche in Fragen des Glaubens, der Moral und der kirchlichen Rechtsprechung verkörpert. Die Kirche stärkt ihrerseits unter Hinweis auf die Prinzipien der christlichen Sittenlehre bei den Gläubigen die Achtung vor Gesetz und Autorität und fordert alle auf, zäh für den Wiederaufbau des Landes zu arbeiten. Die Kirche ist einig mit dem ganzen Volk in der gemeinsamen Sorge um die Achtung unserer historischen Rechte auf das gesamte Vaterland.“
Die Erklärung trägt die Unterschriften aller polnischen Bischöfe. — Die in der Erklärung enthaltenen Mitteilungen klängen ja sehr gut. Im Vatikan legt man vor allem Wert auf die Feststellung, daß nach dem Wortlaut der Erklärung das Abkommen nicht den Charakter eines Konkordats, sondern einer einfachen Absprache über die wichtigsten aktuellen Probleme hat. Ob die praktische Durchführung der Einzelheiten des Abkommens den Erwartungen der polnischen Kirche entsprechen wird — sagt vorsichtig die vatikanische Meldung des CND— „begegnet begründeten Zweifeln“.
Der Fürsterzbischof von Salzburg, Doktor Rohrache r, richtete im Zusammenhang mit den Bestrebungen der ungarischen Volksdemokratie, ausgewiesene Ungardeutsche in ihre Heimat zurückzuholen, ein bemerkenswertes Schreiben an die alliierten Hochkommissare, in dem er um Aufklärung ersucht, ob die Bestimmungen des Potsdamer Vertrages, in denen die Aussiedlung der Volksdeutschen geregelt wurde, geändert würden oder ihre Gültigkeit beibehielten. Da auch die übrigen Südoststaaten bald ähnliche Rückführungsmaßnahmen ergreifen dürften, werden die Alliierten gebeten, Klärung in der rechtlichen und existentiellen Lage der Volksdeutschen in Osterreich zu schaffen, damit sich das Gefühl allgemeiner Unsicherheit nicht noch mehr steigere. — Wieder einmal ist es die Kirche, die sich zur Fürsprecherin und Sdiützerin der Heimatlosen macht. Wieder einmal ergibt sich ein Anlaß, die staatlichen Stellen in klaren Worten daran zu erinnern, daß das Problem der Volksdeutschen nicht weiterhin halb zu übersehen, halb mit ungenügenden Maßnahmen seine Lösung auf die lange Bank zu schieben ist. Die Satellitenstaaten beginnen allmählich einzusehen, welcher Arbeitskraft sie sich beraubt haben, als sie den deutschspreclt enden Teil ihrer Bürger ins Exil schickten. Sollen wir sie auch, erst verlieren müssen, ehe wir begreifen, welche wirtschaftliche, politische und menschliche Bedeutung den Heimatvertriebenen zukommt, die bei uns eine neue Heimat erstreben?
Verschiedene leidige Vorkommnisse an der Ennsbrücke hat der russische Hochkommissar General Swiridow abgestellt und in einem Schreiben an die Bundesregierung vorbeugende Maßnahmen für die Zukunft angekündigt. Der Brief ist ein Beitrag zu einer wünschenswerten Korrektur pessimistischer Vorstellungen, wie sie mit wenig Vorbedacht verbreitet werden, und dazu sollte, als Beispiel, im Interesse einer sachlichen Lagebeurteilung, auch nicht unbeachtet bleiben, daß der Gemeindewahlakt in Niederösterreich sich störungslos und in voller Freiheit vollzogen hat.
•
Sprecher der Wiener Spitalsärzteschaft fanden harte Worte für die Zustände in der Wiener Gebietskrankenkasse. Mit größtem Kostenaufwand würde der Bau von Ambulatorien betrieben, in denen die Beamten „wie bei einem Kaufmann“ so rasch als möglich behandelt würden, in denen ein Arzt dreißig bis vierzig Patienten am Tage „abzufertigen“ hätte —• oberflächlich und ohne sich ihnen eingehend widmen zu können. Unerträglich sei ferner die demütigende, fast tägliche Bespitzelung der Arzte, — sogar schwerkranke Patienten würden in der Wohnung aufgesucht und über die Tätigkeit des Arztes inquiriert. An dieser Argumentation fällt besonders auf, daß sie sich nicht mit dem Hinweis auf materielle Mißstände begnügt, sondern unverhohlen deren geistige Voraussetzungen klarlegt: die Mechanisierung des Heilbetriebes in den Ambulatorien. Es ist dies nicht der erste warnende Protest von Ärzten gegen die Krankenkassen und nicht das erste Mal, daß die öffentliche Meinung ihm beipflichtet; alles wird einzuwenden sein, daß uns die Widerwärtigkeiten erspart bleiben, die in England dem Experiment der Ge-sundfhitsverstaatlichung folgten.
Von jungen Akademikern wurde der viel erörterte und zitierte Vorwurf, daß die öffentlichen Leistungen für kulturelle Zwecke Immer geringer werden und man ernstlich von Gefährdung wissenschaftlicher Arbeit reden kann, einer sehr nüchternen finanziellen Untersuchung unterzogen. Die dargelegten Zahlen bringen allerdings ohne Umrechnung auf die Kaufkraftindizes die Wandlung der Verhältnisse optisch nicht voll zum Ausdruck, aber sie sprechen doch noch deutlich genug. 1920 wurden für die österreichischen Hochschulen 36,6 Millionen entwertete Kronen, 1930 27,1 Millionen gute Schilling, 194S 39 Millionen Nachkriegs-schilling aufgewendet. Setzt man die Kaufkraft der 1920er Krone und des 1948er Schillings mit einem Zehntel des Schillings von 1930 an, so erhält man ein allgemeines Bild der Situation der Hochschulen nach den beiden Weltkriegen. Hält man sich aber vor Augen, daß die technischen Anforderungen der Forschung nach der langen Stillegung während des Kriegs 1948 unendlich viel größere waren als 1920, so erkennt man das Absinken auf einen erschreckenden Tiefpunkt nach dem zweiten Weltkrieg. Die Behauptung, daß lebenswichtigere Aufgaben den größeren Teil der Mittel erfordern, und für Wissenschaft und Forschung eben nicht mehr übrigbleibt, leuchtet jenen nicht ein, die auf Heilmittel gegen den Krebs, auf eine Steigerung des Bodenertrags oder auf eine Beseitigung des sozialen Elends warten, denn sie sind der Meinung, daß die geistigen und materiellen Mittel dazu die Wissenschaft miterstellen kann.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!