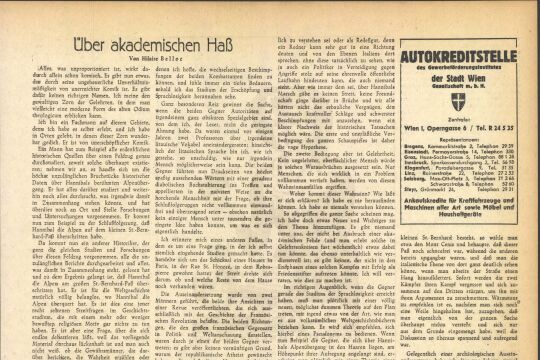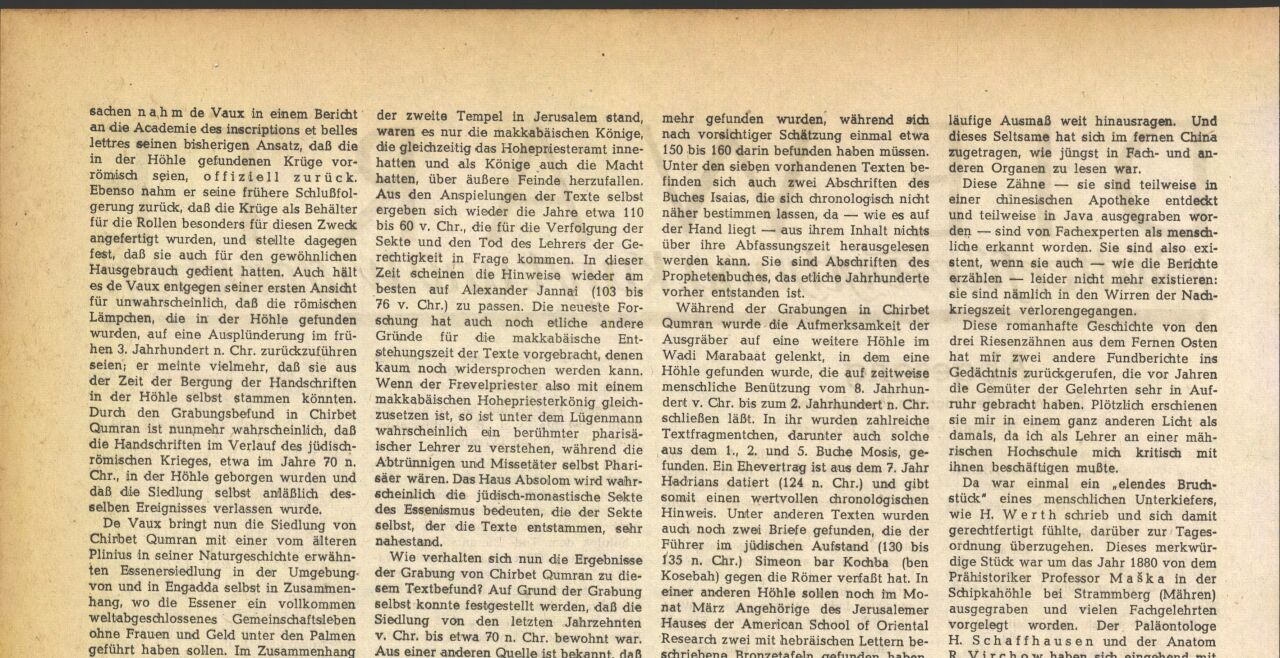
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Hai es Riesen leibhaftig gegeben?
Wenn der Mensch kraft seines Ingeniums — sagen wir: seines immerhin recht sparsamen Vemunftgebraudies — auch hoch aus der animalischen Welt herausgehoben wird, so binden ihn andererseits doch so viele gemeinsame Beziehungen an das organische Leben, wie Geburt, Ernährung, Entwicklung, Vermehrung und Tod, daß wir ihn aus der großen Gemeinschaft alles Lebendigen niemals ausschließen können.
Eine solche, allen Lebewesen gemeinsame Bindung ist eine gewisse Variationsbreite der Einzelindividuen einer und der gleichen Art. Niemals ist haargenau gleidi der Sohn dem Vater, die Tochter der Mutter. Und so gibt es neben schlanken und hageren dickere und rundliche, neben kleinwüchsigen auch sehr hochgewachsene, ja sogar Riesenformen.
Der Physiologe spricht von Variationen und Mutationen, wenn sich die physiologischen Verschiedenheiten auch bei der Nachkommenschaft bemerkbar machen.
Auch beim Menschen gibt es eine solche Variationsbreite im Größenmaß. Aber man muß feststellen, daß sie in der Gegenwart nicht sehr groß ist, ja — daß erheblichere Abweichungen nach der einen beziehungsweise nach der anderen Seite zu den Ausnahmen gehören. Die Schaubudenbesitzer leben ja zum Teil davon. Da sehen wir — wohl häufiger — eine zierliche Gesellschaft von Liliputanern, die erwachsen nicht einmal das Metermaß erreichen, aber hie und da auch einen tolpatschigen Riesen, der das Zweimetermaß weitaus übertrifft.
Recht auffällig ist, daß die Klein- wüchsigkeit, die uns auch sonst in gemäßigtem Ausmaß häufiger entgegentritt, ich auch stammesmäßig noch vererbt. In kleineren Bevölkerungsgruppen finden wir die Zwergwüchsdgkeit gewissermaßen endemisch. Wir nennen diese Kümmerformen, in der Kultur meist etwas primitiv eingestellter Völkchen: Pygmäen.
Merkwürdig ist, daß sich ein richtiges Analogon im Riesenwuchs unter den heutigen Menschenrassen nicht finden läßt.
Für Physiologen aber hat der Gedanke absolut nichts Befremdendes, daß dies im Laufe der Menschheitsgeschichte nicht immer so gewesen sein muß, denn das Menschengeschlecht hat ja immerhin chon einige hunderttausend Jahre hinter sich und Zeit genug gehabt, sich nach der Größenrichtung entsprechend auszutoben.
Da können wir an einer interessanten Tatsache nicht Vorbeigehen: Kein Stamm, kein Volk mit einer mythischen Überlieferung ist der Begriff riesenhafter Vorfahren, riesenhafter Heroen fremd. Da erzählt uns die jüdische Geschichte von dem Kampf zwischen dem Riesen Goliath und dem kleinen David, die griechische von Polyphem und Odysseus, die germanische von Fafnir und Fasold.
Ist das nicht merkwürdig?!
In der dunklen Vorgeschichte unserer Ahnen scheinen riesenhafte Zeitgenossen gar keine solche Rarität gewesen zu sein!
Wir haben uns zwar längst abgewohnt, all das, was unsere Sagen und Mythen erzählen, als bare Münze zu nehmen. Aber auch da empfiehlt die kluge Vorsicht, mit dem Bade nicht auch das Kind auszuschütten: viele Mythen gehen auf irgendeinen realen Kern zurück. Das hat sich schon so oft erwiesen, daß wir bei jedem Mythos uns auch die Frage vorlegen: Hat etwa ein historisches Ereignis den Anlaß zur Entstehung dieser mythischen Überlieferung gegeben?
Nun — an dergleichen Fällen ist unsere einheimische Sagenwelt durchaus nicht arm; zum Beispiel: es werden bei der Gründung eines Bauwerkes übergroße Extremitätenknochen gefunden und in ihnen die Knochen eines Riesen vermutet (vergi. Mammutknochen vom „Riesen -Tor des Stephansdoms); es wird ein ungeschlachter, fremdartiger Schädel ausgegraben und einem riesigen Lindwurm zugeschrieben (vergi. Rhinozerosschädelfund als Grundlage der Lindwurmsage in Klagenfurt), oder: es werden riesige Bärenschädel und -knochen in einer Höhle entdeckt und für Reste von Drachen gehalten („Drachenhöhle“ bei Mixnitz in Steiermark) usw.
Aber die heutige Zeit ist der Sagen- und Mythenbildung — wenn man so von den kleineren Entgleisungen der öffentlichen Berichterstattung absieht — sehr abträglich. Da bemächtigt sich die Skepsis der kritischen Forschung jedes merkwürdigen Fundes und weist die gerne zum Phantastischen geneigte Volkspsyche in ihre Schranken.
Um so mehr müssen wir aufhorchen, wenn ernste Fachleute von menschlichen Zähnen berichten, die über das uns geläufige Ausmaß weit hinausragen. Und dieses Seltsame hat sich im fernen China zugetragen, wie jüngst in Fach- und anderen Organen zu lesen war.
Diese Zähne — sie sind teilweise in einer chinesischen Apotheke entdeckt und teilweise in Java ausgegraben worden — sind von Fachexperten als menschliche erkannt worden. Sie sind also existent, wenn sie auch — wie die Berichte erzählen — leider nicht mehr existieren: sie sind nämlich in den Wirren der Nachkriegszeit verlorengegangen.
Diese romanhafte Geschichte von den drei Riesenzähnen aus dem Fernen Osten hat mir zwei andere Fundberichte ins Gedächtnis zurückgerufen, die vor Jahren die Gemüter der Gelehrten sehr in Aufruhr gebracht haben. Plötzlich erschienen sie mir in einem ganz anderen Licht als damals, da ich als Lehrer an einer mährischen Hochschule mich kritisch mit ihnen beschäftigen mußte.
Da war einmal ein „elendes Bruchstück’ eines menschlichen Unterkiefers, wie H. Werth schrieb und sich damit gerechtfertigt fühlte, darüber zur Tagesordnung überzugehen. Dieses merkwürdige Stück war um das Jahr 1880 von dem Prähistoriker Professor M a š k a in der Schipkahöhle bei Strammberg (Mähren) ausgegraben und vielen Fachgelehrten vorgelegt worden. Der Paläontologe H. Schaffhausen und der Anatom R. Virchow haben sich eingehend mit dem Fundobjekt beschäftigt, denn das Stück würde seiner Größe nach durchaus einem erwachsenen Menschen zugehören können, zeigt aber mit drei noch nicht durchgebrochenen Zähnen (ein Eckzahn und zwei rechte Schneidezähne), daß der Besitzer sich erst im Stadium des’ Zahnwechsels befand. Es ist ein unzweifelhaft kindlicher Unterkiefer, zugehörig einem acht- bis neunjährigen Individuum, sagen Maška, Wankel und Schaffhausen. Es ist eine Verzögerung des Zahnwechsels, eine pathologische Mißbildung, sagt R. Virchow. Merkwürdig: Der einzige menschliche Skelettrest, der in der Schipkahöhle gefunden wurde, sollte gerade von einem abnormalen, verbildeten Menschen stammen?!
Mehr als ein halbes Jahrhundert war dahingegangen und über den Fund des Schipkakiefers in Mähren war reichlich Gras gewachsen. Da wurde die wissenschaftliche Welt durch Professor K. Absolo n in Brünn neuerdings alarmiert: er hatte bei Ondratice an der gleichen alten Völkerstraße, die das Wiener Becken mit der Ostsee verbindet und die an dem Fundort des Schipkakiefers vorbeiläuft, merkwürdige Steingeräte gefunden: riesengroße Fäustel und Spalter, Schaber und Klingen aus Quarzit, für deren sinnvolle Handhabung die Kräfte unserer Rechten absolut unzureichend erscheinen. Dabei lehnen sich die Formen dieser Werkzeuge an bekannte Modetypen, wie sie zum Beispiel in einer bestimmten Periode der Altsteinzeit (der sogenannten Acheul-Stufe) gebräuchlich waren, durchaus an. Es gibt also in der Gegend von Ondratice in Mähren zu einem Gerät oft zwei Ausgaben: eine, mit der auch wir selbst noch spalten, schneiden oder schaben können, und eine andere, mit der wir nichts anzufangen vermögen, weil sie für unseren hündischen Gebrauch viel zu groß geraten ist.
Das ist also der Sachverhalt: Wir haben bei allen Völkern eine lebendige mythische Überlieferung über die Existenz riesenhafter Vorfahren. Wir haben da ferner einen menschlichen Unterkiefer, der seinem Größenausmaß nach einem Erwachsenen, seinem Entwicklungsstadium nach aber einem Kinde zugehören müßte. Und wir haben da endlich riesenhafte Steingeräte, die in der gleichen Landschaft wie der Unterkiefer gefunden wurden, derer wir uns aber nicht bedienen können, weil sie für eine weitaus größere und kräftigere Hand geschaffen sind.
Wie sollen wir uns in diesem Irrgarten von Widersprüchen zurechtfinden? Ich glaube, es bleibt nur edn einziger Ausweg: die Logik fordert für das doppelt so große Steinwerkzeug eine doppelt so große Hand und für die doppelt so große Hand einen vielleicht eineinhalb bis zweimal so großen Menschen; einen Faf- mir oder Fasold, einen Polyphem, der den Felszacken nach Odysseus warf, oder einen Goliath, der selbst von einem Wurfstein der kleineren Rasse zu Tode getroffen wurde. In der Tat — des Rätsels einzig mögliche Lösung ist: die riesenhaften Gestalten, von denen uns der Mythos berichtet, haben leibhaftig gelebt
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!