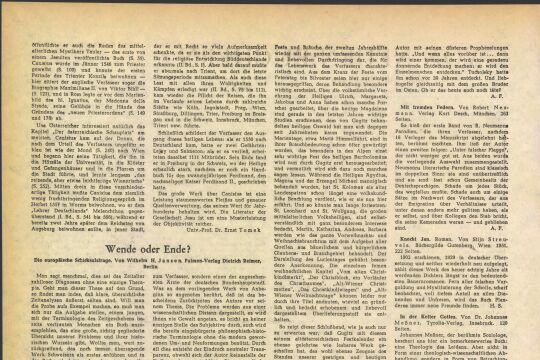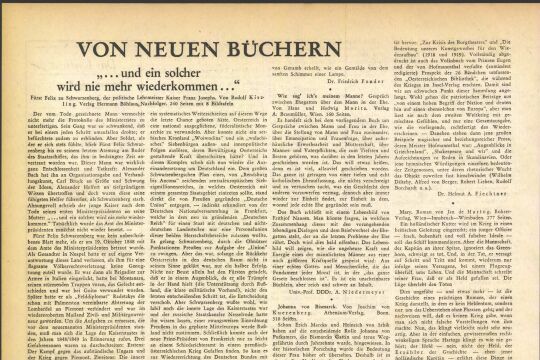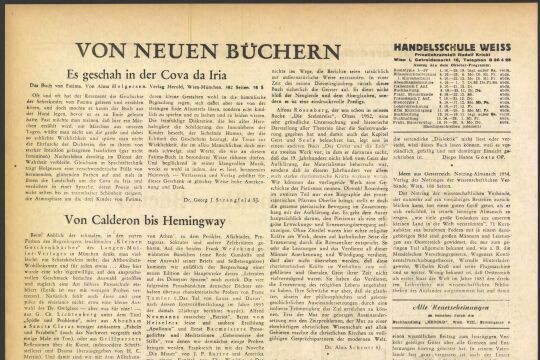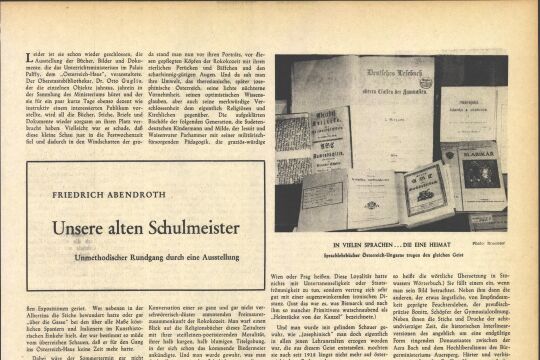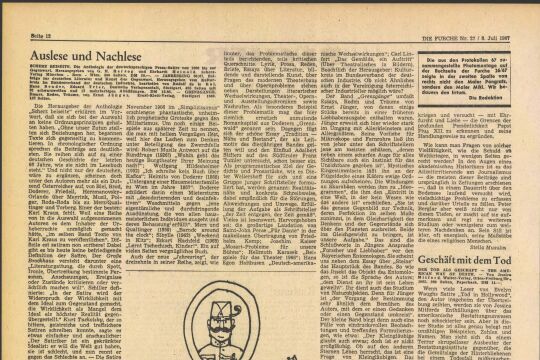Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Tucholskys Flirt
BRIEFE AN EINE KATHOLIKIN. Von Kurt Tucholsky. Rowohlt-Verlag, Reinbek bei Hamburg. 89 Seiten. DM 6.80.
Im Jahre 1929 publizierte Marierose Fuchs, eine Sozialmitarbeiterin Carl Sonnenscheins, in der Berliner Zeitschrift „Germania“ eine Rezension unter dem Titel „Journalistik im Buch“. Zu den zeitgenössischen Neuerscheinungen, die sie darin bespricht, gehörte auch „Das Lächeln der Mona Lisa“, eine Sammlung von Glossen, Chansons und Feuilletons von Kurt Tucholsky. Die Rezensentin rühmt Stil und Scharfblick, rügt die destruktiven Tendenzen und wirft dem Dichter einen „erschrek-kenden Mangel an Ehrfurcht vor fremder Überzeugung“ vor. „Er bespeit“, so formuliert sie in christlichem Eifer, „was Hunderttausenden heilige Wirklichkeit ist.“
Tucholsky antwortet auf die Vorwürfe in einem privaten Brief dessen höflicher, ja fast chavaleresker Ton in seltsamen Gegensatz zu der spitzen Feder des damals schon sehr populären Satirikers steht. Er verteidigt seine Position ohne ätzende Schärfe und kommt sogleich auf das Thema zu sprechen, welches die Rezensentin als „heilige Wirklichkeit“ umschrieben hatte, auf die katholische Kirche. Über den Hort des Glaubens will sich Tucholsky niemals lustig gemacht haben. Seine Kritik gilt der Kirche als politische Institution.
Dieses Thema trägt nun einen Briefwechsel, der drei Jahre dauert. Tucholsky spielt nebenbei ein wenig den Mentor der Katholikin, die sich unter seinem Einfluß um Verbesserungen ihrer literarischen Ambitionen bemüht. Nur eine einzige, kurze persönliche Begegnung in der Redaktion der „Weltbühne“ ergab sich. Dennoch werden die Anreden immer vertraulicher. Zwischen den Sätzen stehen kleine Komplimente. Menschliches, Allzumenschliches kommt zur Sprache. Tucholsky fragt seine katholische Brieffreundin für die Komödie „Christoph Colümbus“, an der er gerade arbeitet, um praktischen Rat, z. B. wie ein Theologieprofessor anzusprechen sei, der gleichzeitig Dominikaner ist.
„Es tut mir leid, daß ich Ihnen so wenig bei Ihrem sicherlich schweren Kampf um die Kirche helfen kann“, meint Tucholsky später wie ein mitsorgender Freund. „Lügen mag ich nicht, und in mir ist nichts drin, diesbezüglich. So gut wie nichts — und sicherlich nichts, was Sie gebrauchen können. Nur so viel: Überliefern Sie sich der Kirche ganz oder lassen Sie von ihr — ein Mittelding wird Sie nicht glücklich machen.“ Die Briefpartnerin scheint hier also allerhand gewagt zu haben. Dem Leser ist längst klar, daß die beiden Menschen, die trotz äußerlicher Erfüllung mit vielen Aufgaben innerlich etwas einsam waren, einander brauchten. Tucholsky allerdings wird in seinen Formulierungen spröder. Der kürzeste Brief, nur acht Zeilen lang, ist der letzte; zumindest der letzte, der publiziert wurde. Hatte Tucholsky nichts mehr zu sagen? Die Empfängerin berichtet in der Einleitung über das Schicksal der Briefe, die Gestapo-Hausdurchsuchung und Bombenangriffe überdauert hatten. Über die Ursachen des abrupten Endes berichtet sie nicht.
„Heute kann ich kaum noch verstehen, was mich an Tucholskys Arbeiten damals schockierte“, gesteht Marierose Fuchs über über ihre Rezension in der „Germania“. Anno 1970 sind die Briefe nicht nur Dokumente der Literatur- und Zeitgeschichte, Beweise katholischer Naivität in der Auseinandersetzung mit einem Freigeist, vielleicht Beispiele für einen Dialog wie man sich ihn im Internat vorstellt, sondern auch lebenswürdiges Zeugnis, eines geistig produktiven Flirts. Diese Fähigkeit, die zum Leidwesen der Dichter heute zwischen Oswalt Kolle und Gruppensex ausstirbt, verdient ein Denkmal, zu dem noch mancher katholischer Baustein herbeigeschafft werden kann.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!