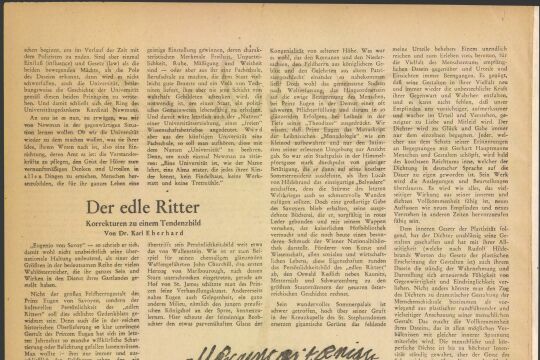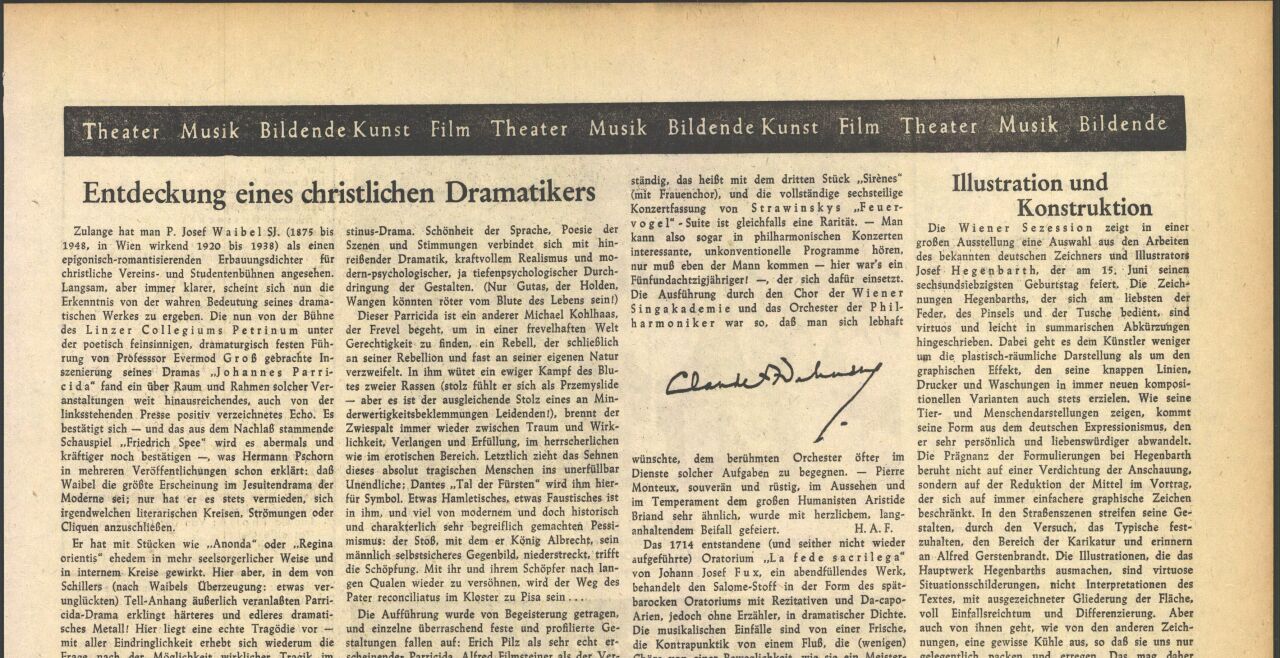
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Entdeckung eines christlichen Dramatikers
Zulange hat man P. Josef Waibel SJ. (1875 bis 1948, in Wien wirkend 1920 bis 1938) als einen epigonisch-romantisierenden Erbauungsdichter für christliche Vereins- und Studentenbühnen angesehen. Langsam, aber immer klarer, scheint sich nun die Erkenntnis von der wahren Bedeutung seines dramatischen Werkes zu ergeben. Die nun von der Bühne des Linzer Collegiums Petrinum unter der poetisch feinsinnigen, dramaturgisch festen Führung von Pröfesssor Evermod Groß gebrachte Inszenierung seines Dramas „Johannes Parri-c i d a“ fand ein über Raum und Rahmen solcher Veranstaltungen weit hinausreichendes, auch von der linksstehenden Presse positiv verzeichnetes Echo. Es bestätigt sich — und das aus dem Nachlaß stammende Schauspiel „Friedrich Spee“ wird es abermals und kräftiger noch bestätigen —, was Hermann Pschorn in mehreren Veröffentlichungen schon erklärt: daß Waibel die größte Erscheinung im Jesuitendrama der Moderne sei; nur hat er es stets vermieden, sich irgendwelchen literarischen Kreisen, Strömungen oder Cliquen anzuschließen.
Er hat mit Stücken wie „Anonda“ oder „Regina orientis“ ehedem in mehr seelsorgerlicher Weise und in internem Kreise gewirkt. Hier aber, in dem von Schillers (nach Waibels Überzeugung: etwas verunglückten) Teil-Anhang äußerlich veranlaßten Parri-cida-Drama erklingt härteres und edleres dramatisches Metall! Hier liegt eine echte Tragödie vor — mit aller Eindringlichkeit erhebt sich wiederum die Frage nach der Möglichkeit wirklicher Tragik im christlichen Drama 1 —, ein Geschichtsdrama, das bei aller gewissenhaft verfolgten historischen Treue und Objektivität zugleich Bekenntnis einer großen dichterischen Seele, eines suchenden philosophischen Geistes ist: nicht umsonst empfand der Dichter das Werk als eine Vorarbeit *u einem noch geplanten Augustinus-Drama. Schönheit der Sprache, Poesie der Szenen und Stimmungen verbindet sich mit hinreißender Dramatik, kraftvollem Realismus und modern-psychologischer, ja tiefenpsychologischer Durchdringung der Gestalten. (Nur Gutas, der Holden, Wangen könnten röter vom Blute des Lebens sein!)
Dieser Parricida ist ein anderer Michael Kohlhaas, der Frevel begeht, um in einer frevelhaften Welt Gerechtigkeit zu finden, ein Rebell, der schließlich an seiner Rebellion und fast an seiner eigenen Natur verzweifelt. In ihm wütet ein ewiger Kampf des Blutes zweier Rassen (stolz fühlt er sich als Przemyslide — aber es ist der ausgleichende Stolz eines an Minderwertigkeitsbeklemmungen Leidenden!), brennt der Zwiespalt immer wieder zwischen Traum und Wirklichkeit, Verlangen und Erfüllung, im herrscherlichen wie im erotischen Bereich. Letztlich zieht das Sehnen dieses absolut tragischen Menschen ins unerfüllbar Unendliche; Dantes „Tal der Fürsten“ wird ihm hierfür Symbol. Etwas Hamletisches, etwas Faustisches ist in ihm, und viel von modernem und doch historisch und charakterlich sehr begreiflich gemachten Pessimismus: der Stoß, mit dem er König Albrecht, sein männlich selbstsicheres Gegenbild, niederstreckt, trifft die Schöpfung. Mit ihr und ihrem Schöpfer nach langen Qualen wieder zu versöhnen, wird der Weg des Pater reconciliatus im Kloster zu Pisa sein____
Die Aufführung wurde von Begeisterung getragen, und einzelne überraschend feste und profilierte Gestaltungen fallen auf: Erich Pilz als sehr echt erscheinender Parricida. Alfred Eilmsteiner als der Verschwörer Balm, Franz Rehberger als König. Aber nicht darauf kommt es an, sondern darauf, daß man hier eines echten Dramas, eine's gebürtigen Dramatikers gewahr wurde. Mitunter tragen sich wesentliche Theaterereignisse außerhalb der offiziellen, großen Bühnen zu ...
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!