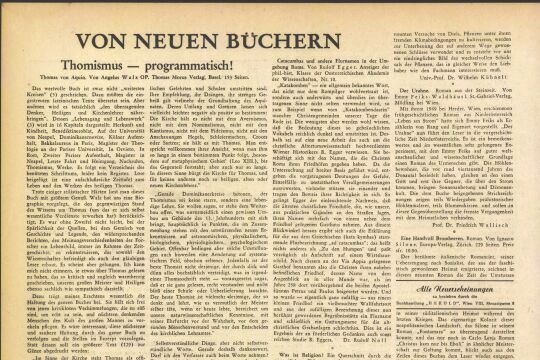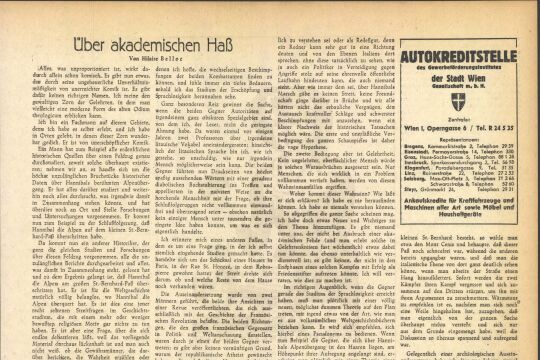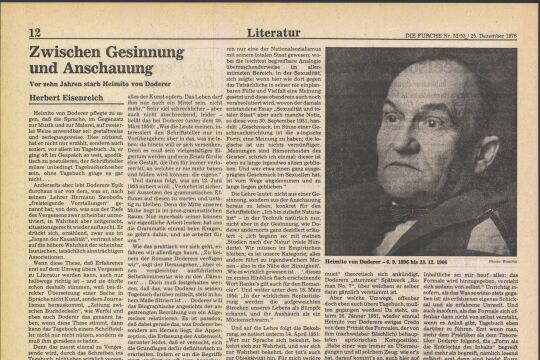Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Bemerkenswert unlesbar
Der namhafte Universitätsprofessor Höllerer, bisher auch experimentell praktizierender Lyriker, rekapituliert nun, wie vor ihm schon sein Fakultätskollege Walter Jens wiederholt, akademisch versiert zeitgenössische Experimentalprosa. (Rekapitulier bedeutet: wiederholen.). „Die Elephänteriuhr“ ist In vieljähriger Konstruktionsarbeit entstanden und in Fachkreisen schon lange vor ihrem Erscheinen zu einem Begriff geworden. Beispielsweise wird in dem gleichzeitig erschienenen autobiographischen Roman „Schöner Tag, dieser 13.“ (Barbara König) bereits eine rund zehn Jahre zurückliegende Szene erwähnt: Höllerer liest bei einer Tagung der Gruppe 47 aus der „Elephantenuhr“ vor.
„Es ist richtig, d. h. für eine andere Annahme gibt es keinen zureichenden Grund, seit diesem Sonntag bis zum „Sonntag-rneiner-Tat“ habe ich meinen Rhythmus beibehalten. Und ich lege Wert auf die Feststellung, daß man, im inneren Gehirn, mit den Rhythmen seiner Umgebung Schritt hält, selbst wenn man vorübergehend von diesen Rhythmen isoliert ist.“ So beginnt das Buch, und so geht es auch weiter, mehr als 500 Seiten hindurch, in 162 numerierten Abschnitten, konsequent und langwierig, von einem Sonntag bis zum nächsten, den Zeitraum von acht Tagen umspannend, selbstverständlich ohne Spannung. Der „Sonntag-meiner-Tat“ ist ein literaturwissenschaftlich präpariertes Spannungselement, das wie bei einer Vorlesung über die Theorie der Literatur an den passenden Stellen demonstriert wird. Mit echter Spannung hat es so entfernt zu tun wie der sauber präparierte Schädel in einem Anatomiekolleg mit einem lebenden genialen Kopf. Walter Höllerer bietet, wohlgeordnet, eine riesenhafte Knochensammlung, teils trivialer, teils exotischer Herkunft, ein ganzes literarisches Anatomiemuseum, aber niemals, keine halbe Seite lang, irgendeine Lebewelt.
Schon auf der ersten Seite das programmatische Bekenntnis: „Die Frage der Synchronisation beschäftigt mich, muß mich beschäftigen, während ich diesen Bericht schreibe. Die Frage, wie ich mit dem, was meinem Gehirn zugemutet wird, zurechtkomme.“ Wie der Leser mit solcher ephemeren Beispielsammlung zurechtkommt, das beschäftigt den in sein Fach vertieften Katheder-Star nicht. „Ich komme in Fahrt. Ich breite ihm mein Problem aus,
Semiologie, den Ärger mit dem Zeichen-Geben, die Schwierigkeiten,
— immerhin vor einer Figur mit schwieriger Existenz.“ Dabei halten wir erst auf Seite 2. Doch das ganze dicke Buch erweist sich als Kompendium, bis zu den letzten Sätzen auf S. 535: „Zu welchem Spruch auch immer Sie kommen mögen:' jetzt könnte ich mein Manuskript über G fertigstellen, und ich könnte den Entwurf einer Semiologie beginnen.
— Jedes Urteil akzeptiere ich.“ Das unsere wäre desperat und vom semiologischen Standpunkt aus vielleicht banal: Wozu habe ich die Krot geschluckt (freie Ubersetzung von: Cui bono), wenn nach der Viechsarbeit einer Lektüre dieses Dickleibers der „Entwurf einer Semiologie“ erst beginnen könnte? Verglichen mit der Lesung dieses unlesbaren Textes müßte auch die schwierigste Fachvorlesung ein Kinderspiel sein.
Jede Behauptung, es gäbe einen roten Faden, wäre Irreführung. Denn auch er ist immer, wo er zum Vorschein kommt, nur semiologisch gemeint. Gustav Lorch, Angestellter im Museum zu Murrbach, die Ich-Figur, wird niemals Figur, bleibt Denkmodell eines Denkenden. Das gilt erst recht für die Gegenfigur G, für welche der Verfasser nicht einmal einen Abkürzungspunkt erübrigt. Also nicht „G.“, sondern semiologisch typisiert „G“, eine algebraische Größe in dieser literarischen Gleichung, als Gegengewicht zu Lorch synchron nach Italien versetzt, das aber weder historisch, noch aktuell dargestellt wird. Menschen, Länder und Ereignisse ereignen sich in diesem Roman nur als Unsumme semiologischer Varianten. Kurzum, Herr Lorch bereitet für das Museum eine Ausstellung vor, „Schmecken, Sehen usw. im kollektiven Gehirn“ (das Buch ist der Roman dieser Ausstellung, beziehungsweise die Ausstellung eines Romans), und es könnte dem allmählich ungeduldig gewordenen geduldigen Leser auf Seite 514 vollauf begreiflich erscheinen, wenn dort zu lesen steht, daß das Kuratorium des Museums besagte Ausstellung abgesetzt hat. Es war den Verantwortlichen zuviel, und sie haben genug. Da ist es bereits der eingangs erwähnte „Sonntag-meiner-Tat“, und wenn Lorch am Ende das Museum durch Sprengung hochgehen läßt, so wie dieses seine Ausstellung, dann bleibt auch der pseudodramatische Schluß unsicher und unklar: Soll es sich endlich um eine reale
Wendung handeln oder wieder nur um eine der vielen rhetorischen, mimischen und sonstigen Wendungen, die zusammen den Gegenstand einer Semiologie ausmachen?
Selbstverständlich, wie in einem Nachschlagwerk von A bis Z auf Band, kommt in dieser semiologischen Enzyklopädie viel Bildungsgut von Hegel über Freud bis zu den Kybernetikern zur Sprache, auch eine Unmenge total ausgefallener Ausdrücke, Fachausdrücke und Namen werden semiologisch relevant gefunden und müßten erst im Nachschlagwerk gesucht und gefunden werden, es sei denn, daß man sich sowieso geschlagen gibt. Walter Höllerer weiß alles aufzuzählen. Ob er das unendlich aufgezählte Wissen auch weiß, das heißt: versteht, wird aus der Listenprosa nicht verständlich. Prunk, Bluff, Mikroanalyse des Makrokosmos, lebendige Kommunikation unter die stilistische Lupe genommen, in allen Größenordnungen mikroskopiert?
Es wäre eine ganz andere (wiewohl auch semiologische) Frage, ob man einen derartigen philologischen Laboratoriumsversuch philologisch, sprachkritisch rezensieren kann und darf. Walter Höllerer erzählt in der Regel — strenggenommen: regelwidrig — nicht in der Erzählform und bleibt, wie schon
aus dem zitierten Eingangssate hervorgeht, in einer schier endlosen Gegenwart. Springt er doch einmal in die Vergangenheit, dann springt er seltsam um mit ihr, etwa S. 31 f.: „____an diesem Montagnachmittag fragte mich der Leiter... warum ich in meinen Aufzeichnungen, von denen ich ihm einige zu lesen gab... fixiert sei.“ Von einer Gleichzeitigkeit kann aber hier nicht die Rede sein, denn jener Leiter konnte nur fragen, wenn man ihm die Aufzeichnungen schon früher zu lesen gegeben hatte. Oder ein anderes, auch semiologisch befremdendes Beispiel (S. 131): „Verdrängung der schleichenden Folgen einer ehemaligen infektiösen Gelbsucht“. Wenn bereits „Folgen“ eingetreten sind, ist es selbstverständlich, daß sie nur einer „ehemaligen“ Gelbsucht zugeordnet werden können. Das Attribut ist somit ein schlichter Pleonasmus. Freilich haben wir überhaupt keine epische Leistung vor uns; diese Kunstform wird fingiert. Und es fragt sich, ob simple grammatikalische Ausstellungen an einer semiologischen Ausstellung wie dieser überhaupt praktikabel sind.
Edwin Hartl DIE ELEPHANTENUHR. Von Walter H aller er. 535 Seiten. Suhrkamp-V erlag, Frankfurt am Main 1973.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!