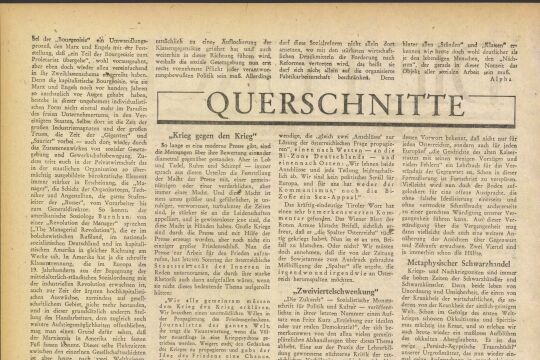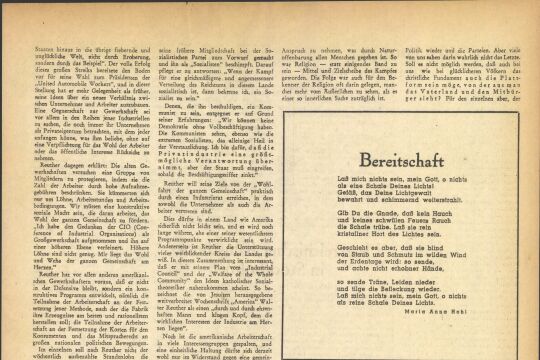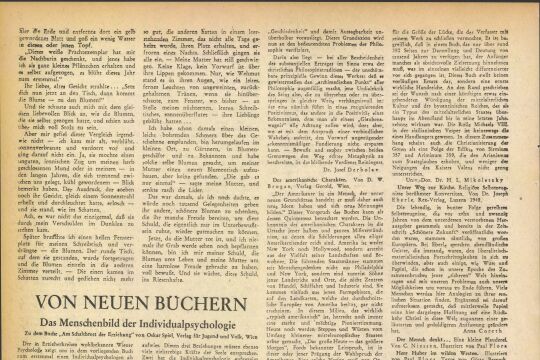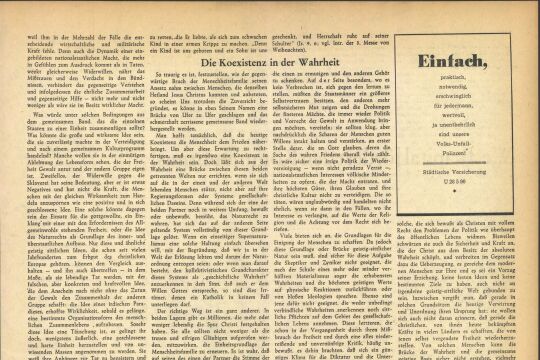Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Bergarbeiter im Sprach-Gestein
Das Leben ist, wie jedermann weiß und niemand wahrhaben will, von Natur aus ungerecht; und zwar auch dort, wo ständig kritische Maßstäbe angelegt und Wertordnungen konstituiert werden, etwa in den Künsten. Ja, das literarische Leben darf geradezu als ein Beispiel stehen für die eingangs behauptete Ungerechtigkeit des Lebens schlechthin, da nämlich erst die Zeit, dieser einzige Kunstrichter von unantastbarer Integrität und Autorität, die Dinge an ihren Platz rückt. Im jeweils aktuellen literarischen Leben hingegen steht oft ein Oberstes zuunterst, Kleinigkeiten werfen, infolge ihrer Nähe zu irgendeiner Lichtquelle, riesige Schatten, jedwede Schwalbe macht schon einen Sommer, und in dem Streit um die Ewigen Werte regiert doch zumeist nur jene cupiditas rerum novarum, die Cicero einst dem Catilina bescheinigt hat — und durchaus catilinarisch geht's ja auch zu im Literaturbetrieb.
Womit man sich nun einmal abzufinden hat, wenn auch nicht total: man kann, und man sollte — und sei's nur aus Sport, aus (freilich unzeitgemäßer) Lust an Fairneß —, ausgleichende Gerechtigkeit spielen. Und im Zeitalter des vom Fernsehen bis in die schlichtesten Kammern gefunkten Geschreies kann man das tun durch Hinweise auf die Stillen im Lande.: auf Josef Hofmann zum Beispiel, der eben in Salzburg sein sechzigstes Jahr vollendet und, gleichsam sich zur Feier, sein drittes Gedichtbuch
veröffentlicht hat: „Einwärts geworfen.“
Der Titel klingt widersprüchlich, zum Leben des Autors jedenfalls, da dieses immer weitere Kreise gezogen hat. Hofmann ist nämlich, was unsere sozialistischen Dichterfürsten durchwegs nicht sind, ein Proletarierkind: Sohn eines Bergmanns aus Lauf-fen in Oberösterreich; und er war als junger Mann tatsächlich, wovon literarisch, geschwafelt wird: arbeitslos. Er brauchte nicht die hohle Versprechung von Chancengleichheit, sondern besuchte als Dreißigjähriger die Arbeitermittelschule; und machte als Vierzigjähriger sein Doktorat. Dazwischen war er als Lehrer und in der Erwachsenenbildung tätig, und lernte für sich selbst stets weiter, indem er durch Augenschein, vor allem durch sprachliche Studien erst das antike Griechenland, dann die Ostkirche, schließlich das Judentum sich erschloß und seinem christlichen Welt- und Menschenbild integrierte.
Aus diesen Welten stammen, oft zu Signalen verkürzt, die Bilder seiner Gedichte. Sie, diese Gedichte, setzen beim Leser also wenn schon nicht Bildung selbst, so doch Bildungs-Willen voraus: sie stellen, gerade in ihrer mitunter epigrammatischen Verknappung, gewisse Ansprüche, insbesondere den des Nach-Denkens im Nach-Sprechen. Es sind jene hohen Ansprüche, die der Autor an sich selbst stets gestellt hat.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!